|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
In den Zeiten der Dampflokomotiven waren die
Inbetriebsetzungen
lange nicht so umfangreich, wie das heute der Fall ist. Trotzdem waren
auch dort gewisse Arbeiten vor der Auslieferung vorzunehmen und dabei war
der
Kessel
sehr wichtig. Diese unter Druck stehenden Behälter waren schon damals
genau kontrolliert und staatlich abgenommen. Daher musste jede
Lokomotive
vor der Auslieferung zur Kesselabnahme.
Besonders nicht im Bereich der
Feuerbüchse,
da es sonst zu Explosionen kommen konnte. Erst dann konn-te auch das Feuer
entfacht werden. Der abgelassene Druck im
Kessel
wurde jetzt durch den erzeugten Dampf wieder erhöht. In dem Moment, wo die Sicherheitsventile öffneten, wurde geprüft, ob der Kessel auch mit dem vorge-gebenen Druck beaufschlagt wurde. Erst wenn diese Venti korrekt arbeiteten, konnte die Abnahme be-endet werden. Die letzte Handlung war das Anbringen der
Plomben bei den
Sicherheitsventilen.
Diese durften im Betrieb nicht mehr verstellt werden. Die staatlichen
Siegel sorgten dafür, dass das auch so blieb. Die Kesselabnahme war von jeder
Lokomotive
zu absolvieren. Sofern diese erfolgreich war, konnte die Lokomotive an den
Besitzer ausgeliefert werden. Damals fuhren die Maschinen meistens in
eigener Kraft zu einem
Bahnhof
der als Übergabe vorgesehen war. Mit 45 km/h dauerte die
Überführung
von München recht lange. Auch später ab Winterthur sollte es keine kurze
Fahrt geben, dazu waren diese Modelle einfach zu langsam unterwegs. Bei allen
Lokomotiven
der
Gotthardbahn war der Ort der Übergabe immer der
Bahnhof
von Rotkreuz. Bei diesem begann die eigene Strecke und auf der fuhren die
Triebfahrzeuge
der Gotthardbahn in deren Verantwortung. Wie sie dorthin kamen, war der
Bahn egal, denn dafür waren immer die Hersteller verantwortlich. Die
Übergabe war keine grosse Sache, die Lokomotive wurde begutachtet und dann
ging es meistens nach Arth-Goldau.
Zwar sicherte der Hersteller immer zu, dass
er gut gearbeitet hat. Da Kontrolle bekanntlich besser ist, wurde diese
auch gemacht. Es sollte nicht immer korrekt gearbeitet werden. Nach der erfolgten Abnahme ging es dann an die Versuchsfahrten. Dabei wurden die Zugkräfte geprüft und gleichzeitig das Personal auf dem Fahr-zeug geschult. Das Lokomotivpersonal, das mit diesen Modellen fahren sollte, war sehr schnell klar. Alle Dampfloko-motiven der Gotthardbahn wurden im Titularsystem betrieben. Daher waren pro
Lokomotive
nur eine
Gruppe
von ein paar Mann zu schulen. Danach war dieses Mo-dell bereit für den
Einsatz. Der Einsatz der neuen schweren
Güterzugslokomotive
ist schnell geklärt, denn viel verrät der Name. Die Modelle der Baureihe D
wurden somit ab der Eröffnung der
Gotthardbahn im schweren
Güterverkehr
eingesetzt. Dort konnte die hohe
Zugkraft
genutzt werden. Da der Bestand knapp war, wurden diese Maschinen kaum auf
den flachen Strecken verwendet. Es war eine Berglokomotive und das sollte
sie von der ersten Minute unter Beweis stellen. Nach einer Maschine der Baureihe
C, die den
Güterzug
von Rotkreuz nach Erstfeld gebracht hatte, wurde die D vorgespannt.
Zusammen mit einer weiteren C am Schluss
ging es dann die steile
Bergstrecke
hoch nach Göschenen. Ab dort war dann die schwere
Güterzugslokomotive
alleine mit dem Zug unterwegs. Bei der Talfahrt vermochte die
Gegendruckbremse
den schweren Zug nicht zu halten, daher mussten also die
Bremser
auf den
Güterwagen
viel arbeiten.
Der Zug fuhr indes weiter nun einfach im
Schlepp einer anderen Maschine der Reihe D. Die am Monte Ceneri benötigten
Vorspann- und
Schiebelokomotive
wurden von der Reihe C, oder auch
CI gestellt. Sofern in Erstfeld eine Lokomotive verfügbar war, kam es auch zu Einsätzen auf den flachen Strecken. Wobei man diese getrost ignorieren kann, denn diese Modelle wurden für Bergstrecken gebaut, also wur-den sie auch dort eingesetzt. Besonders der
Güterverkehr
war in diesem Punkt un-erbittlich. Immer neue Züge mussten im
Fahrplan
eingebunden werden. Die Baureihe D konnte sich also kaum über mangelnde
Arbeit beklagen. Die ersten Monate im Betrieb zeigten, dass
sich die
Gotthardbahn bei einem Punkt gewaltig geirrt hatte. Der erwartete
Güterverkehr
war deutlich grösser, als die Prognose meinte. Nahezu täglich verdoppelten
sich gewisse Verkehre. Das brachte der jungen Gesellschaft viel Geld ein,
sorgte aber dafür, dass die
Lokomotiven
sehr stark ausgelastet waren. Dank neuen Modellen musste der Unterhalt
noch nicht so intensiv ausgeführt werden. Trotzdem sah es schnell so aus, dass die
Flotte von 15
Lokomotiven
nicht gross genug war. So mussten weitere Modelle bestellt werden. Mit den
weiteren acht im Jahre 1883 gelieferten Lokomotiven wollte man endlich
genug Maschinen für den
Güterverkehr
haben. Jedoch sorgten die neuen Lokomotive dafür, dass noch mehr Züge an
den Gotthard geschickt wurden. An der Auslastung dieser 23 Lokomotiven
änderte sich nichts.
Ein Punkt dabei war der
Kessel,
denn für diesen wa-ren die Betriebsstunden massgebend. Bei einer
Lo-komotive,
die im Betrieb nie zur Ruhe kam, kann man sich ausrechnen, wie schnell
diese Betriebs-stunden erreicht wurden. War das der Fall stand ein Besuch
in der
Hauptwerkstätte
an. Der Einsatz führte dazu, dass es einzelne
Loko-motiven
durchaus schafften in einem Jahr zweimal zur
Revision
in der
Hauptwerkstätte
vorzu-sprechen. Solch kurze Interwalle waren auch damals selten und wurden
eigentlich nur bei der
Gotthardbahn erreicht. Der Grund merkte die Baureihe D am eigenen
Leib, denn der
Güterverkehr
stieg von Minute zu Minute. So war schnell klar, die 23 Modelle reichten
schlicht nicht mehr aus. Die Sturm- und Drangjahre am Gotthard
bewirkten schnell, dass die auch 23 Exemplare nicht ausreichenden waren.
Der
Güterverkehr
übertraf auch die Erwartungen der kühnsten Experten. Die
Gotthardbahn war ein voller Erfolg, den die
Lokomotiven,
die in geringer Stückzahl vorhanden waren, deutlich zu spüren bekamen. Oft
ruhten sie nur, wenn neue
Kohlen
geladen wurden. Dann ging es gleich wieder los. So war es nicht weiter verwunderlich, dass
die
Lokomotiven
im Jahre 1886 erneut Zuwachs erhielten. Die vier nun von Maffei
abgelieferten Maschinen erweiterten den Bestand dieser Lokomotiven auf 27
Stück. Das zeigt, dass die
Gotthardbahn im
Güterverkehr
mit den
Triebfahrzeugen
sehr zu frieden gewesen sein musste, denn neue Modelle gab es bisher nicht
und so blieb die Reihe D vorerst die grösste Lokomotive der Gotthardbahn.
Der einzige Punkt, bei dem die Modelle der
Reihe D mitmachen mussten, waren die neuen Bezeichnungen. In Zukunft
sollten die schweren
Güterzugslokomotiven
als Baureihe D4T be-zeichnet werden. Sonst änderte sich nichts. Der Verzicht auf den V-Messer kann sicherlich hinterfragt werden. Bei der neuen Vakuumbremse waren nur die Reisezugwagen ausgerüstet worden. Mit solchen hatten die schweren Güterzugs-lokomotiven schlicht nichts zu tun. Ihnen bleiben die
Güterzüge
auf den
Bergstrecken.
Diese waren so langsam, dass auch das Problem mit dem
V-Messer
erklärt ist, denn wer mit 20 km/h den Berg hoch kroch, war sicher nicht zu
schnell. Nach einem Einsatz von fünf Jahren im schweren Bergdienst, können wir ein erstes Fazit ziehen. Die Lokomotiven verrichteten ohne grössere Problemen den schweren Güterverkehr. Beim nahezu pausenlosen Einsatz floss viel Wasser in den Kessel. Etliche
Tonnen
Kohle
wurden in der
Feuerbüchse
verbrannt. Die Baureihe D4T machte das Programm anstandslos mit und
eigentlich war nur der Mangel ein grosses Problem. Der Unterhalt dieser
Lokomotiven
war daher recht intensiv, was aber zum Betrieb passte. Gerade der
regelmässige Unterhalt erfolgte in kurzen Intervallen und das verlangte,
dass die Lokomotive in der
Hauptwerkstätte
weilte. Damit sie schnell wieder in Betrieb genommen werden konnte, wurde
einfach ein Ersatzkessel aufgebaut und das defekte Exemplar der
Revision
unterzogen. Die Lokomotive zog derweil wieder
Güterzüge. Nach nur einem Jahr wurden die Versuche mit
der
Vakuumbremse
eingestellt und nahezu gleichzeitig solche mit einer Lösung die mit
Druckluft
arbeitete, begonnen. Diese
Druckluftbremse
stammte aus Amerika und konnte dort schon grosse Erfolge verzeichnen.
Besonders die langen
Güterzüge
funktionierten in den USA besser mit der
Bremse.
Bei der
Gotthardbahn sollte die
Westinghousebremse
jedoch nur bei den
Reisezügen
verwendet werden. So überrascht es wenig, dass die schweren
Güterzugslokomotiven
als einzige nicht mit dieser
Bremse
versehen wurde. Nur schon der für den Einbau erforderliche Aufenthalt in
der
Hauptwerkstätte
konnte der Betrieb nicht verkraften. Was fahren konnte, sollte das tun und
nicht wegen etwelchem Blödsinn in der Werkstätte stehen. Es fehlte einfach
an ausreichend Maschinen für solche Aktionen. Es musste neues
Rollmaterial
her.
Deren Preis war jedoch so hoch, dass die Gott-hardbahn nach vier Lokomotiven die Lieferung be-reits wieder einstellte. Die Lösung für das Problem sollte eigentlich
eine neue
Tenderlokomotive
sein, die alle bisherigen Modelle in den Schatten stellte. Im Jahre 1890 verloren die
Lokomotiven
somit den Status der grössten Lokomotive der
Gotthardbahn. Die neue
Tenderlokomotive
der Baureihe D6 übertraf die Modelle
D4T bei den meisten Werten deutlich. Eigentlich war die D4T nur bei den
mitgeführten Vorräten etwas besser. So konnte sie mehr
Kohlen
und auch Wasser mitführen. Doch die anderen Werte, waren übertroffen
worden. Doch noch musste die neue Lokomotive zeigen, was sie konnte. Mit der neuen
D6 und den 31
Lokomotiven
der Baureihe D4T konnte der immer noch zunehmende
Güterverkehr
bewältigt werden. Zusätzliche Verbesserungen erreichte man auch mit einem
effizienten Einsatz. Was fahren konnte, wurde genommen und so fanden sich
plötzlich die schweren
Güterzugslokomotiven
als
Vorspannlokomotive
für einen
Reisezug
wieder. Um im Winter die
Reisezugwagen
zu heizen, gab es daher die
Dampfheizung. Sie müssen sich die D4T als
Vorspannlokomotive
vor dem
Schnellzug
vorstellen. Wegen der als Vorspann verwendeten
Lokomotive
kroch der Zug förmlich den Gotthard hoch. Der Hinweis, dass das Pflücken
der Blumen während der Fahrt verboten sei, hatte bei 20 km/h sicherlich
seine Berechtigung erhalten. Aber immerhin fuhr der Zug und das war in
diesen Jahren wirklich oft eines der grossen Wunder.
Wenn das in einem
Tunnel
der Fall war, wurde es zum be-hinderten Verkehr noch gefährlich. Das Thema
mit einer grossen
Tenderlokomotive
der
Bauart
Mallet musste daher nach einem Stück beerdigt werden. Die Reihe D4T gab den Takt an und dazwischen tummelten sich ein paar Modelle C3T, die auch immer zahlreicher wurden. Die D6, die mit sich selber zu kämpfen hatte, wurde kaum wahrgenommen, auch wenn sie gigantische Kräfte erzeugen konnte. Die schwersten
Güterzüge
wurden dank der Erhöhung der
Zughakenlast
mit mehreren
Lokomotiven
geführt. Eine D4T und eine C3T zusammen an
der Spitze und eine wei-tere C3T oder D4T
am Schluss. Es kamen an der Spitze oft auch zwei D4T zum Einsatz. Das hing in erster Linie davon ab, ob man Lokomotiven zur Verfügung hatte. Auch mit einem Bestand von 31 Exemplaren war
man knapp bestückt. Mehr
Lokomotiven
brachten am Gotthard unweigerlich mehr Züge und die wurden immer schwerer.
Eine D4T vor einem Zug des
Güterverkehrs
reichte oft nicht mehr aus, so dass man zwei Maschinen benötigte. Nur
hatte man kaum zwei D4T frei. Einen guten Punkt hatte die Reihe
D6. Mit den vier Maschinen konnten
grosse
Zugkräfte
erzeugt werden. Im Jahre 1894 kam der zweite Versuch mit vier in einem
Fahrzeug arbeitenden
Dampfmaschinen.
Die Reihe
Sie kamen in der Folge in den Güterverkehr und sorg-ten so dafür, dass die Reihe D4T etwas entlastet wurde. Das bedeutete aber unwei-gerlich, dass nun
eine in die
Hauptwerkstätte
konnte. Dort wurde die
Westinghousebremse
eingebaut und auch gleich ein
V-Messer
eingeführt. Nun sah man auch beim
Güterzug
das Tempo. Auch wenn nun eine Entspannung spürbar war,
mussten weitere Modelle der Reihe D4T beschafft werden. Immer mehr Züge
mussten mit zwei Exemplaren bespannt werden. Da der bisherige Hersteller
in Ungnade gefallen war, wurden bei der SLM in Winterthur weitere fünf D4T
in der normalen Ausführung und fünf in einer verbesserten Version
bestellt. Die normalen Modelle sollten 1895 geliefert werden und die
modifizieren 1902. Mit 36 Exemplaren war die Reihe D4T bei der
Menge noch nicht an der Spitze angelangt, denn die Baureihe
C3T hatte immer noch ein paar Exemplare
mehr. Diese halfen nun so gut es ging den schweren
Güterzugslokomotiven,
denn an einen Abschwung beim
Güterverkehr
war nicht mehr zu hoffen. Jede neue D4T schien gleich einen neuen
Güterzug
mitzubringen. Was fahren konnte, fuhr und das war schon immer so. Die grosse Veränderung sollte es auf der
politischen Ebene geben. Die fünf grossen
Privatbahnen
verwickelten sich immer mehr in Aktiengeschäfte. Bei der finanziell
starken
Gotthardbahn standen die Aktien der
Schweizerischen
Centralbahn
SCB
im Vordergrund. Das passte der
Nordostbahn
NOB
um Alfred Escher nicht und so ging man auch auf den Einkauf. Im Gegensatz
zum Gotthard vergass man dabei, dass noch Züge verkehren sollten.
Die Verstaatlichung der fünf grössten
Privatbahnen
war so eine, denn im Vorfeld wurde oft mit illegalen Methoden versucht das
Resultat korrekt zu bekommen. Letztlich lässt sich das Stimmvolk nicht
erpressen und schon gar nicht von einem Alfred Escher. Als gezählt worden war, stand fest die Tage der Pri-vatbahnen und somit der Gotthardbahn waren gezählt. Es war nun am Bundesrat die Meinung des Volkes umzu-setzen. Als erstes wurde eine formelle Gesellschaft
gebildet, die auf den Namen Schweizerische Bundesbahnen SBB hören sollte.
Danach wurden die
Privatbahnen
verstaatlicht. Da-zu mussten die Aktien der Privatbahnen durch den Bund
übernommen werden. Am Gotthard musste der Verkehr aber weiter
gehen und dieser verlangte nach neuen
Lokomotiven.
Die mit der SLM vereinbarte Lieferung fand daher statt und so kamen fünf
modifizierte Maschinen in den Betrieb. Diese hatten etwas mehr
Leistung
und bekamen zur Unterscheidung die Nummern 141 bis 145. Es sollten die
letzten Lokomotiven sein, die Nummern der
Gotthardbahn bekamen, denn die Bezeichnung D 4/4 entsprach schon
den
Staatsbahnen. Es kann klar erkannt werden, die
Gotthardbahn war nun in den letzten Zügen, aber nicht mit den
letzten Zügen. Gerade der
Güterverkehr,
der sich in den letzten Jahren erfreulich entwickelte hatte, war immer
noch im Wachstum. Wenn auch nicht mehr so schnell. Trotzdem die tägliche
Arbeit musste erledigt werden und das konnte die Baureihe D 4/4 sehr gut,
auch wenn die ältesten Modelle schon die dritte Bezeichnung hatten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
der Kesselabnahme werden die Bauteile auf den Betriebsdruck gebracht und
dann genau kontrolliert, ob irgendwo Wasser austritt. Auch unter dem hohen
Druck durfte das nicht passieren.
Bei
der Kesselabnahme werden die Bauteile auf den Betriebsdruck gebracht und
dann genau kontrolliert, ob irgendwo Wasser austritt. Auch unter dem hohen
Druck durfte das nicht passieren. Im
Im
 In
Biasca war dann Schluss. Die
In
Biasca war dann Schluss. Die
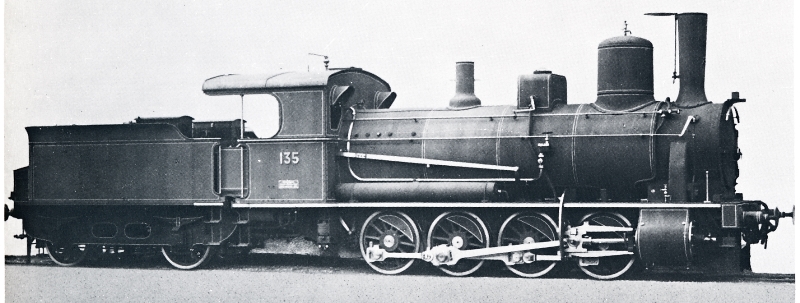 So
eine grosse Auslastung bei Dampflokomotiven führt schnell zu ersten
kleineren Problemen. Die Be-triebszeiten und Fahrwege waren für die
Planung des Unterhaltes wichtig.
So
eine grosse Auslastung bei Dampflokomotiven führt schnell zu ersten
kleineren Problemen. Die Be-triebszeiten und Fahrwege waren für die
Planung des Unterhaltes wichtig.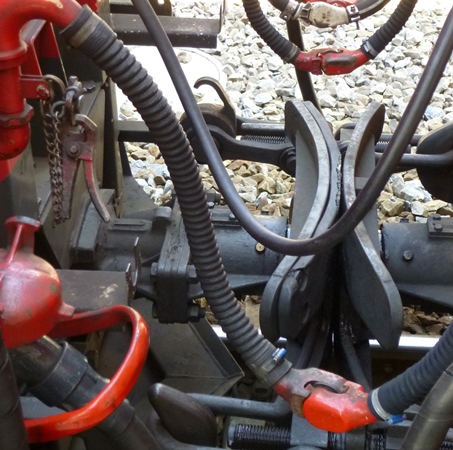 Nur
ein Jahr nach der Erweiterung der Flotte, begann bei der
Nur
ein Jahr nach der Erweiterung der Flotte, begann bei der
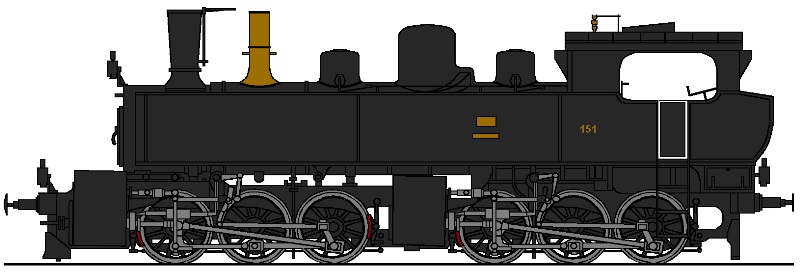 Der
Der
 Die
Die
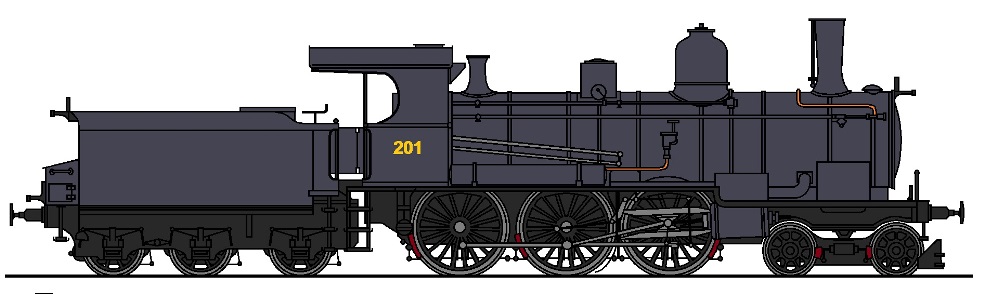 Die
neuen Modelle der Rei-he
Die
neuen Modelle der Rei-he  Um
eine Lösung für das Problem zu erhalten, war eine Volksabstimmung
angesetzt worden. In der Schweiz war und ist das üblich und nicht selten
geht es um wichtige Themen.
Um
eine Lösung für das Problem zu erhalten, war eine Volksabstimmung
angesetzt worden. In der Schweiz war und ist das üblich und nicht selten
geht es um wichtige Themen.