|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Dass wir hier eine
Lokomotive
mit
Pendelzug
hatten, zeigt auch die Tatsache, dass die
Nebenbetriebe
vorhanden waren. Im Gegensatz zu den meisten
Triebzügen,
wo spezielle Lösungen umgesetzt wurden, war das hier nicht der Fall. Die
Lokomotive wurde nach den Regeln dieser Fahrzeuge aufgebaut und daher
besass sie nahezu normale Nebenbetriebe. Wir beginnen mit deren Versorgung
und dazu müssen wir zum
Transformator
zurückkehren.
Ein Aufbau, der es erlaubte, die hier vorhandene
Spannung
auf einen genauen Wert einzu-stellen. Mit einer
Anzapfung
in der
Primärwicklung
entstanden grossen Unterschiede beim Wert der Spannung. Es stand so eine Spannung von 1000 Volt Wechselstrom zu Verfügung. Diese wurde auch nicht mehr weiter aufbereitet und daher die Leitung direkt mit dem Heizhüpfer verbunden. Dieses Schaltelement diente dazu, dass die folgende Leitung über zwei Schaltzustände verfügte.
Eine Messeinrichtung überprüfte den hier fliessenden
Strom.
Dieser durfte einen Wert von 365
Ampère
nicht überschreiten. Im anderen Fall wurde der
Hauptschalter
geöffnet. Im Vergleich zu anderen Baureihen war der Wert jedoch sehr
gering ausgefallen.
Mit der
Spannung
haben wir eine ganz normale
Zugsheizung
erhalten. Der geringe zugelassene
Strom
stellte kein Problem dar, da ja keine langen
Schnellzüge
mit der Energie versorgt werden mussten. Für die drei Wagen im geplanten
Pendelzug
war die
Leistung
ausreichend. Jedoch gab es bei der Bezeichnung einen grossen und auch
wichtigen Unterschied. Bei der
Lokomotive
Re 450 sprach man neu von einer
Zugsammelschiene.
Auf der
Lokomotive
wurde die
Zugsammelschiene
geteilt und anschliessend jede zu einem
Stossbalken
geführt. Dort waren dann die üblichen
Heizsteckdosen
vorhanden. Auch wenn auf der Rückseite ein nor-maler
Personenübergang
vorhanden war, auf das Anbringen eines
Heizkabels
wurde jedoch verzichtet. Wir haben daher nur die beiden Steckdosen am Ende
des Fahrzeuges. Mehr gab es auch nicht, denn die Leitung wurde auf der
Maschine nicht genutzt.
Damit können wir die
Nebenbetriebe
der
Lokomotive
bereits beenden. Alle auf der Lokomotive vor-handenen Verbraucher, die
nicht direkt mit der Versorgung der
Fahrmotoren
beauftragt wurden, wurden daher an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen. Die bisher betrachteten
Nebenbetriebe
waren ja nur für die angehängten Wagen vorgesehen. Für die Hilfsbetriebe
müssen wir die Betrachtung ebenfalls beim
Transformator
beginnen.
Bereits bei der Ausstattung im
Transformator
unterschieden sich die
Hilfsbetriebe
der
Lokomotive
von anderen Baureihen. So wurden hier zwei
Wicklungen
dafür vorgesehen. Bei einer davon stand die bekannte
Spannung
von 220
Volt
zur Verfügung. Bei der zweiten
Spule
wurde jedoch ein Wert von 800 Volt erreicht. Gerade diese Spannung war
speziell, denn sie scheint für die Hilfsbetriebe einer Lokomotive
überraschend hoch zu sein.
Mit zwei
Spulen
müssen wir die getrennten
Hilfsbetriebe
auch so ansehen. Damit ist klar, dass uns die zweite
Wicklung
mit 800
Volt
mehr interessiert, als die
Spule
mit den von anderen
Lokomotiven
her bekannten Werten. Spannend dabei wird auch sein, welche Verbraucher wo
angeschlossen wurden. Doch nun zum Netz mit 800 Volt. Eine
Spannung,
die nicht mehr so lange so hoch sein wird. Der
Wechselstrom
wurde hier verändert.
Die vom
Bordnetzumrichter
erzeugte
Spannung
variierte zwischen 115 und 380
Volt.
Auch die
Frequenz
war nicht fest. Hier konnten die Werte zwischen 15 und 60
Hertz
verändert werden. Wir haben daher eine Lösung wie bei den
Fahrmotoren. Es gab auf der Lokomotive drei Bordnetzumrichter. Dabei stand immer einer für ein Drehgestell zur Verfügung. Wer nun jedoch meint, dass der dritte Um-richter nur als Ersatz vorhanden war, irrt sich.
Auch diese Bauteile hatten ein ansehnliches Gewicht und daher
wurden sie genutzt. Wir beginnen die Betrachtung jedoch zuerst mit den
Modellen für die beiden
Drehgestelle,
die mit einer geringen Ausnahme identisch geschaltet wurden.
Über
BUR
1, beziehungsweise BUR 2, wurden die Motoren für die
Ventilatoren
versorgt. Hier kamen daher
Drehstrommotoren
zur Anwendung, die jedoch durch den
Bordnetzumrichter
geregelt werden konnten. Wurde die Drehzahl verringert, konnten die
Ventilatoren nicht die Menge Luft befördern, wie bei voller Drehzahl. Wir
haben der eine Regelung der
Leistung
erhalten, die jedoch in drei Werten abgestuft war.
Ventilatoren
waren für die beiden
Fahrmotoren,
den dazu gehörenden
Umrichter
und den
Transformator
vorhanden. Jedoch erfolgte die
Kühlung
der Baugruppen mit Ausnahme der Fahrmotoren nicht direkt. Jedoch werden
wir deren genauen Aufbau erst betrachten, wenn wir uns den
Hilfsbetrieben
mit 220
Volt
zuwenden. Hier wollen wir jedoch den Weg der Luft ansehen, denn diese
musste ja in die
Lokomotive
kommen und diese wieder verlassen.
In den
Filtermatten
erfolgte eine Reinigung und der Hohlraum wurde zur Beruhigung der Luft
benötigt. Bis hier gab es keinen Unterschied, denn alle
Ventilationen
sollten die Luft in diesem Bereich beziehen. Das war auch der Grund für
die vielen Gitter. Die für die Kühlung vorgesehene Luft wurde weiterhin durch den herrschenden Unterdruck in einen Kühlturm gezogen und dort dann durch den Ventilator beschleunigt.
Erst ab jetzt war auch ein geringer Überdruck vorhanden, der für
die
Kühlung
einen grossen Vorteil bedeutete. So stand mehr Luft zur Verfügung und
diese konnte mehr Wärme aufnehmen. Der Grund, warum
Ventilatoren
immer vorher eingebaut wurden. Bei den Fahrmotoren wurde die Luft über Faltenbälgen zu den Drehstrommotoren geführt. Dort durchströmte sie den Motor und nahm dabei die erzeugte Wärme und allenfalls auch vor-handenen Schmutz auf.
Die
Kühlluft
konnte dabei durchaus hohe Werte erreichen. So wurde die
Ventilation
erst mit der vollen
Leistung
betrieben, wenn die
Fahrmotoren
eine Temperator von mehr als 130°C hatten. Bei tieferen Werten wurde die
Leistung
der
Ventilatoren
reduziert.
Die
Kühlluft
hatte damit ihre Arbeit getan und sie wurde anschliessend unter der
Lokomotive
wieder ins Freie entlassen. Eine Lösung, die auch bei den
Stromrichtern
und beim
Transformator
genutzt wurde. Jedoch galten hier andere Werte bei der Temperatur und es
wurden spezielle Kühlelemente von der Luft umströmt. Die Werte bei der
Wärme betrugen beim Transformator 80°C und bei den Stromrichtern nur 55°C.
Dieser
Bordnetzumrichter
war für die Versorgung des Motors für den
Kompressor
vorgesehen. Eine Regelung der
Leistung
war nicht vorhanden, und die
Spannung
wurde auf 380
Volt
und 50
Hertz
geregelt. Zudem war er mit einer Notversorgung versehen worden. Fiel der BUR 3 wegen einem Defekt aus, konnte keine Druckluft mehr erzeugt werden. Damit das kompensiert werden konnte, wurde nun die Versorgung durch den BUR 2 übernommen.
Das führte dazu, dass die
Ventilatoren
in diesem Bereich nur noch mit stark liefen, wenn die
Druckluft
erzeugt werden muss-te. Ein totaler Ausfall der
Lokomotive
konnte damit verhindert werden und wir kehren wieder zurück zum
Transformator. Die zweite Spule wartet auf uns. Diese hatte zur Erinnerung eine Spannung von 220 Volt und die in der Fahrleitung vorherrschende Frequenz.
Die
Wicklung
wurde so geschaltet, dass sie galvanisch von der Hochspannung und von der
Erde getrennt war. Das erlaubte es die
Isolationen
im normalen Rahmen auszuführen und nicht für einen Wert von 15 000
Volt.
Eine Lösung, die seit Jahren angewendet wurde und auch sonst gibt es nicht
viel Neues.
In der abführenden Leitung war zum Schutz eine
Schmelzsicherung
eingebaut worden. Diese
Sicherung
war von den älteren Baureihen her bekannt und auch der anschliessend
eingebaute
Depotumschalter
war nicht neu. Trotzdem wollen wir uns diesen etwas genauer ansehen, denn
er trennte die
Hilfsbetriebe
für 220 Volt von der Versorgung und schaltete diese nun einer Steckdose
zu. Der Rückleiter wurde auf Erde geschaltet.
Deshalb wurden die
Stromrichter
und der
Transformator
in einem Gehäuse eingebaut und dieses mit dem dazu ausge-legten
Transformatoröl
gefüllt. Dieses verbesserte die
Isolation
und konnte gleichzeitig die abgegebene Wärme optimal aufnehmen. Durch
thermische Effekte wurde neues kühleres
Öl
zu den
Wicklungen
geführt. Ein Effekt, der jedoch für eine ausreichende Abkühlung der
Bauteile nicht ausreichend wirksam war.
Um diese Kühlung mit Flüssigkeit zu verbessern wurde diese mit
einer einfachen Pumpe in Bewegung versetzt. Angeschlossen wurde deren
Motor an die mit 220
Volt
betriebenen
Hilfsbetrieben.
An der Stelle der veralteten
Seriemotoren,
kamen neue Modelle zum Einbau. Diese
Wechselstrommotoren
zeichneten sich durch eine lange Lebensdauer aus und sie benötigten kaum
Wartung. Nachteil war nur, dass deren Drehzahl nicht verändert werden
konnte.
Bei einer
Ölpumpe
spielt das jedoch keine Rolle. So wurde das erwärmte
Kühlmittel
zu einem im Kühlturm montierten
Ölkühler
geführt und dort die Wärme an die Luft abgegeben. Die
Kühlung
wurde so verbessert und war ausreichend bemessen worden. Lediglich beim
Transformator
waren neu zwei Ölpumpen vorhanden, da dessen
Ventilation
bekanntlich sowohl vom
Bordnetzumrichter
1, als auch vom
BUR
2 übernommen wurde.
Diesem ohmschen Verbraucher war es egal, ob nun
Wechselstrom
mit 220
Volt
und 16 2/3
Hertz
ange-schlossen wurde, oder
Gleichstrom.
Eigentlich war es nur eine Frage vom Gewicht. Wenn wir noch die Steckdosen im Fahrzeug erwäh-nen, passten diese zu den üblichen Steckern. Jedoch war eine abweichende Frequenz vorhanden. Damit das erkannt werden konnte, wurde dies ange-schrieben.
Sie sehen, dass an den
Hilfsbetrieben
für 220
Volt
Wechselstrom
mit Ausnahme der beiden
Ölpumpen
keine Motoren mehr angeschlossen wurden und das galt auch, wenn wir uns
nun den letzten Punkt der Hilfsbetriebe ansehen.
Der letzte Punkt, den wir uns ansehen wollen, ist die
Batterieladung.
Diese wurde an den
Hilfsbetrieben
mit 220
Volt
angeschlossen und es wurde ein statisch arbeitendes
Batterieladegerät
verbaut. Neu war auch das nicht, denn das Modell wurde schon bei den
älteren Modellen verwendet und es verfügte über eine ausreichende
Leistung.
Die von diesem Gerät abgegebene
Spannung
war auf 40
Volt
Gleichstrom
eingestellt worden.
Wer sich etwas mit den älteren Fahrzeugen befasste, vermisste hier
vermutlich die Erzeugung der
Druckluft
über den
Depotstrom.
Das ging schlicht nicht, weil dessen Motor am
BUR
3 angeschlossen wurde. Jedoch gab es eine Lösung und da kam das
Batterieladegerät
zum Einsatz. Arbeitete dieses, wurden die
Batterien
entlastet und die Druckluft auf der
Lokomotive
konnte ohne Probleme mit dem
Hilfsluftkompressor
erzeugt werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Im
Im

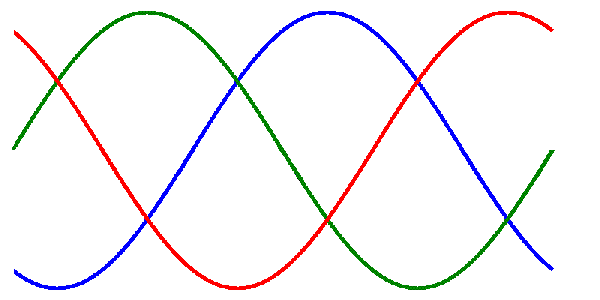 Mit
800
Mit
800
 Die
Luft wurde durch die seitlichen
Die
Luft wurde durch die seitlichen
 Speziell
war eigentlich nur der
Speziell
war eigentlich nur der
 Bei
der Vorstellung der
Bei
der Vorstellung der
 Die
weiteren Verbraucher der
Die
weiteren Verbraucher der