|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir zur
Beleuchtung und zur Steuerung kommen,
erreichen wir einen Bereich, der auch Punkte enthält, die anders platziert
werden können. Je komplizierter die Technik aufgebaut wurde, desto mehr
mussten die Ingenieure in die Steuerung investieren. Ein verklebter
Hüpfer
konnte noch mit Hammer und Meissel gelöst werden. Was macht man aber, wenn
ein
Thyristor nicht mehr richtig funktionieren will?
Es musste jederzeit sicher vorhanden sein und dah-er musste die Energie für dieses Stromnetz auf der Lokomotive gespeichert werden.
Die
Speicherung von elektrischer Energie ist recht einfach, das Problem ist
nur, dass deswegen mit
Gleichstrom gearbeitet werden musste. Das hatte
sich in all den Jahren nicht geändert. Um die elektrische Energie zu speichern, wurden Bleibatterien verwendet. Bei diesen erzeugte eine Zelle, die aus einer Platte mit Blei und einer mit Bleioxyd bestand, eine Spannung von zwei Volt Gleichstrom.
Nachteil war die zusätzlich benötigte Säure, die
ge-fährlich war. Aber die
Akkumulatoren waren so gut, dass sie seit Jahren
eingebaut wurden. Dabei wurden sogar hier die genormten und bei den Bahnen
üblichen Behälter verwendet.
Ein Behälter hatte neun Zellen enthalten, die in
Reihe geschaltet wurden. So stand eine
Spannung von 18
Volt zur Verfügung.
Mit zwei solchen Behältern konnte schliesslich die für die Steuerung und
Beleuchtung erforderliche Spannung von 36 Volt geschaffen werden. Wir
haben die Versorgung, die jedoch nur wenige Minuten zur Speisung aller
Funktionen der
Lokomotive geeignet waren. Zudem benötigten die
Batterien
Unterhalt.
Im Unterhalt konnten
Bleibatterien nicht so leicht
ausgebaut werden. Das Gewicht eines Behälter belief sich auf rund 400
Kilogramm. Auch zwei kräftige Männer heben das nicht aus der Maschine.
Daher wurde unter dem Kasten der
Lokomotive ein von der Seite her
zugänglicher
Batteriekasten eingebaut. Dank dessen Aufbau konnten die
Akkumulatoren mit den vorhandenen Hebemitteln entnommen und ausgetaucht
werden.
Da nun eine etwas höhere
Spannung
abgegeben wurde, änderte sich der Stromfluss in den Leitungen zu den
Batterien. Das hatte zur Folge, dass die
Bleibatterien wieder geladen
wurden. Da nun von diesen aber keine Spannung bezogen werden konnte,
über-nahm diese Aufgabe das
Ladegerät.
Die nun durch das
Ladegerät versorgten Bereiche des
Bordnetzes wurden jetzt mit einer gering höheren
Spannung betrieben. Die
Steuerung konnte das verkraften und lediglich bei der
Beleuchtung konnte
das etwas hellere Licht erkannt werden. Wobei dieser Effekt so gering war,
dass er nicht von allen Leuten erkannt werden konnte. Wir sind damit aber
bei den Verbrauchern angelangt und können uns daher der Beleuchtung
zuwenden.
Beleuchtungen gab es bei einer
Lokomotive an vielen
Orten. Diese befanden sich aussen und bildeten die
Dienstbeleuchtung. Im
Innenraum gab es aber auch Licht, das oft vergessen ging. Wir hier wollen
daher in der Lokomotive beginnen, denn dort gab es mehr Lampen, als das
bei anderen Baureihen der Fall war. Sie wurden zudem noch öfter benutzt.
Der Aufbau der Lokomotive Re 450 begünstigte dieses Verhalten zusätzlich.
Wer in die Maschine gelangte und in den
Führerstand
wollte, musste durch den
Maschinenraum gehen. Dabei bestanden die Wege
dort aus dem Quergang bei den Türen und dem üblichen Durchgang zum anderen
Ende des Fahrzeuges. Dieser wurde mittig angeordnet und daher gelangte
schlicht kein Tageslicht mehr an diesen Ort. Die im Maschinenraum an
mehreren Stellen montierten Lampen mussten daher den ganzen Tag
eingeschaltet werden.
Diese bestand aus einem einfachen
Schrittschalter, der bei jeder Betätigung eines Schalters den
Ma-schinenraum erhellte, oder verdunkelte. Wir haben so die Funktion, wie
Sie sie von den Treppen-häusern kennen. Auch die beiden Endbereiche wurden mit Licht versehen. So war an der Decke im Führerstand eine Lampe montiert worden, die einfach mit einem Schalter bedient wurde. Wichtig war, dass dieser von der Sitzposition des Lokführer bedient werden konnte.
Gerade in der
dunkeln Tageszeit mussten eventuell wichtige Schreibarbeiten erledigt
werden. Das ging aber nur, wenn während dieser Zeit im Raum ein Licht
brannte. Die Beleuchtungen der Instrumente waren mit der Dienstbeleuchtung verbunden. Wurde diese einge-schaltet, waren auch die Anzeigen mit einem Licht erhellt worden.
Wir kommen damit zu den aussen
montierten Lampen und werden dabei schnell feststellen, dass in diesem
Bereich gespart wurde. Auf der Seite des
Gepäckabteils gab es schlicht
keine einzige Lampe. Auch an der
Front waren diese nach anderen Regeln
montiert worden.
Im Bereich oberhalb der beiden
Zerstörungsglieder
wurde je eine Lampe montiert. Diese stammte aus den Reihen der LKW und sie
wurde schon bei den
Triebwagen
RBDe 4/4 verbaut. Der Vorteil dieser Lampen
war, dass nun auch ein
Volllicht erzeugt werden konnte. In der Regel war
das normale Licht vorhanden, das nun aber als
Abblendlicht bezeichnet
wurde. Auf beiden Seiten waren aussen rote Lampen für das
Zugschlusssignal
vorhanden.
Die Konstrukteure der Lokomotive fanden, dass das über dem Frontfenster montierte weisse Linienband als dritte Lampe genommen werden konnte.
Die Anzeigen dort wurden über die Steuerung der Durchsagen
eingestellt. Sie leuchtete daher weiss und konnte so als dritte Lampe
genutzt werden. Eigentlich hätten sich die Ingenieure der Erbauer damit zufrieden gegeben. Doch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verlang-ten, dass an der Front auch drei rote Lampen in Form eines A gezeigt werden mussten.
Dieses Warnsignal war sehr wichtig und daher
musste im
Front-fenster am oberen Rand noch eine Lampe mit einem Notrot
verbaut werden. So konnten nahezu alle
Signalbilder korrekt gezeigt werden
und nur das Spitzensignal war komisch. Wir haben die Beleuchtungen bald geschafft, denn uns fehlt nur noch ein Bereich, der auch mit Licht versorgt wurde. Der Gepäckraum war nach den Regeln eines normalen Gepäckwagen aufgebaut worden.
Er besass daher auch zwei Griffe für die
Notbremse. Die Lampen
hingegen wurden zusammen mit der
Beleuchtung der Wagen geschaltet. War
diese eingeschaltet, leuchte auch das Linienband an den beiden
Fronten des
Zuges.
Hingegen war die klassische Steuerung einer
Lokomotive verschwunden. Während man schon bei früheren Baureihen erste
Lösungen mit elektronischen Bauteilen umgesetzt hatte, kam nun der nächste
Schritt und das waren die Computer. Genauer genommen wurde von einem
Rechner gesprochen und dieser war auch nicht so aufgebaut worden, wie wir
uns einen Computer vorstellen. Vielmehr hatte er klare Aufgaben.
Dieses Gerät hatte daher die Aufgabe die beiden Umrichter so zu regeln, dass die Stromrichter die Spannung erzeugten, die effektiv benötigt wurde.
Einen Einfluss auf dieses System, das in sich ar-beitete,
hatte nur der zweite verbaute Rechner. Jedoch wurden von dem ALG auch
Statusmeldungen an die Steuerung übermittelt. Der zweite Rechner bildete das Fahrzeugleitgerät FLG. Wir können diesen Teil schlicht als das Hirn der Lokomotive ansehen. Bei den nachfolgenden Betrachtungen und Handlungen wurde das FLG beeinflusst und so die gewünschte Änderung verfolgt.
Sie sehen, einen
direkten Einfluss auf die Steuerung hatte auf dieser
Lokomotive eigentlich
nur noch das FLG. Doch mehr wollen wir nicht damit ver-lieren, denn wir
haben noch viele Punkte zu betrachten. Wie jeder Computer benötigten sowohl das ALG, als auch das FLG ein Betriebssystem. In den Jahren, wo die Lokomotive gebaut wurde, gab es noch nicht die heute bekannten Systeme.
Zudem hätten solche
Programme nicht den gewünschten Effekt gehabt. Aus diesem Grund wurde ein
eigenes für diesen speziellen Zweck entwickeltes Betriebssystem
geschaffen. Die
Lokomotive Re 450 arbeitete damit mit MICAS-S, das schon
erprobt war.
Viele Aufgaben, bei denen bisher der Lokführer in
bestimmtem Rahmen eine Handlung vornehmen musste, wurden vom FLG
übernommen. Dazu gehörte zum Beispiel die Regelung der
Ventilation. Diese
regelte sich, wie wir schon erfahren haben mit der Temperatur. War diese
jedoch weit genug gesunken und das Fahrzeug bewegte sich nicht, wurde die
Ventilation gänzlich ausgeschaltet. Der bisher dazu vorhandene Knopf gab
es nicht mehr.
Diese wurde
anhand der Vorgaben des Bedieners durch das FLG ausgewertet und mit der
gefahrenen Geschwindigkeit verglichen. Die Anpassung war damit so genau,
dass Abweichungen von den Vorgeben im Bereich von geringen Werten lag. Gerade die Regelung der Geschwindigkeit ist ein gutes Beispiel für die Arbeit des FLG und des ALG. Mit dem FLG wurden die Werte verglichen. Mussten diese korrigiert werden, schickte das Fahrzeugleitgerät den Auftrag an das Antriebs-leitgerät.
Dieses wiederum
stellte die
Frequenz für die
Fahrmotoren und deren
Spannung neu ein. Ein
Vorgang der in Bruchteilen von Sekunden erfolgte und daher eine genaue
Regelung ergab. Anhand der beiden Beispiele haben wir gesehen, dass durch die Rechner Aufgaben übernommen wurden und dass die Vorgaben des Lokführers umgesetzt wurden. Weitere Punkte die vom Lokführer verstellt werden konnten, werden wir im nächsten Kapitel mit der Bedienung ansehen.
Hier fehlt uns noch ein Punkt der neuen Rechner und das war die Diagnose
und die Überwachung. Beide Aufgaben wurden dem FLG übertragen. Für die Diagnose waren die Schnittstellen im Fahrzeug verteilt worden. Dort wurden Zustände gemessen und anschliessend durch das FLG ausgewertet.
Entsprachen diese nicht den verlangen Werten,
wurde durch das Steuergerät automatisch eine Schutzfunktion aktiviert. Das
konnte vom ausgeben einer
Fahrsperre, bis zur Auslösung der
Hauptschalters
führen. Aufgaben die auch bei der klassischen Steuerung so gelöst wurden.
Zudem leuchtete
eine
Entpannungstaste auf. Mit dieser konnte die Panne mit einfachen Handlungen
behoben werden. Die Störung blieb zwar, das Fahrzeug konnte aber wieder
fahren. Auch wenn die Anzeige mit Tafel mit den heutigen Erfahrungen primitiv erscheinen mag, sie funktionierte. Jedoch reichte diese Info nicht für das Personal der Werkstatt aus. Mit der Angabe Stromrichter zwei ausgefallen, war keine Reparatur möglich.
Daher konnte
an einer seriellen Schnittstelle ein Computer angeschlossen werden. So
wurde der Speicher ausgelesen und mit dem passenden Programm, konnte der
defekte
Thyristor gefunden werden.
Bei den
Sicherheitseinrichtungen der
Lokomotive Re
450 waren die Vorgaben der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu
berücksichtigen. Daher wurden hier die klassischen Systeme eingebaut,
diese jedoch über das FLG geregelt. Die Werte der
Sicherheitssteuerung
ASEGA wurden daher über das FLG an den Lokführer übermittelt. Dieser
reagierte dann entsprechend den Vorschriften. Ausgegeben wurden dabei der
Schnell- und der
Langsamgang.
Die
Wachsamkeitskontrolle, arbeitete wie das
Sicherheitselement, in Form des
Schnellganges, mit einer Wegmessung. Diese
war nach den Regeln der ASEGA vorhanden, nur wurden die Werte durch das
FLG ermittelt. Das erlaubte es dem Fahrzeug auch, diese Werte für andere
Aufgaben zu nutzen. Das wurde mit der Messung der Zugslänge genutzt. Diese
konnte vom Lokführer aktiviert werden und sie gab ein Signal aus, wenn der
Punkt vom Schluss erreicht war.
Jedoch war diese punktförmig arbeitende
Zugsicherung für
den Betrieb einer
S-Bahn nicht ausreichend und zudem waren die
Schweizerischen Bundes-bahnen SBB daran auch diese zu erneuern. Hier wurde
das umgesetzt. Neu war die Zugbeeinflussung ZUB 121. Diese Einrichtung arbeitete mit festen Punkten im Gleis und den Daten des Zuges. Bei einer Ermässigung wurde so eine Bremskurve berechnet, die den Bremsweg bis zum Stillstand überwachte.
Um die Fahrt nach einer
Bremskurve
fortsetzen zu können, wurde eine
Befreiung aktiviert, die aber den
erlaubten Wert für die Geschwindigkeit auf 40 km/h beschränkte und so
keine schnelle Fahrt erlaubte. Mit der Zugsicherung war man so sehr aktuell und das galt auch für die Gespräche zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter. Die Bahnhöfe der S-Bahn sollten nicht mehr zwingend mit Personal besetzt werden.
Zudem sollte auch kein
Zugführer
mehr mitfahren. Mit anderen
Worten, die bisherigen Möglichkeiten mit den Gesprächen war nicht mehr
möglich. Der am Gotthard bei
Güterzügen verwendete
Funk war gut, aber
veraltet. Aus diesem Grund wurde ein neues Funksystem entwickelt, das ebenfalls auf der S-Bahn in Zürich umgesetzt werden sollte. Diese System wurde ZFK 88 genannt und es erlaubte bidirektionale Verbindungen.
Zudem konnte der Eingabeterminal auch dazu genutzt werden,
die für
ZUB 121 benötigten
Zugdaten einzugeben. Auch der
Funk war so neu,
dass die Baureihe Re 450 die erste
Lokomotive war, die damit ausgerüstet
wurde.
Sie wurde bereits
für den
Pendelzug benötigt. Ohne den Einbau einer solchen Einrichtung war
es schlicht nicht möglich mit der
Lokomotive in beide Richt-ungen zu
fahren. So konnten die Entwickler neue Systeme nutzen und dabei wählten diese ein bei der Deutschen Bahn schon erfolgreich verwendetes System. Es sollte eine Lösung benutzt werden, die keine schweren Kabel mehr benötigte.
Die zudem auch in der Lage war, deutlich mehr
Informationen zu über-mitteln. Alle Bauteile dazu wurden daher von der ABB
in Mannheim in die Schweiz geliefert und dann in die
Lokomotive Re 450
eingebaut. Eingebaut wurde daher die Zeitmultiplexe Mehrfachtraktion Steuerung ZMS. Diese nutze codierte Signale um die Angaben zu übertragen. Das führte dazu, dass weniger Leitungen, als beim System Vst IIId der Fall war.
Benötigt wurden. Für die
ZMS konnten so freie
Adern in der
UIC-Leitung, die wegen dem
Funk und den Durchsagen so oder so
vorhanden war, genutzt werden. Es wurde kein Kabel mehr benötigt. An den
Enden war zudem die
automatische Kupplung zuständig.
Im System
ZMS wurde jeder Bereich, der eine
Bedienung erlaubte als Schnittstelle angesehen. Da maximal drei Züge
kombiniert werden sollten, waren das insgesamt sechs Punkte. Von diesen
wurde ein Bereich als
Master definiert. Dieser befand sich zwingend am
Ende der
Komposition. Alle anderen
Führerstände waren
Slave, die ihre
Meldungen an das FLG des Masters schickten. Der Master teilte auch die
Aufgaben mit.
Für die Behebung musste daher nicht mehr zum Havarist gegangen
werden. Eine Ver-einfachung die den Betrieb mit den
Pendelzüge
beschleunigen sollte. Noch ein Problem der Vielfachsteuerung war der Schutz der Triebachsen. Sass der Lok-führer auf dem Fahrzeug, konnte er ein Durchdrehen der Räder erkennen. Bei einem Abstand von 300 Meter war das nicht mehr möglich.
Aus diesem Grund wurde ein Schleuder- und
Gleitschutz
verbaut. Die Regelung desselben und auch die Massnahmen wurden vom FLG
übernommen und dabei wurden auch Vorgaben an das ALG übermittelt. Dieser Schleuderschutz funktionierte sehr gut und er konnte in einer Werkstatt eingestellt werden. Das erlaubte es der Lokomotive Re 450 auch bei schlechtem Zustand der Schienen eine optimale Beschleunigung zu erreichen.
Minutenlange Fahrten im Bereich des
Makroschlupfes waren kein Problem. Eher ein Problem waren die dann zu
hörenden Geräusche, die durchaus ein Belästigung für die Fahrgäste
bedeuten konnte.
Soweit können wir die Steuerung der
Lokomotive Re
450 beenden. Viele hier nicht im Detail erwähnten Vorgaben hingen jedoch
direkt mit den Handlungen des mit der Bedienung betrauten Lokführers
zusammen. Das ist jedoch ein Punkt, der mit der Bedienung betrachteten
werden sollte. Daher beschliessen wir die sehr umfangreiche Steuerung der
Maschine und begeben uns zum nächsten Kapitel, wo die Bedienung behandelt
wird.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
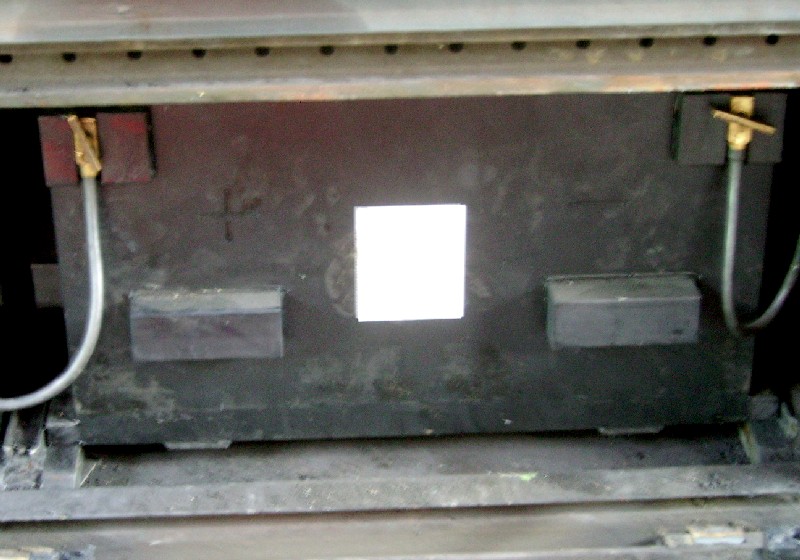 Auf jeden Fall benötigt man für diese Bereiche ein
Auf jeden Fall benötigt man für diese Bereiche ein
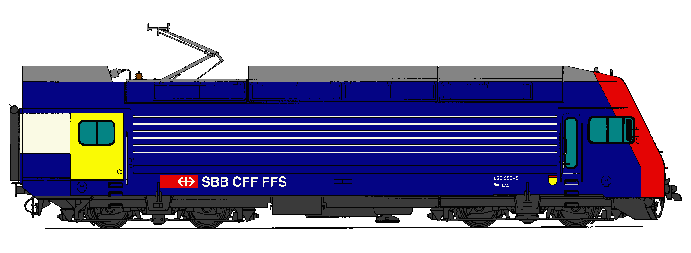 War die
War die
 Schalter für die
Schalter für die
 Das war es auch schon und wir können zur Steuerung
übergehen. Wie, es fehlt noch die dritte Lampe? Diese gab es schlicht
nicht mehr!
Das war es auch schon und wir können zur Steuerung
übergehen. Wie, es fehlt noch die dritte Lampe? Diese gab es schlicht
nicht mehr!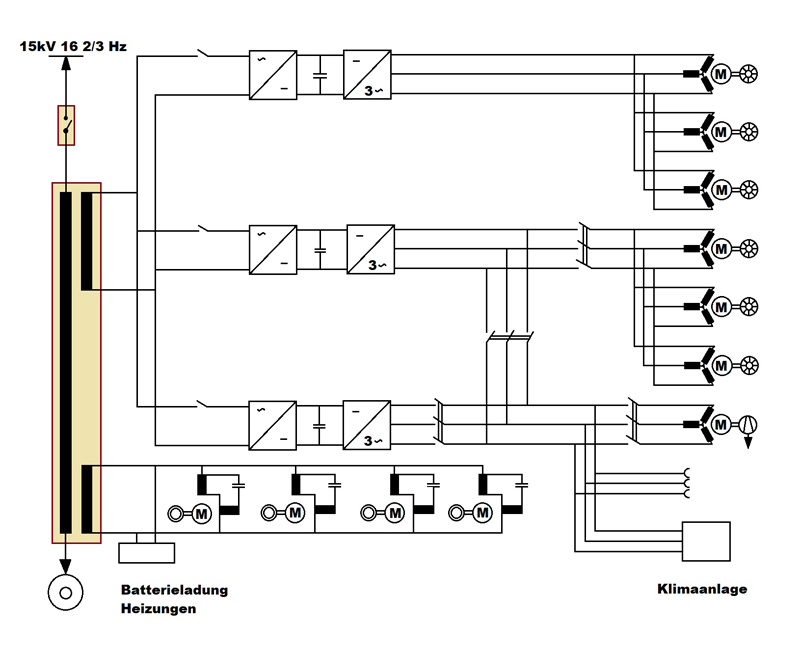 So war mit dem Antriebsleitgerät (ALG) ein Rech-ner
vorhanden, der sich um alle Belange der
So war mit dem Antriebsleitgerät (ALG) ein Rech-ner
vorhanden, der sich um alle Belange der
 Auch andere Regelungen arbeiteten so und in gewissen
Bereichen wurden die Vorgaben vom Lokführer automatisch umgesetzt. Ein
solcher Punkt war die Regelung der gefahrenen Geschwindigkeit.
Auch andere Regelungen arbeiteten so und in gewissen
Bereichen wurden die Vorgaben vom Lokführer automatisch umgesetzt. Ein
solcher Punkt war die Regelung der gefahrenen Geschwindigkeit. Da nun aber der Lokführer direkt keine
Da nun aber der Lokführer direkt keine
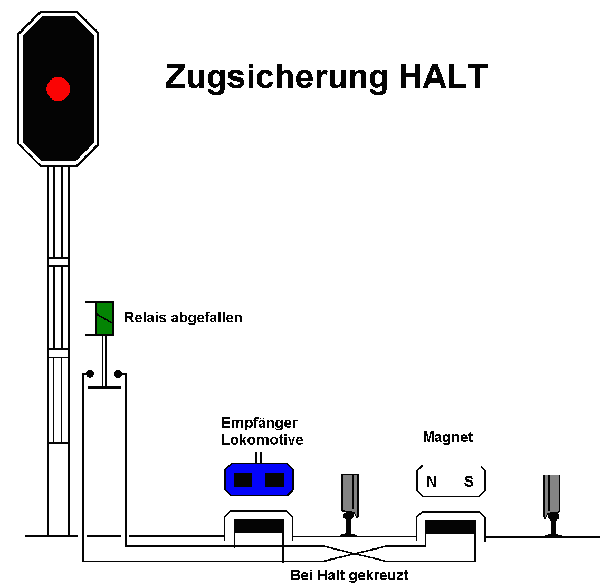 Nicht grundsätzlich anders arbeitete die
Nicht grundsätzlich anders arbeitete die
 Bevor wir zur Bedienung der
Bevor wir zur Bedienung der