|
Einleitung |
|||
|
|
Navigation durch das Thema | ||
|
Der
Titel wirkt auf Sie sicherlich verwirrend. Vielleicht haben Sie schon
etwas von ETCS gehört, aber nichts von ERTMS. Gross geschrieben wurden
diese Begriffe, weil es Abkürzungen sind. Da Sie schon etwas über ETCS
gehört haben, beginne ich mit ERTMS, das für «European Rail Traffic
Modular System» steht. ETCS ist dabei nur ein Teil davon. Doch beginnen
wir am Anfang und da kochte jedes Land noch ein eigenes Süppchen.
Doch
uns interessiert nicht das Gebäck, das für den Namen sorgte. Vielmehr
wollen wir uns die Züge ansehen, die dieses und die Leute transportierten.
Gezogen wurden die Wagen von
Lokomotiven, welche vom benötigten
Personal bedient wurden. Wie auf jeder heute bekannten Strecke gab es Bahnhöfe und Strecken. Auf den Strecken konnten sich damals die Züge frei bewegen.
Doch
sie trafen irgendwann auch auf einen
Bahnhof
und dabei musste schon früh geregelt werden, wie sie in diesen Hof
einfahren. Der Zug kam also in einem Bahnhof an und verliess diesen
wieder. An dieser Tatsache änderte sich nichts, bis wir zu unserem
eigentlichen Thema kommen.
Denken wir etwas weiter. Sie besuchen einen Freund mit dem Auto. Bei der
Ankunft fahren sie einfach auf den Parkplatz und gehen zur Türe. Treten
Sie danach einfach ein? Nein, sie klingeln und melden sich an. Der Freund
öffnet dann die Türe und Sie können eintreten. Was das mit unserem Thema
zu tun hat. Sie sind der Zug und der Freund ist der
Bahnhof.
Nur das mit dem eintreten war früher anders gelöst worden.
Wenn
sich der Zug dem
Bahnhof
näherte musste er sich rund 2000 Fuss, oder wie heute üblich 600 Meter vor
der
Einfahrweiche
bemerkbar machen und die Fahrt verlangsamen. Zusätzlich war vorgesehen,
dass der Lokführer mit der
Pfeife
der
Lokomotive
ein akustisches Signal gab. Dabei musste er zuerst lange und dann mehrmals
kurz und dann wieder lange pfeifen. Er machte sich daher bemerkbar und
meldete sich an.
Sie
klingeln also bei Ihrem Freund und treten dann einfach ein. Das geht, kann
aber Ihrer Freundschaft grossen Scha-den zufügen. Bei den Bahnen war das
gar nicht anders und es blieb ja nicht bei der
Spanischbrötlibahn. Um die Einfahrt in den Bahnhof besser regeln zu können, wurden erste einfache Signale verwendet. War dieses, also die Türe zu, musste der Zug warten. Erst wenn dieses die Einfahrt erlaubte, konnte der Zug einfahren.
Sie
treten auch ein, wenn der Freund die Türe öffnet. Diese ersten Signale
wurden
Einfahrsignale
genannt. Das war pas-send und sie sollten in den folgenden Jahren eine
grosse Bedeutung erhalten. Aus diesen ersten Signalen entwickelten sich im Lauf der Jahre immer bessere Systeme für die Signale. Es entstanden so erste Signalsysteme und mit diesen auch erste Stell-werke.
Mit
diesen wollen wir uns nicht gross befassen, denn diese werden auf anderen
Seiten vorgestellt. Vielmehr wollen wir etwas über den Tellerrand blicken,
denn oft finden sich die interessanten Dinge auf dem Tischtuch und nicht
im Teller.
Wenn
Sie einmal etwas weiter reisen, als nur zum besten Freund, dann werden Sie
schnell feststellen, dass die Signale der Schweiz teilweise durchaus auch
in anderen Ländern angewendet werden. Sie glauben das nicht? Es ist so, denn die Weichensignale der Schweiz können Sie durchaus auch in anderen Ländern finden und sie erfüllen den gleichen Zweck. Das ist einfach nur ein Beispiel und auch mit anderen Kombinationen ginge das.
Trotzdem gilt, dass jedes Land das machte, was es für richtig gehalten
wurde. An diesem Punkt gibt es nichts zu bemängeln, es funktionierte und
das ist letztlich der Punkt, der zählt. Kaum ein Signalsystem war perfekt aufgebaut worden, denn zusammen mit den Vorschriften ergaben sich immer wieder Punkte, die nicht das halten konnten, was man sich erhoffte. Die Folgen dieser Mängel waren immer wieder gleich.
Es
kam zu einem Unglück und nach diesem wurden dann Anpassungen vorgenommen,
die dazu führten, dass die Mängel beseitigt werden konnten. Oft war dabei
aber auch etwas Hilfe erfor-derlich. Zugunglücke waren schon seit Beginn recht selten, auch wenn es früher mehr davon gab. Wenn wir da an Brücken denken, die unter der Last des Zuges einstürzten, dann war schnell klar, man musste bei diesen mit anderen Regeln arbeiten.
So
wurden auch bauliche Regeln erlassen, die verhindern sollten, dass es
wieder zu so einem Fall kommen konnte. Leider ein frommer Wunsch, denn mit
Brücken
gab es immer wieder Probleme. Bei den Signalen war das nicht anders, denn die waren nur so gut, wie sie von den betroffenen Personen beachtet wurden. Auf der Strasse ist das auch so, denn dieses Schild mit dem runden roten Rand, macht Ihnen grossen Eindruck.
Anderen aber nicht und so wird das allgemeine Fahrverbot ignoriert. Es ist
menschlich, jedoch bei der Eisenbahn ausgesprochen gefährlich. Denken wir
doch kurz so und sehen einen Vorfall an.
Nachdem von mehreren Seiten Fehler gemacht wurden, war es ein Lokführer,
der schlicht angenommen hatte, dass das Signal für ihn keine Bedeutung
hat. Die Folge dieser Missachtung war das auf dem Bild zu sehende
Zugunglück. Das war schwer und es sollte so etwas nie mehr geben.
Angesetzt wurde dazu an mehreren Stellen und so sollte ein so schweres
Unglück nicht mehr entstehen. Zumindest so lang, bis es ein neues Unglück
gab.
Folgen sich diese in kurzer Zeit, dann liegt wohl im System ein Fehler und
bei der Eisenbahn wird das gleich in der Presse breitgeschlagen. Das war
schon immer so und wird auch so bleiben. Kaputte Fahrzeuge der Eisenbahn
finden sich immer auf der ersten Seite wieder. Bei einem Auto ist das
selten der Fall und der schrottreife rote Sportwagen mit dem Pferdchen ist
oft nur eine kurze
Meldung
im Verkehrsfunk wert.
So
wurden die Signale immer verbessert und diese auch mit Einrichtungen
versehen, die reagieren sollten, wenn der Mensch einen Fehler machte.
Diese wurden als
Zugsicherungen
bezeichnet und wie die Signale, entwickelten sie sich in jedem Land etwas
anders. Kein Problem, könnte man meinen, aber es sollte zu einem werden.
Doch dazu kommen wir etwas später, denn noch müssen wir uns mit den
Signalen befassen.
Signale waren immer nur ein Teil von
Stellwerken.
Wie besser diese wurden und wie genauer die Signale sein sollten, desto
teurer wurde die Sache. Gerade in die Sicherungsanlagen, also in die
Stellwerke und Signale, floss sehr viel Geld und das war bei den
Eisenbahnen immer eine Mangelware. Kombiniert mit der Tatsache, dass jedes
Land seine eigenen Ideen umsetzte, entstand ein Teufelskreis, der ganz
Europa erfasste.
Bei
beiden Fahrzeugen muss viel Geld in ein neues Modell entwickelt werden.
Bei der
Lokomotive verteilen
sich diese Kosten auf geringe Stückzahlen. 100 Modelle vom gleichen Typ
waren schon viel. Beim Auto hingegen, kann ein Modell in mehreren Ländern
verkauft werden und das führt zu gigantischen Stückzahlen. Das einzelne
Auto wird so billiger und in der Folge können davon noch mehr verkauft
werden.
So
kam es, dass die Bahnen in Europa schon früh darum bemüht waren, eine
Lösung zu finden, die einheitlich war. Was mit den Zug- und
Stossvorrichtungen
gut klappte, sollte auch bei den Sicherungsanlagen umgesetzt werden. Unter
der Leitung der
UIC
begannen daher die ersten Überlegungen und so sollte ein erstes
europäisches System zur
Sicherung
der Züge entstehen. Erste Versuche konnten daher aufgenommen werden.
Dieser Ansatz war die
Linienzugbeeinflussung.
Kurz
LZB
genannt, so sollten damit in Europa die Signale schlicht nicht mehr
benötigt werden. Geplant war, dass sich die Züge bei diesem System so
folgen können, wie das bei den Autos der Fall war. Mann bezeichnete das
als Fahren im absoluten Bremswegabstand. Eine Idee, die so aber nur bei
den Versuchen in der Schweiz umgesetzt wurde und dies auch nur das letzte
Kapitel war.
Sind jedoch viele Mitspieler vorhanden, hat jeder seine eigene Idee und das macht die Angelegenheit nicht so einfach.
Aber
nur mit wenigen Ländern konnte man schon einen Erfolg erzielen. Es sollte
anders kommen, als das Gedacht war. Bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die bei der Entwicklung der LZB als führende Bahn ange-sehen werden konnten, gab es zwei Strecken. Diese fanden sich zwischen Turgi und Koblenz und so im Flachland, aber auch zwischen Lavorgo und Bodio.
Flache und steile Strecken, aber das Problem lag in Bern und dort in den
Büros. Ein neuer General-direktor und alle Bemühungen der Fachleute waren
schnell verloren.
Der
neue Generaldirektor kam aus den Bereichen der Baudienste. Diese waren ab
dem für die
LZB
benötigten Kabel nicht erfreut. Es sorgte für einen grösseren Aufwand bei
Umbauten. Das wusste der oberste Chef und seinen Leuten wollte er das
Leben nicht schwer machen. So war schnell der Entschluss gefasst, die LZB
wird nicht eingeführt. Es blieb nur noch Deutschland, wo man die Sache
wegen den neuen schnellen Zügen benötigte.
So
war der erste Versuch für eine neue europäische Lösung an einem einfachen
Kabel gescheitert, das einen geringen Mehraufwand bei den Bauarbeiten
auslöste. Es blieb daher dabei, dass auch in den folgenden Jahren jede
Bahn in Europa das eigene Süppchen kochte und dabei versuchte jede Bahn
diese Suppe so gut, wie es nur ging zu machen. Neue Entwicklungen sollten
das in jedem Land lösen, was die
LZB
mit
CIR-ELKE
für Europa wollte.
Diese Kosten, mussten nun auf die einzelnen Baugruppen verteilt werden. In
der Folge waren die finanziellen Auf-wendungen so gross, dass es nicht mit
dem Plan klappte. Das Signalsystem vom Typ N war wirklich gelungen um nicht zu sagen schon fast genial. Leicht verständlich und zumindest in der Theorie für Geschwindigkeiten bis 200 km/h geeignet. Das einzige Problem, das es damit gab, war der Preis.
Die
Signale waren schweineteuer. Die Industrie machte Kosten geltend, die sich
schlicht keine Bahn im grossen Stil leisten konnte. Diese Signale mussten
daher langsamer eingeführt werden.
Soweit zu den Sicherungsanlagen der Bahnen. Kommen wir nun zu den
Fahrzeugen. Dabei stellt sich die Frage, was denn die mit den Signalen zu
schaffen haben. Schlicht nicht so viel, dass sie eine Erwähnung verdient
hätten. Jedoch waren Sie auch dafür verantwortlich, dass wir uns mit dem
Thema ERTMS befassen müssen. So lohnt es sich, wenn wir auch in diesem
Punkt etwas genauer nachsehen, denn das wird spannend.
Schon immer verkehrten die
Triebfahrzeuge
der Bahnen in Europa über die Grenzen. Oft war dann aber auch gleich
Schluss. Neue schnelle
Verbindungen
mit den
TEE
sollten aber eine Wende bringen, denn diese Züge sollten auch in anderen
Ländern eingesetzt werden können. Als Krönung davon kann sicherlich der
Triebzug
RAe TEE
II angesehen werden, der vier
Stromsysteme
verarbeiten konnte und dabei erst noch schnell war.
Die
Rekorde für das schnellste Fahrzeug sollten sich in kurzen Abständen
übertreffen. Damit das auch im planmässigen Verkehr möglich war, mussten
Signale her, die der Lokführer auch bei 300 km/h erkennen konnte. Alle erdenklichen Ideen waren vorhanden und in der Schweiz sogar jene mit normalen Signalen für 200 km/h. Es war letztlich die UIC, die zu diesem The-ma einen Erlass verfasste.
Man
sah dort als oberste Grenze für mit Signalen geführte Züge bei 160 km/h.
Damit erübrigte sich, die Erprobung des Systems N bei höheren
Ge-schwindigkeiten. Es musste eine Signalisation in den
Führerstand
her und da hatte jedes Land seine eigene Lösung.
Als
sich auch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit höheren Werten bei den
Geschwindigkeiten zu befassen begann, fehlte schlicht eine Signalisation
in den
Führerstand.
Diese hatte man seinerzeit entwickelt, aber wegen dem Kabel im
Gleis
die Pläne vernichtet. Die
LZB
war daher für die Schweiz kein Thema mehr. Es wurde eine Lösung mit
Funk
bevorzugt. Damit die Kosten der Entwicklung gesenkt werden konnte, soll
eine internationale Lösung her.
Damit sind wir wieder bei unserem Thema angelangt und nun sollte erneut
ein Versuch für ein einheitliches System gestartet werden. Dabei
beschränkten sich die Bahnen aber nicht nur auf die Signalisation, sondern
auch bei anderen Lösungen sollten dank neuen Regeln und Normen die Kosten
gemildert werden. Damit das klappte, wurden entsprechende Richtlinien
erlassen und diese unter dem Kürzel ERTMS eingeführt.
Das
Ganze wurde im Protokoll „European
Rail Traffic Modular System“ ERTMS de-finiert. Damit
waren die Grundlagen für einen neuen Anlauf zu einem einheitlichen System
endlich vorhanden. In diesem ERTMS waren neben den Anforderungen an die Stellwerke auch das eigentliche Zugsicherungssystem für die Strecken und Fahrzeuge enthalten. Dabei bot ERTMS nur das Dach des ganzen Systems, das vereinheitlichte Bauteile für die Stellwerke und die Zugsicherung ermöglichte. Damit sollten die Kosten bei der ganzen Sicherung verbilligt werden. Man konnte nach ERTMS ein komplett neues Bahnsystem aufbauen. Näher auf ERTMS eingehen will ich an dieser Stelle nicht.
Sie
müssen einfach wissen, dass darin die entsprechenden Schnittstellen, die
Techniken und die Baugruppen klar definiert wurden. Ein
Stellwerk
nach ERTMS muss sich dabei nicht unbedingt von einem konventionellen
Stellwerk unter-scheiden. Einzig die Bauteile sind nach den Normen von
ERTMS aufgebaut und stammen nicht mehr von einem einzigen Hersteller. Der Umfang von ERTMS ist so gross, dass er unseren Teil bei weitem sprengen würde. Es reicht, wenn wir wissen, dass alle nun vorgestellten Funktionen und Lösungen auf den Grundsätzen von ERTMS aufbauen.
Daher haben wir hier eigentlich nichts weniger als ein Grundgesetz
erhalten, an dem sich nun sowohl die Hersteller, als auch die Bahnen zu
orientieren haben. Wir nehmen dabei nur einen Teil heraus.
|
|||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||
| Home | Die Gotthardbahn | Die Lötschbergbahn | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Wenn
wir wirklich am Anfang beginnen, dann kommen wir in der Schweiz nicht um
die Strecke zwischen Zürich und Baden. Die Bahn wurde unter der
Bezeichnung als
Wenn
wir wirklich am Anfang beginnen, dann kommen wir in der Schweiz nicht um
die Strecke zwischen Zürich und Baden. Die Bahn wurde unter der
Bezeichnung als
 Jetzt
kommt der Unterschied, denn der Zug fuhr anschlies-send einfach in den
Jetzt
kommt der Unterschied, denn der Zug fuhr anschlies-send einfach in den


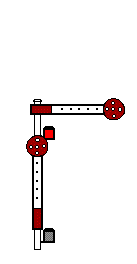 Anlagen,
die nur in einem Land wie der Schweiz verkauft werden können, ergeben eher
geringe Stückzahlen. In der Folge mussten die Kosten für die Entwicklung
auf diese geringe Menge verteilt werden. Das war auch der Grund, warum bei
der Bahn alles teurer wurde und anhand eines Beispiel wollen wir auch das
genauer ansehen und dazu wechseln wir kurz zu den Fahrzeugen. Diesmal ist
es der Vergleich einer
Anlagen,
die nur in einem Land wie der Schweiz verkauft werden können, ergeben eher
geringe Stückzahlen. In der Folge mussten die Kosten für die Entwicklung
auf diese geringe Menge verteilt werden. Das war auch der Grund, warum bei
der Bahn alles teurer wurde und anhand eines Beispiel wollen wir auch das
genauer ansehen und dazu wechseln wir kurz zu den Fahrzeugen. Diesmal ist
es der Vergleich einer
 Die
Die
 In
der Schweiz kam es so zu einem neuen
In
der Schweiz kam es so zu einem neuen
 Die
Geschwindigkeit von den
Die
Geschwindigkeit von den
 Die
Vorgaben der europäischen Union und der
Die
Vorgaben der europäischen Union und der