|
Fahrwerk mit Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die
Lokomotive
besass unter dem Kasten zwei
Drehgestelle. Diese waren
identisch aufgebaut worden und sie waren bei sämtlichen Maschinen nach der
gleichen Bauweise gebaut worden. Bei der Auslieferung konnte noch niemand
wissen, dass man mit dieser
Bauart den Durchbruch zu den modernen
Triebfahrzeugen geschafft hatte. Noch gab es einen wichtigen Punkt zu
klären, denn hier entschied sich die
Zulassung zur
Zugreihe R.
Beim Aufbau
der
Drehgestelle verwendet man Stahlbleche. Diese wurden mit der
elektrischen Schweisstechnik zu einem rechteckigen Rahmen verschweisst. Es
kam beim
Drehgestellrahmen somit ein Hohlträger zur Ausführung, dessen
Querschnitt rechteckig war, zur Anwendung. Als Verstärkung wurde in der
Mitte ein massiver Querträger eingebaut. Es entstanden im Rahmen weder
Knicke und die Endträger wurden nur leicht schwächer ausgeführt.
Wie bei den
Schienenräumern wurde der
Bahnräumer der
Lokomotive am
Dreh-gestellrahmen und nicht am Kasten montiert. Es kam ein quer zum Fahrzeug
verlaufendes leicht gepfeiltes Blech zur Anwendung. Dieses war zudem mit
ein-em speziellen Profil versehen worden.
Diese Lösung war sehr leicht, da
die Bahnräumer schmal ausgeführt werden konnten. Somit konnte man im
Gegen-satz zu den
Ae 4/4
der BLS-Gruppe auch hier Stahl verwenden.
Diese Montage ermöglichte es den
Bahnräumern sogar,
auch in sehr engen
Kurven das
Drehgestell optimal zu schützen. Auch wenn
man es wegen der Bauweise vermuten könnte, war der Bahnräumer nicht als
Schneepflug geeignet. Vielmehr sollten damit feste Gegenstände zur Seite
abgeleitet werden. Um die Schäden, die hier schnell entstehen konnten, zu
beheben, verwendete man zur Montage der Bahnräumer einfache
Verschraubungen.
In jedem
Drehgestell
wurden zwei
Achsen eingebaut. Diese bestanden aus einer
geschmiedeten Stahlwelle, der beiden
Räder
und den aussen liegenden
Achslager. Diese
Lager waren als zweireihige
Rollenlager ausgeführt worden
und sie konnten mit
Fett geschmiert lange Zeit ohne Kontrolle eingesetzt
werden. Der Vorteil lag darin, dass das
Schmiermittel
während der Fahrt
nicht verloren ging und sie nicht mehr ergänzt werden mussten.
Diese
Federung
war für hohe Geschwindigkeiten ideal, da sie wegen der
kurzen Schwingungsdauer die Stösse rasch aufnehmen und damit abbauen
konnte. Jedoch gab es deswegen mit diesen
Federn
Pro-bleme. Weil die Schraubenfedern dazu neigten, sich aufzu-schaukeln, musste dieser Effekt gemildert werden. Aus den Erfahrungen hatte man eine Einrichtung er-funden, die diese Schwingungen dämpfte.
Diese
Dämpfer arbeiteten mechanisch und
sie waren bei jedem
Lager an einer
Feder
eingebaut worden. Eine
Schmierung
dieser Dämpfer war jedoch nicht vorhanden, da man deren Reibung für die
Dämpfung der
Stösse
nutzen wollte. Damit die Achsen an der eingebauten Stelle blieben, wurden sie mit den innerhalb der Schraubenfedern eingebauten Führungen versehen. Diese Achslagerführungen waren mit Fett geschmiert und wurden sehr präzise ausgeführt um eine genau Lage der beiden Achsen zu erhalten.
Diese wiederum waren in einem Abstand
von 3000 mm im
Drehgestell
eingebaut worden. Das lag etwas unter jenem der
Lokomotive
Ae 4/4
von der BLS-Gruppe.
Bleiben noch
die auf der
Achse
aufgeschrumpften
Räder.
Diese wurden zur Reduktion des Gewichtes als
Speichenräder
ausgeführt. Auf diesen Speichenrädern wurde schliesslich die als
Verschleissteil vorgesehene
Bandage aufgezogen. Diese aus hochfestem Stahl
gefertigte Bandage, besass die
Lauffläche und den
Spurkranz zur Führung
des Rades. Eine Verschleissrille markierte zudem die maximal mögliche
Abnützung.
Mit dem
Durchmesser konnte das Gewicht jedes
Radsatzes zusätzlich verringert
werden. Aus diesem Grund wurden die
Räder gegenüber den anderen Baureihen
noch einmal kleiner ausgeführt. Bei der
Lokomotive der Reihe Re 4/4
begnügte man sich mit Rädern, die einen Durchmesser von 1 040 mm besassen.
Damit lag man über 200 mm unter der Lokomotive der BLS-Gruppe, was eine
deutliche Verringerung des Gewichtes zur Folge hatte.
Verwendet wurden dazu zähflüssige
Öle. Durch diese
Spurkranzschmierung
konnten die Kräfte im
Geleise redu-ziert werden. Jedoch reichte diese
Massnahme noch nicht aus, um eine
Zulassung für die
Zugreihe R zu
erhalten. Eine weitere Reduktion der Führungskräfte des ersten Radsatzes wurde mit der Verbindung der beiden Dreh-gestelle ermöglicht. Diese Verbindung wurde als Quer-kupplung bezeichnet.
Sie bestand aus zwei zwischen den
Drehgestellen
einge-bauten Deichseln. Diese wiederum waren über eine ge-federte
Kupplung
miteinander verbunden worden. Die
Querkupplung
darf jedoch nicht mit den
früheren
Kurz-kupplungen verglichen werden, da hier keine
Zugkräfte
wirkten.
Die
Querkupplung
bewirkte, dass die beiden
Drehgestelle im geraden
Gleis
stabiler liefen. Bei der
Einfahrt in eine
Kurve, reduzierte das hintere
Drehgestell über die Querkupplung den Anlaufwinkel des vorderen
Drehgestelles so stark, dass dieses in die Kurve gestellt wurde. Damit
entstand ein sehr ruhiger Lauf, der bisher bei vergleichbaren Lösungen nur
mit Hilfe der vorlaufenden
Laufachsen umgesetzt werden konnte.
Dank
Querkupplung und
Spurkranzschmierung
wurden die Kräfte im
Gleis soweit
reduziert, dass die
Lokomotive der Baureihe Re 4/4 die
Zulassung zur
Zugreihe R problemlos erreicht hatte. Sie konnte somit auch die
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h ausfahren. Was man damals nicht wusste,
war die Tatsache, dass nur eine kleine Veränderung bei den
Achslagern
der Reihe
Re 4/4
II
diese Zulassung auch mit
Achslasten von 20 Tonnen ermöglichte.
Kommen wir
zur Abstützung des Kastens. Damit liegen wir jedoch bei einem Punkt
komplett falsch, denn der Kasten wurde nicht auf dem
Drehgestell
abgestützt, sondern daran aufgehängt. Diese Konstruktion ermöglichte
mehrere Vorteile. So wurde beispielsweise verhindert, dass die Vibrationen
im Drehgestell auf den Kasten übertragen werden konnten. Zudem bot diese
Lösung auch Vorteile bei der Übertragung der Kräfte.
Dank dieser Lösung konnte die
Lokomotive mit den
Drehgestellen
abgehoben werden. Wollte man die Drehgestelle jedoch aus-bauen, mussten nur
die Schrauben und damit der Träger gelöst werden. In der Position gehalten wurde das Drehgestell mit einem üb-lichen Drehzapfen. Dieser war fest im Drehgestellrahmen einge-baut worden und griff von oben in den Querträger, wo er jedoch beweglich gelagert wurde.
Dieser
Drehzapfen war zudem so gestaltet worden, dass sich das
Drehgestell in den
gewünschten Richtungen frei bewegen konn-te. Die Fixierung war somit nur in
der Längsachse und zur Seite hin vorhanden.
Unter dem
Kastenquerträger wurde schliesslich die sekundäre
Federung eingebaut.
Diese
Sekundärfederung bestand aus
Blattfedern, die in Fahrrichtung
montiert wurden. Dabei sorgten mit
Öl
geschmierte Gleitpfannen dafür, dass
sich die Federung gegenüber dem Querträger verdrehen konnte. Da hier keine
Stösse in kurzer Folge erwartet wurden, konnte man diese mit einer langen
Schwingungsdauer versehenen
Federn verwendet werden.
Im Bereich
der Abstützung des Querträgers wurden die
Blattfedern mit einem
Verbindungsbalken zusätzlich miteinander verbunden. So entstanden in der
Federung keine Torsionskräfte. Zudem war auch dieser Träger mit den
Drehzapfen verbunden. So konnten sich die
Federn nur um diesen Punkt
drehen und sich nicht verschieben. Damit war deren Position festgelegt
worden. Eine Konstruktion, die anschliessend noch bei anderen Baureihen
verwendet werden sollte.
Diese Lösung ermöglichte es dem Kasten,
sich frei pendelnd in alle Richtungen zu verdrehen. Jedoch wurde der
Kasten durch die schiefe Montage dieser Pendel immer wieder über dem
Drehgestell zen-triert, so dass sich dieser kaum zur Gleislage verschieben
konnte. Wir haben nun den Kasten auf den Drehgestellen «abgestützt» und können uns den Massen zuwen-den. Der Abstand der beiden Drehpunkte lag bei allen Maschinen dieser Baureihe bei 7 800 mm.
Wir erkennen damit, dass die Abweichungen
bei der Länge nur von den
Führerständend abhängig waren und es daher auf
die
Drehgestelle keine Auswirk-ungen gab. Jedoch interessiert uns in diesem
Punkt vielmehr die Höhe der
Lokomotive.
Diese wurde
zwar erst bei der fertig montierten
Lokomotive bestimmt und
berücksichtigte dabei auch das Gewicht der elektrischen Ausrüstung und der
Betriebsstoffe. Diesen Aspekt blenden wir jedoch aus. Somit können wir die
Höhe bereits jetzt bestimmen. Die Oberkante des Daches lag dabei 3 700 mm
über der Oberkante der
Schienen. Die fertige Lokomotive der Baureihe Re
4/4 erreichte bei gesenkten
Stromabnehmern eine Höhe von 4 500 mm.
Noch fehlen
uns die eingebauten
Antriebe. Bei der hier vorgestellten
Lokomotive wurden
dazu vier
Fahrmotoren im Rahmen des
Drehgestellrahmen. Jeder davon
war für den Antrieb einer
Achse
verantwortlich. An diesen Antrieb wurden
jedoch drei grundlegende Anforderungen gestellt. So musste die Drehzahl
angepasst und die
Federung ausgeglichen werden. Wichtig war jedoch, dass
die ungefederte Masse sehr klein gehalten werden konnte.
Dieser
BBC-Federantrieb
mit Hohlwellenstummel wurde schon bei der
Loko-motive Am
4/4 verwendet und zeigte dort erste gute Ergebnisse. Gerade bei der
ungefederten Masse kam dieser
Antrieb sehr nahe an den
SLM-Univer-salantrieb, der zumindest in diesem Punkt sehr gut war. Das Drehmoment des Fahrmotors wurde in einem Getriebe vom Ritzel der Rotorwelle auf das grosse Zahnrad übertragen. Wegen den unterschiedlichen Motoren gab es bei den Getrieben leichte Unterschiede bei der Übersetzung.
Bei den Maschinen mit den Nummern 401 bis 426 wurde
diese
Übersetzung mit
1 :
2.85 angegeben. Die restlichen
Lokomotiven dieser
Baureihe hatten jedoch 1:2.31 erhalten. Was sich jedoch nicht auf die
Geschwindigkeit auswirkte.
Die
Zahnräder des
Getriebes waren zur Beruhigung mit
einer schrägen Ver-zahnung versehen worden. Die Erfahrungen mit der
Baureihe
Ae 4/6
zeigten klar auf, dass schräg verzahnte Getriebe
wesentlich weniger Lärm erzeugten und so die Fahrzeuge beruhigten. Jedoch
mussten auch diese Zahnräder optimal gelagert werden, denn sonst stimmte
die
Teilung nicht. Auch hier konnten wartungsfreie
Rollenlager verwendet
werden.
Das grosse
Zahnrad
lagerte dabei auf einem
Hohlwellenstummel, der um die
Triebachse
gelegt wurde. Damit umgab das
Zahnrad die
Achse. Es war zudem zusammen mit dem Ritzel in einem Kasten
montiert worden, der über ein Ölbad verfügte. Durch dieses
Öl lief das
grosse Zahnrad und nahm somit das
Schmiermittel auf. Durch den
geschlossenen Getriebekasten konnte der Verlust des Öls gegenüber den
Baureihen Ae 3/6 I und
Ae 4/7
massiv reduziert werden.
Im Innern des grossen
Zahnrades waren acht Kammern
mit Druckfedern und Federtellern eingebaut worden. Diese übertrugen das
Drehmoment elastisch auf den Mitnehmer. Dieser Mitnehmerstern war am
Rad
montiert worden und seine Arme griffen zwischen diese
Federn. Bewegungen
durch die
Federung fanden daher in diesen Federn statt. Das ungefederte
Gewicht des
Antriebes reduzierte sich so auf den Mitnehmerstern und den
Radsatz.
Von dort erfolgte der Kraftfluss über den
Drehzapfen auf den Kastenquerträger und so auf den Kasten der
Lokomotive.
Wo schliesslich die Kräfte beider
Drehgestelle gebündelt wurden.
Letztlich
wurde die
Zugkraft über die
Kupplungen auf die
Anhängelast
übertragen. Von
dieser nicht benötigte Zugkraft wurde in Beschleunigung umgewandelt. Ein
Vorgang, der jedoch nach physikalischen Grundsätzen arbeitete und daher
von den Maschinen genutzt wurde. Jedoch hatten diese unveränderbaren
Grundsätze auch Nachteile für den beschriebenen Kraftfluss und diese fand
man im Bereich der beiden
Drehgestelle. Durch den Kraftfluss wurde die vordere Achse im Drehgestell durch die Hebelwirkung entlastet. Ähnlich verhielt es sich auch mit der Lokomotive, die sich ob der Last vorne leicht aufbäumte.
Das
kennen Sie vielleicht von den Motorrädern oder anderen Rennfahrzeugen.
Diese komplette Entlastung des vorlaufenden
Drehgestells konnte mit dem
Gewicht der
Lokomotive jedoch ausreichend ausgeglichen werden. So
entstanden in diesem Bereich kaum Probleme. Schlimmer war jedoch die Entlastung im Drehgestell. Damit diese Entlastung möglichst gering war, wurde der Drehzapfen tief montiert und griff daher nicht in den Kasten, sondern vom Drehgestell nach unten auf den Kastenquerträger.
Zusätzlich wurde ein pneumatisch
betätigter Achslastausgleich eingebaut. Dieser drückte mit einem
Zylinder
von oben auf den
Drehgestellrahmen und presste so die
Achse gegen die
Schienen. Wie beim Adhäsionsvermehrer sollte dieser Achslastausgleich die Ausnutzung der Zugkräfte mit Veränderungen der Achslasten von bestimmten Achsen fördern. Jedoch reichten diese Massnahmen nicht in jedem Fall aus.
Besonders bei schweren Anfahrten, die auf
schmierigen
Schienen ausgeführt werden mussten, konnten die
Räder aller
Achsen die Haftung verlieren. Ein Vorgang, den man bei den Bahnen seit den
Dampflokomotiven kannte.
Aus diesem Grund wurden
Sandstreueinrichtungen
eingebaut. Der in einem Kasten, der von aussen gefüllt werden konnte,
mitgeführte
Quarzsand
wurde dabei über Elektroventile gesteuert mit der
Hilfe von
Druckluft auf die
Schienen und so vor das
Triebrad geblasen.
Angesteuert wurden daher die Einrichtungen der vorlaufenden
Achsen in
beiden
Drehgestellen. Somit in Fahrrichtung immer die Achsen eins und
drei.
In den insgesamt acht Sanderkästen waren rund 800
Kilogramm
Quarzsand mitgeführt worden. Diese Gewichte, die als
Betriebsstoffe bezeichnet wurden, umfassten auch die
Schmiermittel. Je
nach Vorrat konnte sich das Gewicht leicht verändern. Deshalb wurde immer
die Last bei halben Vorräten angegeben. Die Werte bei der
Lokomotive Re
4/4 lagen jedoch innerhalb der Toleranz und führten im Betrieb nicht zu
grösseren Problemen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Speziell war
hier jedoch die Ausführung des zum Schutz des
Speziell war
hier jedoch die Ausführung des zum Schutz des 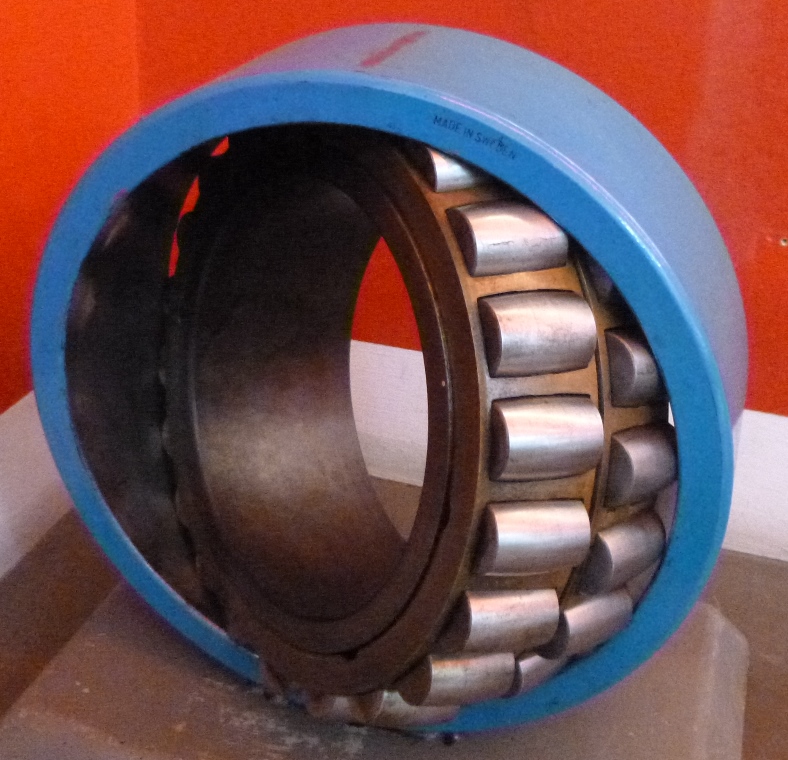 Die
Die
 Um die
Reibung des
Um die
Reibung des
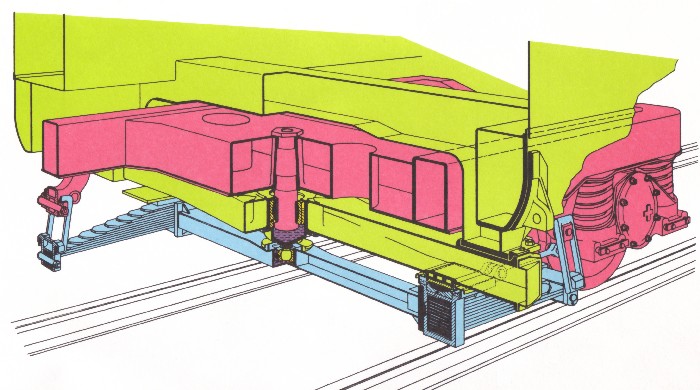 Kernstück
der «Abstützung» war der unter dem
Kernstück
der «Abstützung» war der unter dem  Die
Die
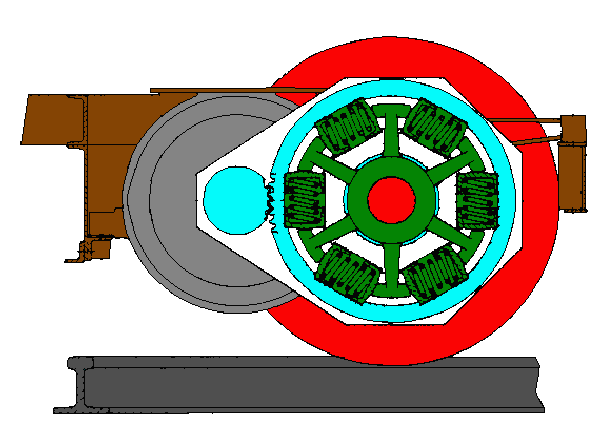 Verwendet
wurde ein neu von der Firma Brown Boveri und Co BBC ent-wickelter
Verwendet
wurde ein neu von der Firma Brown Boveri und Co BBC ent-wickelter
 Das so auf
die
Das so auf
die