|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Druckluft ist seit Jahren zu
einem wichtigen Teil der Fahrzeuge bei den internationalen Eisenbahnen
geworden. Dabei wurde sie schon seit längerer Zeit für die pneumatischen
Bremsen
benötigt und erlangte so mehr Bedeutung. Später kamen mit den elektrischen
Triebfahrzeugen
weitere Verbraucher dazu. Sie ist daher nicht mehr wegzudenken. Es ist
wichtig, dass wir auch hier einen genaueren Blick auf diesen Teil des
Triebwagens
werfen.
Der
Kompressor
für die Erzeugung der
Druckluft wurde beim
Gepäckabteil
montiert. Dabei fand er seinen Platz in einem kleinen
Maschinenraum,
der unmittelbar hinter dem Lokführer angeordnet wurde. Die benötigte Luft
wurde dabei über das zusätzliche
Lüftungsgitter
in dieser Seitenwand in den Raum gezogen und durch die
Filter
gereinigt. Der Maschinenraum diente zudem der Beruhigung der angesaugten
Luft.
Daher kann auf eine
für diese Züge ausgelegte
Leistung
ver-zichtet werden. Es gelang den Konstrukteuren damit erneut et-was
Gewicht einzusparen. Betriebliche Einschränkungen waren jedoch nicht zu
erwarten. Die vom Kompressor geschöpfte Luft gelangte anschliessend in eine einfache Leitung. In dieser eingebaut war der Lufttrockner, der die enthaltene Feuchtigkeit entzog. Ergänzt mit dem an-schliessenden Luftöler wurde die Druckluft optimal für den Be-trieb aufbereitet.
Das entnommene Wasser
wurde zudem in regelmässigen Ab-ständen automatisch in die Umgebung
entlassen. Dadurch konnte auch hier die Wartung vereinfacht werden. Da die Luft in einen Luftbehälter geschöpft wurde, stieg der Druck im Betrieb so lange an, wie die Verbraucher nicht genug Druckluft benötigten.
Damit der zulässige
Luftdruck
dabei nicht überschritten wurde, war in dieser Leitung ein
Überdruckventil
vorhanden. Dieses beschränkte den maximalen Druck in der Leitung auf einen
Wert von elf
bar.
Ein Wert, der auf den ersten Blick etwas verwirrend klingt, aber wegen der
Ansteuerung so gewählt wurde.
Um die Versorgung mit
Druckluft zu garantieren, war in der Leitung auch ein
von Druck gesteuerter Schalter vorhanden. Dieser schloss die elektrische
Verbindung,
bei einem Druck unter acht
bar.
Der
Kompressor
konnte nun Luft schöpfen. Stieg der
Luftdruck
in den Behältern auf einen Wert von zehn bar, öffnete sich der
Druckschwankungsschalter
wieder. Der Wert beim
Überdruckventil
betrug daher diesen Wert plus die Toleranz von 10%.
Dank diesen
Hauptluftbehälterhähnen
konnte der
Triebwagen
nach einem längeren
Stilllager, wieder in Betrieb genommen werden. Fehlte die Luft hier
jedoch, konnte sie mit einem
Hilfs-luftkompressor
ohne grossen Aufwand ergänzt werden. Auf der Seite des Fahrzeuges war die Speiseleitung ange-schlossen worden. Diese hatte den Druck, der in den Haupt-luftbehältern vorhanden war. Nicht auf einem festen Druck angewiesene Verbraucher auf dem Fahrzeug wurden an dieser Leistung angeschlossen.
Zudem wurde die
Speiseleitung
an die
Stossbalken
geführt und stand so auch angehängten Fahrzeugen zur Verfügung. Die
Ver-bindung
erfolgte mit jeweils zwei
Luftschläuchen,
die mit weis-sen
Kupplungen
versehen wurden. Bauteile, die mit einem festen Druck betrieben werden mussten, wurden an der Apparateleitung angeschlossen. Diese besass ei-nen permanenten Druck von sechs bar und sie wurde auf das Fahrzeug beschränkt.
Damit Sie nicht lange
nachdenken müssen, kann ich erwähnen, dass hier lediglich Bauteile der
elektrischen Ausrüstung angeschlossen wurden. Die Hauptversorgung lief
daher über die vorher erwähnte
Speiseleitung.
Neben den diversen
Verbrauchern des Fahrzeuges, wie zum Beispiel die
Lokpfeife,
wurden auch die einzelnen pneumatischen
Bremsen
des
Triebwagens
und des Zuges an der
Speiseleitung
angeschlossen. Sie sehen, es handelte sich daher um ein wichtige Leitung,
denn gerade die Bremsen benötigten eine sichere Versorgung mit
Druckluft. Sie konnten nur so optimal funktionieren.
Wobei hier gegenüber anderen Baureihen die Sicherheit erhöht wurde.
Wie das
vorgeschrieben ist, besass der
Triebwagen
zwei unabhängige
Druckluftbremsen.
Dazu gehörte auch die nur auf das Fahrzeug wirkende
direkte Bremse.
Sie wurde nicht mehr als konventionelle
Rangierbremse
ausgeführt, sondern man verwendete hier eine
EP-Bremse.
Beim Fahrzeug selber hatte dieser Unterschied eigentlich keinen
Unterschied zur Folge, jedoch auf die an der
Vielfachsteuerung
angeschlossen Modelle, denn diese konnten so auch gebremst werden.
Wenn wir nun von der
kleinsten möglichen Einheit ausgehen, bedeutet dies, dass sowohl der
Trieb-, als auch der
Steuerwagen
mit der
EP-Bremse
angesteuert wurden. Der Vorteil war, dass bei einem Halt in einer Steigung
die Zwischenwagen gelöst werden konnten. Dank der EP-Bremse fand die in
diesem Fall durch die
Kupplung
und die
Stossvorrichtungen
bedingte auftretenden Verschiebung der Wagen nicht mehr statt. Zudem
konnte auf die Leitungen an den
Stossbalken
verzichtet werden.
Wie die
Rangierbremse,
konnte auch diese
EP-Bremse
nicht als Sicherheitsbremse verwendet werden. Der Grund lag auch hier bei
der direkten Ansteuerung. Aus diesem Grund musste ein zweites indirekt
wirkendes
Bremssystem
eingebaut werden und an dieses wurden hier weit grössere Anforderungen
gestellt, als das bei anderen Fahrzeugen der Fall war. Daher blicken wir
etwas genauer auf dieses zweite eingebaute Bremssystem.
Der Vorteil war, dass
damit theore-tisch auch andere Wagen in den Zug eingereiht werden konnten.
Wie das gemeint ist, erfahren wir später, wenn wir uns dem Betriebseinsatz
zuwenden, doch nun geht es um die
Bremse. Die automatische Bremse arbeitete mit einer Hauptleitung. Diese wurde zu beiden Stossbalken geführt und stand dort auch anderen Fahrzeugen zur Verfügung.
Auch hier waren
jeweils zwei
Luftschläuche
vorhanden. Damit diese von der
Speiseleitung
unterschieden werden konnten, waren hier die
Abschlusshähne
und die
Kupplungen
Rot gestrichen worden. Zudem waren die beiden Kupplung der Speiseleitung
spiegelverkehrt ausgeführt worden.
Im Betriebszustand,
also bei gelöster
Bremse,
war die
Hauptleitung
mit einem Druck von fünf
bar
gefüllt. Um eine Bremsung einzuleiten, musste diese Leitung entleert
werden. Das konnte vom
Bremsventil
des Lokführers, aber auch von der
Notbremse
und einer
Sicherheitseinrichtung
aus erfolgen. Die Füllung erfolgte jedoch ausschliesslich über das
Führerbremsventil
im besetzten
Führerstand.
So war eine sichere Bedienung möglich.
Sankt der Druck in
der
Hauptleitung
auf einen Wert von weniger als 4.6
bar,
wurde auf den
Triebwagen
eine Bremsung eingeleitet. Dazu reagierte das auf dem Triebwagen
eingebaute
Steuerventil.
Diese führte die Bremsung entsprechend dem vorhandenen Druck aus. Wie
mittlerweile üblich, konnte dieses Steuerventil auch in Stufen gelöst
werden. Daher bezeichnete man diese
Ventile
auch als mehrlösige Steuerventile.
Wegen der gefahrenen
Geschwindigkeit von 125 km/h war das
Steuerventil
zudem mit einer Umstellung versehen worden. Daher stand hier neben der
üblichen
P-Bremse
auch die Bremskrafterhöhung in Form einer
R-Bremse
zur Verfügung. Nicht vorhanden war hingegen die bei
Güterzügen
benötigte
G-Bremse.
Das war bei dieser Hochleistungsbremse jedoch kein Manko, das beanstandet
werden müsste, den vor solchen Zügen verkehrte der
Triebwagen
gar nicht.
Dadurch konnte man
sich bei diesem
Triebwagen
das Gewicht für ein umfangreiches
Bremsgestänge
ersparen. Auf die Wirkung der
Bremsen
hatte das je-doch keinen grossen Einfluss, daher können wir uns
ei-gentlich bereits der eigentlichen Bremse zuwenden. Die mechanischen Bremsen des Triebwagens wirkten mit, in Sohlenhaltern gehaltenen Bremssohlen auf die Laufflächen der Räder. Es war daher eine klassische Klotzbremse vorhanden. Jedoch wurden hier keine Sohlen aus Grauguss mehr verwendet.
Vielmehr wurden
Modelle aus Sintermetall eingebaut. Diese hatten den Vorteil, dass die
Laufflächen
nicht mehr so stark aufgeraut wurden. Jedoch war auch ein Nachteil
vorhanden, den wir später noch ansehen.
Die
Druckluft vom
Steuerventil
drückte die
Bremsklötze
dank dem ausgestossenen
Bremszylinder
ans
Rad
und erhöhte so die Reibung. Der
Triebwagen
wurde dadurch verzögert. Wurde die Druckluft im Bremszylinder abgelassen,
sorgte eine
Feder
dafür, dass die
Bremssohlen vom Rad abgehoben wurden. Dadurch war gesichert,
dass diese nicht auf dem Rad kleben blieben. Es entstand so eine gut
funktionierende
Bremse.
Die
Bremsklötze
aus Sintermetall reduzierten die Laufgeräusche, der üblichen mit Klotzbremse
ausgerüsteten Fahrzeuge, deutlich. Jedoch hatten sie ein anderes
Verhalten, als die bisherigen
Bremsbeläge.
Das wirkte sich zu einem Teil auch auf die
Bremsrechnung
aus. Es wird daher Zeit, dass wir mit den
Bremsen
rechnen und dabei stellten wir ein Manko fest, das die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB dazu bewegt eine andere Lösung zu wählen.
Im Vergleich zu den
Bremsklötzen
aus Grauguss, war der Wert bereits geringer. Der Grund lag beim anderen
Verhalten der neuen
Bremssohlen. Ein Nachteil, der nicht so gross wirkte, da beim
Triebwagen
die
R-Bremse
immer aktiviert wurde. Mit der R-Bremse erhöhte sich der Druck. Das Brems-gewicht stieg nun auf einen Wert von 87 Tonnen. Damit wurde nun einem Bremsverhältnis von 120% erreicht.
Der
Triebwagen,
der mit der
Zulassung
zur
Zugreihe R
versehen war, verkehrte daher nach der Zugreihe R 115%. Mit der hier
vorhandenen
Höchstgeschwindigkeit
von 125 km/h reichte dieser Wert aus. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen
war der Wert daher etwas geringer.
Es muss jedoch
erwähnt werden, dass der kleinste mögliche
Regionalzug
immer einen
Steuerwagen
mitführte. Zusammen mit diesem Fahrzeug, das eine gut wirkende
Bremse
erhalten hatte, konnte mit dem
Pendelzug
trotzdem nach der
Zugreihe
R 125% gefahren werden. Die geringeren Werte für den
Triebwagen
waren nur zu beachten, wenn dieser in Alleinfahrt überführt werden musste.
Doch kommen wir nun zum Nachteil.
Wegen dem Verzicht
auf ein
Bremsgestänge
konnte zur
Sicherung
des Fahrzeuges keine
Handbremse
mehr eingebaut werden. Die übliche Spindelbremse funktionierte nicht.
Trotzdem musste der
Triebwagen
mit einer von der
Druckluft unabhängigen
Bremse
versehen werden. Daher baute man bei diesem Fahrzeug als
Feststellbremse
eine
Federspeicherbremse.
Im Gegensatz zur Handbremse konnte sie jedoch nicht mehr geregelt werden.
Die
Federspeicherbremse
wirkte dabei jeweils auf einen
Bremszylinder
jeder
Achse.
Dazu wurde dort ein zusätzlicher Bremszylinder montiert, was das Gewicht
wieder erhöhte. Wegen der Tatsache, dass keine Regulierung der
Bremskraft
vorhanden war, wurde die Kraft der
Bremse
jedoch auf 42 kN beschränkt. Der Triebwagen hatte daher ein massgebendes
Bremsgewicht
von 20 Tonnen erhalten und konnte trotzdem auf dem ganzen Netz abgestellt
werden.
Damit haben wir
jedoch auch das Stichwort bekommen, denn mit den
Bremsen
haben wir den mechanischen Teil abgeschlossen. Bevor wir die weiteren
Teile des Fahrzeuges betrachten, stellen wir den
Triebwagen
auf die Waage. Für den mechanischen Teil wurde dabei ein Gewicht von 43.4
Tonnen gemessen. Bei maximaler
Achslast
von 20 Tonnen, die inklusive Beladung eingehalten werden musste, blieb für
den elektrischen Teil nicht mehr viel übrig.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Eingebaut
wurde ein
Eingebaut
wurde ein  Die
Die
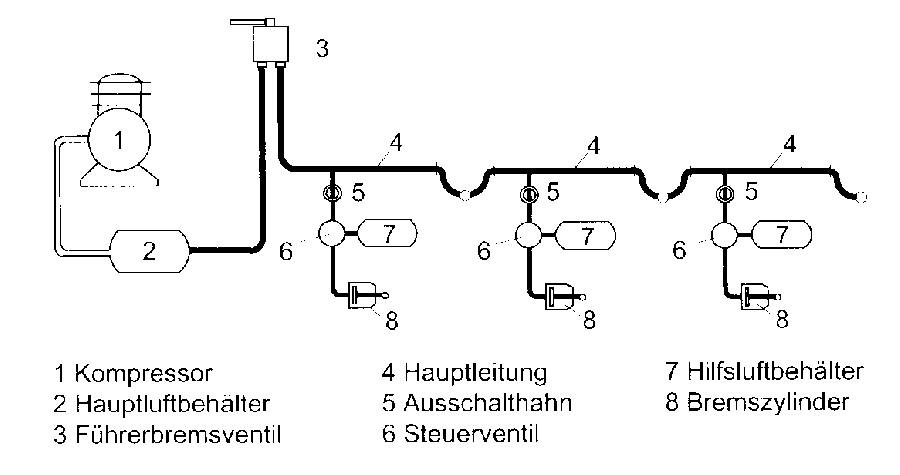 Die
indirekte
Die
indirekte  Vom
Vom
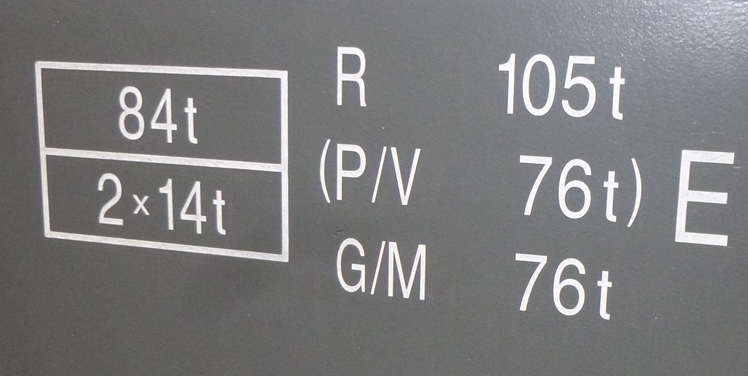 Bei
wirksamer
Bei
wirksamer