|
Der Kasten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Beginnen wir die Betrachtung des
Triebwagens
mit dem Grundaufbau des Kastens. Dieser bestand, wie das in der Schweiz
beim Bau von Schienenfahrzeugen seit Jahren üblich war, aus mehreren
einzelnen Bauteilen. Diese unterteilten sich in den Boden, die beiden
Seitenwände, das Dach und natürlich in den
Führerstand.
Da das Fahrzeug nur für eine Richtung gebaut wurde, kam auf der Rückseite
eine einfache Stirnwand zur Anwendung.
Die einzelnen Teile des Kastens wurden aus Leichtstahl gefertigt.
Diese Bauweise wurde erstmals bei den
Leichtstahlwagen
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB erfolgreich angewendet und kam
mittlerweile auch beim Bau von
Triebfahrzeugen
zur Anwendung. Die grösste Einsparung beim Gewicht erreichte man bei
dieser Bauweise durch die Tatsache, dass kein Bauteil die Kräfte alleine
aufnehmen konnte. Man sprach daher auch von einem selbsttragenden Kasten.
Wenn wir mit dem Boden beginnen erkennen wir den Hintergedanken
schnell, denn dieser Bestand durchgehenden Hohlträger aus Stahl, der nur
an den wichtigsten Stellen zusätzlich verstärkt wurde. Da der Fussboden
trotz dieser schlanken Bauweise auf 1 200 mm über
Schiene
zu liegen kam, wurde der Boden im Bereich der
Einstiegstüre
zusätzlich abgesenkt. So erreichte man dort einen Wert von 750 mm, was im
Vergleich sehr niedrig war.
Es handelt sich dabei lediglich um die Verkleidung des senkrechten
Bauteils. Bei der Betrachtung der
Stoss-balken
können wir uns daher auf eine Seite beschrän-ken.
Mittig im
Stossbalken
wurde der
Zughaken
montiert. Dieser war im Boden federnd gelagert worden und er konnte sich
in der Länge gegen die Kraft der
Feder
verändern. Durch die bewegliche Montage war der Haken zudem in allen
anderen Richtungen beweglich. Am Stossbalken angebrachte Führungen unten
und oben vom Zughaken beschränkten diese Bewegung jedoch in der Höhe, so
dass sich dieser nur seitlich verschieben konnte.
Optimal im Boden eingebrachte Verstrebung sorgten dafür, dass die
Kräfte vom
Zughaken
ideal abgeleitet wurden. Durch die bewegliche Montage, galt das jedoch
auch für die
Kupplung,
die so ideal belastet wurde. Daher war die maximal zulässige
Zugkraft
auf 550 kN festgelegt worden. Am Zughaken wurde auf beiden Seiten des
Fahrzeuges zudem eine
Schraubenkupplung
nach
UIC
montiert. Damit waren bei diesem
Triebwagen
vollwertige
Zugvorrichtungen
vorhanden.
Da die
Zugvorrichtungen
jedoch keine
Stosskräfte
aufnehmen konnten, mussten diese mit den seitlich montierten
Stossvorrichtungen
ergänzt werden. Dazu wurden am
Stossbalken
mit Hilfe von Schrauben zwei
Puffer
montiert. Dabei kamen die Puffer selber jedoch nicht direkt auf dem
Stossbalken zu Montage. Der Grund waren die in einer Nische eingelassenen
Zerstörungsglieder.
Diese waren für die BLS-Gruppe
neu, hatten sich jedoch bei den
Staatsbahnen
bewährt.
Dabei wurden hier jedoch Modelle von
Reisezugwagen
verwendet. Deren Tel-ler wurden oben mit abgeschrägten Ecken versehen.
Beim hinteren Ende, war das wegen dem
Gummiwulst
sogar notwendig. Mit den Puffern haben wir bereits die Länge des Fahrzeuges bestimmt. Der Triebwagen wurde mit einer Länge von 25 000 mm gemessen. Damit ent-sprach der Triebwagen der damals üblichen Länge von Fahrzeugen. Dies,
obwohl es bereits längere
Reisezugwagen
gab. Da diese Länge auch bei den Wagen anwendet wurde, erreichte man
standardisierte Längen ab 50 Me-ter für den Zug. Die Stritte betrugen
dabei immer 25 Meter. Bevor wir uns den beiden Seitenwänden zuwenden, muss noch erwähnt werden, dass unter dem vorderen Stossbalken beim Führerstand noch ein Bahnräumer am Boden montiert wurde.
Dieser
Bahnräumer
war so ausgelegt wurden, dass Gegenstände, die auf dem
Gleis
lagen, seitlich abgeleitet wurden. Jedoch war die Bauform nicht für die
Schneeräumung
geeignet. Da auch hier nur Schrauben angewendet wurden, konnte der
Bahnräumer leicht ausgewechselt werden.
Kommen wir zu den beiden Seitenwänden, diese wurden mit
Wälzprofilen aufgebaut. Dadurch erhielten sie trotz leichter Bauweise eine
grosse Stabilität. Diese war nötig, weil die beiden Wände des Kastens zur
Verstärkung des Bodens mit diesem elektrisch verschweisst wurden. Damit
die Wände nicht nach innen umfallen konnten, waren diese mit mehreren
Querwänden gegeneinander abgestützt worden. Von aussen sichtbar, war dabei
die Rückwand des Fahrzeuges.
Er
musste aber wegen den neuen Vorschriften der
UIC
für neu gebaute Fahrzeuge entsprechend einge-halten werden. Daher war der
Kasten ausge-sprochen kräftig aufgebaut worden, das obwohl die Seitenwände
wegen den zahlreichen Öffnungen geschwächt wurden.
Die beiden Seitenwände unterschieden sich nur unwesentlich
voneinander. Daher können wir uns auf die Betrachtung einer Seite
beschränken. Wenn wir hinter dem Führerstand
beginnen, haben wir auch gleich den einzigen Unterschied der beiden Wände
gefunden. So hatte dort die linke Seitenwand ein quadratisches
Lüftungsgitter
erhalten. In der rechten Wand befand sich in diesem Bereich schlicht nur
eine einfache Fläche.
Damit kommen wir zum Bereich mit dem
Gepäckabteil.
Wobei dieses eigentlich hinter der ersten Querwand begann. Die Länge für
das Gepäckabteil betrug 4 910 mm. Aussen war es jedoch durch die Tore zu
erkennen. Diese befanden sich in einer Nische, damit die Aussenhaut davon
nicht verletzt wurde. Wichtig war dies, weil möglichst viel Platz
geschaffen werden sollte und das
Lichtraumprofil
nach
UIC
505-2 eingehalten werden musste.
Wenn wir schon bei der von der
UIC
festgelegten Umgrenzung sind, werfen wir auch einen Blick auf die Breite
des Fahrzeuges. Diese betrug wegen der Länge des Kastens 2 860 mm. Einzig
die beiden
Griffstangen
überragten diesen Wert. Die Tore zum
Gepäckraum
hielten diese Umgrenzung wegen der erwähnten Nische, jedoch ein. Eine
Lösung, die auch als aussenglatte Ausführung bezeichnet wurde und die erst
später im Betrieb wichtig sein sollte.
Im geöffneten Zustand war eine lichte Weite von 1 400 mm
vorhanden. Das reichte aus, und die genormten Paletten schnell und einfach
zu ver-laden. Auf der Fahrt konnte bei geöffnetem Tor eine Vorlegestange
eingehängt werden. Der hintere Teil dieses Bereiches war mit einem grossen Lüftungsgitter abgeschlossen worden. Diese Gitter waren deutlich grösser als jenes, das vorher erwähnt wurde. Von den Abmessungen her entsprach es den nachfolgend vorgestellten Fenstern der Abteile.
Wegen der Grösse mussten zu Reduktion des Lärmes, waagerechte
Trenner eingebaut werden. In diesem Bereich flossen sicherlich die
Er-fahrungen mit der Baureihe Re
4/4 ein. Somit kommen wir zum ersten Abteil für Reisende. Dieses besass vier Fenster und eine Länge von 7 000 mm. Die hier eingebauten Fenster hatten eine Breite von 1 150 mm und eine Höhe von rund einem Meter.
Sie wurden fix im Rahmen eingebaut und konnten so nicht mehr, wie
bisher üblich geöffnet werden. Damit trotzdem etwas frische Luft in den
Innenraum gelangen konnte, waren im oberen Bereich Schiebe-bereiche
vorhanden.
Vielmehr war in diesem Bereich eigentlich nicht mehr vorhanden, so
dass wir direkt zu den
Einstiegstüren
wechseln können. Diese boten die erste Öffnung, die eigentlich unter den
Wagenboden reichten. Da es sich um die einzige Türe des Fahrzeuges
handelte, war deren lichte Breite mit 1 400 mm recht gross ausgefallen.
Speziell war, dass diese aussenglatt mit dem Kasten abschlossen, so dass
auch hier keine vorstehenden Teile vorhanden waren.
Nach der Türe kam das zweite Abteil des Triebwagens. Dieses hatte eine Länge von 5 250 mm erhalten und umfasste drei Abteile. Die Fenster in diesem Bereich waren identisch zum vorher beschriebenen Abteil aufgebaut worden.
Auch sonst gab es eigentlich zum vorher erwähnten Abteil keinen
Unterschied bei der Ausführung dieses Bereiches der Seitenwand. Das war
auch nicht zu erwarten, das beide Abteile die gleiche
Wagenklasse
besassen. Wenn wir kurz die Triebwagen mit zwei Führerständen erwähnen wollen, dann wäre in diesem Bereich das Abteil der ersten Wagenklasse eingebaut worden. Wegen dem dort vorhanden zweiten Führerstand wäre jedoch der Maschinenraum näher zur Türe gerückt.
Die Folge davon war, dass hier ein Abteil weniger vorhanden war.
Beim
Triebwagen
der BLS-Gruppe
waren dies jedoch nicht der Fall, so dass wir zum
Maschinenraum
kommen. Dieser Maschinenraum hatte lediglich eine Länge von 2400 mm erhalten. Es besass keine Lüftungsgitter, jedoch waren Wartungsstore vorhanden, die mit der Wand glatt abschlossen. Speziell in diesem Bereich waren jedoch die darunter montierten Kästen mit den Linientransparenten.
Diese boten in diesem Bereich die Möglichkeit an, dass das
Fahrziel des Zuges angeschrieben werden konnte. Eine Eigenart, die diesen
Triebwagen
zugeschrieben werden konnte. Damit haben wir das hintere Ende des Triebwagens erreicht. In diesem Bereich bildete die Querwand auch gleich den Abschluss. Die vorher erwähnten Abschnitte der Seitenwand bildeten die anderen Querwände.
So waren davon nicht weniger als sechs Stück vorhanden. Nehmen wir
die
Front
noch dazu, wäre es eine Querwand mehr gewesen. Die Seitenwände wurden
dadurch sehr gut gegeneinander abgestützt, was zur Festigkeit beitrug.
Gebildet wurde diese Rückwand durch den mittigen Durchgang und die
seitlich davon vorhandenen Wände. Hier wurde der
Triebwagen
so ausgeführt, wie das bei sämtlichen
Reisezugwagen
der damaligen Zeit der Fall war. Dazu gehörten die Schiebetüre das
Übergangsblech und der
Gummiwulst.
Hier konnte somit jeder gewöhnliche Wagen gekuppelt werden. Damit konnte
jedoch in diese Richtung nur mit einem
Steuerwagen
gefahren werden.
Es wird nun Zeit, dass wir uns zum anderen Ende des Fahrzeuges
begeben. Dort war der Bereich, der bei diesen
Triebwagen
als vorne zu bezeichnen war. Der Grund war simpel, denn hier wurde der
Führerstand
vorgesehen. Dieser werden wir uns nachher noch genauer ansehen. Zuerst
wollen wir jedoch festhalten, dass der Führerstand vollständig im Kasten
integriert wurde. Daher war dieser fest mit dem Boden und den Seitenwänden
verschweisst worden.
Der
Führerstand
bestand aus einer einfachen
Front.
Es wurde beim Bau darauf geachtet, dass ein ansprechendes Erscheinungsbild
bei einfacher Fertigung erreicht wurde. Das war insofern wichtig, dass die
Leute ein
Triebfahrzeug
in der Regel nach dieser Front beurteilen. Beispiel dafür waren damals bei
der BLS-Gruppe
sicherlich die
Lokomotiven
der Baureihen Ae 4/4,
Ae 8/8 und
Re 4/4. Aber auch Modelle der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB hätten hier aufgeführt werden können.
Daher entstand eine
Front,
die nur sehr leicht seitlich gepfeilt war. In horizontaler Richtung, war
das jedoch anders, so dass über den
Puffern
eine spitz zulaufende Kante entstand. Hier fand sich daher ein weiterer
Unterschied zum Modell, das später an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
geliefert wurde, denn dort gab es einen kurzen senkrechten Bereich.
Dadurch wirkte der
Triebwagen
der
Privatbahnen
etwas eleganter.
Auch bei den anderen Modellen mit Übergang versuchte man bei den
Herstellern diese Idee so gut es ging umzusetzen. Doch im Gegensatz zu den
Modellen mit einem
Führerstand
musste man dort bei den Fenstern andere Wege suchen. Hier konnten sehr einfache flache und daher billigere Frontfenster verwendet werden. So wurden zwei grosse flache Frontscheiben aus Sicherheitsglas eingebaut. Sie wurden lediglich durch eine schmale Mittelsäule getrennt.
Diese
Frontfenster
waren mit einer integrierten
Fensterheizung
versehen und konnten so auf optimaler Temperatur und damit Festigkeit
gehalten werden. Ein Umstand der sicherlich der Sicherheit des Personals
diente. Zur Reinigung der Frontscheiben waren oberhalb der Fenster pneumatisch b-etriebene Scheibenwischer montiert worden. Trotz dieser bewährten aber nicht immer genauen Technik, konnte man fixe Einstellungen für die Scheibenwischer erreichen.
Ein Vorteil, der jedoch nicht so gut wirkte, da auf den Einbau
einer
Scheiben-waschanlage
für die Scheiben verzichtet wurde. Das verwunderte sicherlich, da man
diese Anlagen bei den Eisenbahnen damals schon kannte.
Neu waren die über den
Frontfenstern
eingebauten Linientransparente. Diese konnten dank der zweigeteilten
Ausführung, mit Hilfe der darin montierten
Rollbandanzeige,
die einzelnen
Zugarten
und die Zielbahnhöfe anzeigen. Eine Lösung, die bisher nur seitlich
vorhanden war und nun erstmals bei schweizer
Normalspurbahnen
auch in der
Front
erfolgen sollten. Diese Anzeigen sollten danach bei allen neuen Fahrzeugen
des
Nahverkehrs
vorhanden sein.
Hinderlich waren hier die
Front
und die Forderung von einigen beteiligten Bahnen für einen eigenen
Einstieg für das
Lokomotivpersonal.
Jedoch konn-te so auch bei der BLS-Gruppe
eine Verbesserung erreicht werden. Um die schräge Front auszugleichen, waren auf beiden Seiten fest mon-tierte Fenster vorhanden. Diese waren jedoch nicht gut zu erkennen, da sie von den ebenfalls auf beiden Seiten vorhandenen Rückspiegeln bedeckt wurden.
Damit hätten wir nun die identischen Punkte der Seitenwände
erledigt. Es bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass die
Rückspiegel
bei Bedarf mit Hilfe von
Druckluft geöffnet werden konnten. In der links liegenden Wand des Führerstandes baute man nur ein gewohntes Fenster ein. Dieses war als Senkfenster ausgeführt worden und besass den in der Schweiz üblichen weissen Strich.
Die Folgerung dieser Tatsache war, dass bei der BLS-Gruppe
erstmals der
Führertisch
die Seite auf jene der Signale wechselte. Ein Umstand, der bei anderen
Bahnen schon längst erfolgte und wegen der gemeinsamen Lie-ferung auch
hier angewendet wurde.
Auf der rechten Seite des Fahrzeuges kam jedoch eine
Einstiegstüre
zum Einbau. Diese Türe mit Aufstieg, der über drei Trittstufen verfügte
und beidseitigen
Griffstangen
diente dem Lokführer als Zugang zum
Führer-stand.
Damit auch hier ohne öffnen der Türe Dokumente an das Personal im
Führerstand überreicht werden konnten, war in der Türe ein Senkfenster
eingebaut worden. Auch dieses besass den üblichen weissen Strich.
Damit haben wir mit Ausnahme des Daches den Kasten abgeschlossen.
Es bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass die bisher erwähnten
Baugruppen nicht erkannt werden konnten. Sowohl der Boden, als auch der
Führerstand
wurden mit der Seitenwand verschweisst. Das war eine Praxis, die bei
Triebwagen
schon immer so angewendet wurde und neu auch bei
Lokomotiven
in ähnlicher Weise gelöst wurde.
Das Dach besass nicht mehr die bekannten Rundungen, sondern wurde kantig und damit zum gesamten Konzept passend, ausgeführt. Das erleichterte die Fertigung und senkte so die Kosten für den Bau.
Im Gegensatz zu früher wurde hier das Dach jedoch nicht mehr in
die
Front
gezogen. Vielmehr wurde die Front ins Dach hineingezogen. Auch dieses Dach hatte keine ebenen Flächen erhalten. So konnte bei Regen das Dachwasser seitlich ablaufen. Dort wurde es in Dachrinnen aufgefangen und kontrolliert ins Schotterbett entlassen.
Dank diesen Dachrinnen war die Seitenwand länger sau-ber, was die
Reinigung des Fahrzeuges wesentlich verein-fachte. Dachrinnen waren schon
immer ein Zeichen für in der Schweiz gefertigte Fahrzeuge. Eine einfache
Lösung um saubere Fahrzeuge zu erhalten.
In den steilen Bereichen des Daches wurden mehrere
Lüftungsgitter
eingebaut. Diese befanden sich im Bereich des
Gepäckabteils,
bei der
Einstiegstüre
der Reisenden und beim hinteren
Maschinenraum.
Sie wurden, wie das seit einigen Jahren üblich war, als mit
Filtermatten
versehene
Düsenlüftungsgitter
ausgeführt. Man erreichte so mit wenig Aufwand, dass verhältnismässig
saubere Luft angezogen wurde. Damit verschmutzten die
Filter
nicht so schnell.
Auf dem Dach wurden Bauteile der elektrischen Ausrüstung montiert.
Damit diese im Unterhalt zugänglich waren, wurden auf dem Dach seitliche
Stege montiert. Da nun keine Rundung mehr vorhanden war, waren diese Stege
kaum zu erkennen, da sie nahezu flach auf dem Dach aufgebaut wurden. Die
Stege selber bestanden aus Stahlgitter, die einfacher aufzubauen waren.
Damit entsprach die Ausrüstung des Daches jenem von älteren Fahrzeugen.
Der kantig wirkende Kasten wurde daher auch auf dem Dach
umgesetzt. Bevor wir diesen auf das
Fahrwerk
stellen, greifen wir noch schnell zum Messband. So betrug die Höhe 3 750
mm. Wobei dies nur für den Kasten galt und die Bauteile der elektrischen
Ausrüstung darauf aufgesetzt wurden. Der höchste Punkt sollte jedoch der
Stromabnehmer
sein, doch diesen werden wir später noch genauer ansehen, denn nun wenden
wir uns dem Fahrwerk zu.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||

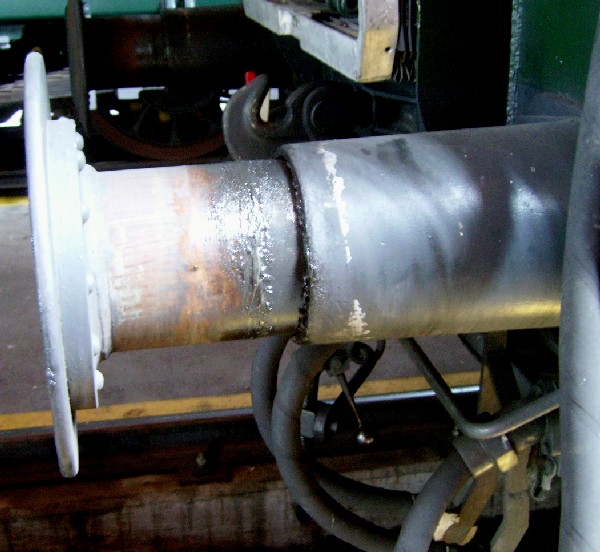 Der
Der
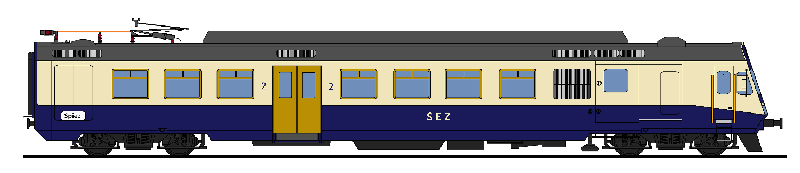 Es
war so dem Kasten möglich auf Höhe der
Es
war so dem Kasten möglich auf Höhe der
 Die
Tore, die ein quadratisches Fenster erhalten hatten, wurden gegen den
Die
Tore, die ein quadratisches Fenster erhalten hatten, wurden gegen den  Die
Türen wurden als Aussenschwingtüren ausgeführt. Sie öffneten sich zu
beiden Seiten hin und be-sassen je ein Fenster, das in der Höhe jenen der
Abteile entsprach. Die Türen wurden so aufgebaut, dass sie im unteren
Bereich dem Boden folgten und so wegen dem
Die
Türen wurden als Aussenschwingtüren ausgeführt. Sie öffneten sich zu
beiden Seiten hin und be-sassen je ein Fenster, das in der Höhe jenen der
Abteile entsprach. Die Türen wurden so aufgebaut, dass sie im unteren
Bereich dem Boden folgten und so wegen dem
 Die
Die
 Die
Seitenwände des
Die
Seitenwände des
 Abgedeckt
wurde der ganze Kasten mit einem aufge-setzten und mit den restlichen
Teilen verschweissten Dach.
Abgedeckt
wurde der ganze Kasten mit einem aufge-setzten und mit den restlichen
Teilen verschweissten Dach.