|
Entwicklung und Bestellung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Daher erarbeitete man bei der BLS-Gruppe
ein erstes
Pflichtenheft
für einen neuen
Pendelzug,
bestehend aus
Triebwagen,
Zwischenwagen und einem
Steuerwagen.
Diese Fahrzeuge sollten möglichst für alle Bahnen der Betriebsgruppe
einheitlich aufgebaut sein und sollten mit unterschiedlichen Längen
verkehren können. Daher auch das Konzept mit einzelnen Fahrzeugen nach dem
Muster der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Da die Finanzen der Privatbahnen und somit auch der Betriebsgruppe nicht immer gut waren, musste auch die BLS-Gruppe auf Bundesgelder aus Bern hoffen. Der Bund unterstützte die Privatbahnen, da diese zu einem kompletten Netz beitrugen. Nur so war es für viele Bahngesellschaften überhaupt möglich, die neuen Fahrzeuge bis zur Einführung des Taktfahrplans zu beschaffen. Ein wichtiger Punkt, sollte diese Idee funktionieren.
Obwohl die BLS-Gruppe
finanziell nicht schlecht dastand, reichten die Mittel nicht aus, um den
Mehrbedarf und den Ersatz zu beschaffen. Da zudem keine passenden
Fahrzeuge ausgeliefert wurden, musste man auch die Entwicklung bezahlen,
was die Fahrzeuge wegen der geringen Anzahl verteuerte. Ein Problem, das
Privatbahnen
schon immer kannten und welches die BLS-Gruppe bisher dank Eigenbauten
elegant umgehen konnte.
In diese Planung gesellte sich die Bodensee – Toggenburg – Bahn
mit ähnlichen Bedürfnissen. Damit konnten mehr Fahrzeuge angeschafft
werden. Das führte zu einer Reduktion der Kosten für jedes Fahrzeug, da
die Entwicklung auf mehrere Fahrzeuge verteilt werden konnte. Die beiden
Bahngesellschaften
gelangten daher mit dem Begehren nach Bundesgeldern an das eidgenössische
Amt für Verkehr EAV (Heute BAV). Der erste Schritt für neue Fahrzeuge war
somit getan.
Das Bundesamt setzte dabei jedoch gewisse Bedingungen fest, ohne
die es keine Gelder aus Bundesbern gab. Eine dieser Bedingungen, die das
Bundesamt verlangte, war, dass sich auch andere kleinere
Bahngesellschaften
dieser Fahrzeugbeschaffung anzuschliessen hatten. Damit war seit langem
wieder einmal von den Behörden in eine Bestellung direkt eingegriffen
worden. Der neue
Triebwagen
für die BLS-Gruppe
wurde so zum Privatbahntriebwagen.
Damit konnten auch die kleineren
Bahngesellschaften
von günstigen
Triebwagen
profitieren. Die Kosten für die Entwicklung der Baureihe wurden auf eine
noch grössere Anzahl Fahrzeuge verteilt, so dass letztlich auch die
Triebwagen für die BLS-Gruppe
günstiger wurden. Eine Situation von der alle beteiligten Stellen
profitierten, und die dem Bund halfen die Kosten für die Neuentwicklung zu
senken. Ein Punkt, der sehr wichtig war.
Sie wurden jedoch aus dem
RBe 4/4 der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB abgeleitet und nicht komplett neu
entwickelt. Die Aktion damals war jedoch sehr erfolgreich, wie wir anhand
eines Beispiels erkennen. Im Rahmen der damaligen Regelung, war es zum Beispiel einer Mittelthurgaubahn MThB möglich, die Strecke zu elektrifizieren und die dazu benötigten Fahrzeuge zu be-schaffen.
Andere Bahnen, wie die Wohlen-Meisterschwanden-Bahn WM stellten
sogar das
Stromsystem
auf
Wechselstrom
um, damit man diese günstigen
Triebwagen
verwenden konnte. Diesen Effekt wollte man nun auch erreichen, wobei keine
Betriebsumstellungen zu erwarten waren. Das Bundesamt rechnete mit einer erneuten Welle von Be-schaffungen. Die beiden bisher beteiligten Bahnen mussten daher auch andere Bahngesellschaften in die Planung einbe-ziehen.
Dies gelang, dank der Unterstützung aus Bern recht gut, so dass
letztlich fünf
Bahngesellschaften,
oder Betriebsgruppen von diesem Fahrzeug profitieren konnten. Gegenüber
von der ersten derartigen Aktion waren es jedoch wesentlich weniger, denn
damals waren zehn Bahnen beteiligt.
An der Ausarbeitung des
Pflichtenheftes
waren daher die Bahnen GFM und RVT neu dabei. Zusammen mit der BLS-Gruppe
und der BT waren es vier Bahnen. Die fünfte Bahn, die letztlich von diesen
Triebwagen
profitierte, war die EBT-Gruppe, die aber bei der Planung noch nicht dabei
war. Damals wusste jedoch niemand, dass deren
Pendelzüge
schliesslich als Reihe RABe 566 zur BLS AG kommen würden. Daher werden wir
auch diese genauer ansehen.
Es lohnt sich sicherlich, wenn wir einen etwas genaueren Blick in
das ausgearbeitete und letztlich genehmigte
Pflichtenheft
werfen. Dabei kommen auch die Anpassungen gegenüber der ersten Variante
zur Erwähnung. Wir können vorgreifend bereits davon ausgehen, dass
sämtliche
Bahngesellschaften
Abstriche machen mussten und so nicht das beste, aber das optimalste
Fahrzeug entstehen sollte. Doch wenden wir uns dem Pflichtenheft zu.
Der
Triebwagen
sollte auch als Alleinfahrer verwen-det werden können. Diese
grundsätzlichen Forder-ungen führten schliesslich zu einem
Fahrzeugkonzept, das in seinen Grundzügen zwar identisch sein sollte, aber
trotzdem einige Anpassungen an die Bedürfnisse ermöglichte.
Heute sind solche Konzepte von den Herstellern ausgearbeitet
worden.
Lokomotiven, oder auch
Triebzüge
entstammen heute einer
Plattform
mit Katalog. Dort können die individuellen Fahrzeuge aus einem Baukasten
mit mehreren genormten Teilen erstellt werden. Kastenform,
Antrieb
und Ausrüstung können nach Belieben kombiniert werden. Der Grundstein für
solche Konzepte wurde hier gelegt, auch wenn man davon noch weit entfernt
war.
Die
Leistung
der neuen
Triebwagen
wurde bei 1 600 kW oder 2 200 PS festgelegt. Diese sollte so in
Zugkraft
umgewandelt werden, dass auf Strecken mit einer Steigung von 27 ‰ eine
Anhängelast
von 200 Tonnen mitgeführt werden konnte. Diese Angaben orientierten sich
durchaus an den Triebwagen
RBe 4/4 der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Trotzdem wurden diese Angaben wegen dem
Alter des Musters neu definiert.
Die
Zugkraft
sollte beim vierachsigen Fahrzeug über alle
Achsen
auf die
Schienen
übertragen werden. Das war in Anbetracht der installierten
Leistung
sinnvoll, da diese so auch ausgenutzt werden konnte. Die
Achsfolge
wurde daher nach der einheimischen Lesart mit 4/4 angegeben. Wir haben
somit einen üblichen
Triebwagen
hoher Leistung erhalten, der sicherlich für einige
Privatbahnen
zu stark wurde.
Die
Höchstgeschwindigkeit
der
Triebwagen
wurde mit 125 km/h tiefer als erwartet angesetzt. Damit waren die meisten
Privatbahnen
sehr gut bedient, denn längst nicht alle Bahnen fuhren damals auch mit
solchen Geschwindigkeiten. Mit 125 km/h war auch klar, dass eine
Zulassung
zur
Zugreihe R
erwartet und auch gefordert wurde. Speziell war, dass die Konstruktion so
ausgelegt werden sollte, dass mit anderen
Getrieben
auch 140 km/h gefahren werden könnte.
as Fahrzeugkonzept sah zwei unterschiedliche Modelle vor, die aber
alle ungefähr 25 Meter lang sein sollten. Gerade damit wurden die
Interessen der an der Bestellung beteiligten
Privatbahnen
umgesetzt. Daher ist es sicher nicht falsch, wenn wir diese Konzepte kurz
betrachten, denn es entstanden so zwei unterschiedliche Modelle, die
später kaum über eine Ähnlichkeit verfügen sollten. Die Lösung war aber
nötig, weil sich hier die Bahnen nicht auf eine einheitliche Lösung
einigen konnten.
Die
Triebwagen
sollten beim Konzept eins, als Alleinfahrer mit zwei
Führerständen
konzipiert werden.
Personenübergänge
auf beiden Seiten sollten einen Durchgang auf allenfalls mitgeführte
Reisezugwagen
erlauben. Dieses Konzept wurde bei der BLS-Gruppe
seinerzeit bei den ABDe 4/8
mit den Nummern 751 bis 755 umgesetzt. Jetzt war es jedoch eine Forderung,
die von den zusätzlichen Bahnen GFM und RVT gestellt wurde.
Vom Konzept eins, das neben einem kleinen
Gepäckabteil
auch je ein Abteil in den beiden üblichen
Wagenklasse
erhalten sollte, wurde lediglich vier
Triebwagen
gebaut. Diese wurden als RABDe 4/4 bezeichnet. Geliefert wurden die
Fahrzeuge mit den Nummern 171 und 172 an die GFM. Die beiden anderen kamen
zum RVT und erhielten dort die Nummern 104 und 105. Mehr gab es nicht,
weil sich beide Bahnen auch dem Konzept zwei angeschlossen hatten.
Beim Konzept 2 wurde jedoch eine andere Lösung vorgesehen. Die
kleinste Einheit sollte aus
Triebwagen
mit
Steuerwagen
bestehen. Daher sollte auch der Triebwagen nur mit einem
Führerstand
ausgerüstet werden. Ein Durchgang wurde nicht mehr gefordert und so
konnten hier die Leute nicht zu Zusatzwagen zirkulieren. Das war aber
nicht so schlimm, da man diese Einheit mit einer beliebigen Zahl von
Zwischenwagen verlängern konnte.
Die
Konzepte der einzelnen Bahnen beschränken wir daher nur auf die hier
behandelten Züge. Nur, solche Punkte gehören natürlich auch in ein
Pflichtenheft
und müssen umschrieben werden. Damit wurde das Dokument aber
umfangreicher, als übliche Exemplare.
Das fertige
Pflichtenheft
wurde den Herstellern zur Begutachtung übergeben. Die Hersteller konnten
nun die einzelnen Modelle ausarbeiten und den Bahnen schliesslich ein
Konzept überreichen. Obwohl modulare Elemente gefordert wurden, bestimmten
immer noch die
Bahngesellschaften,
wie die Züge letztlich zu bauen waren. Die vorgefertigten Modelle von
heute, kannte man noch nicht und so konnten trotzdem individuell
gestaltete Fahrzeuge entstehen.
Die Bahnen entschieden sich letztlich für einen Entwurf, der von
einem
Konsortium
von drei Firmen eingereicht wurde. Die Schindler Waggon in Schlieren SWS,
als auch die Schweizerische Industriegesellschaft SIG in Neuhausen,
sollten sich für den mechanischen Teil verantwortlich zeigen. Ein
Verteilmodus regelte, wie die Arbeiten auf diese beiden Hersteller
verteilt würden. Dabei sollte die SIG die mechanischen Teile für die
Triebwagen
fabrizieren.
Die Zwischen- und
Steuerwagen
sollten bei SWS in Schlieren entstehen. So konnte man eine ausgeglichene
Auslastung dieser beiden beteiligten Firmen erreichen. Gerade beim
mechanischen Teil wurde immer mehr Zeit benötigt, als bei der elektrischen
Ausrüstung, wo viel Arbeiten vorgefertigt werden konnten. Der Grund dazu
war simpel, denn einen Wagenkasten musste man von Grund auf neu bauen und
verschweissen.
Der Elektriker für die Fahrzeuge war die Firma Brown Boveri und Co
BBC mit Sitz in Baden. Von den drei ursprünglichen Elektrikern blieb
mittlerweile nur noch die BBC übrig. So hatte man in den ehemaligen Werken
der MFO oder der SAAS genügend Kapazitäten um die
Triebwagen
schnell und einfach zu erbauen. Die Arbeiten eines Elektrikers bei Wagen
waren schon immer wesentlich geringer, so dass diese nicht zu gross
gewertet werden sollten.
Damit wäre die Erweiterung der Flotte fristgerecht erfolgt. Der
Taktfahrplan
konnte kommen. Doch bisher waren erst die Konzepte erstellt worden und die
Zeit wurde immer knapper. Bestellt war schlicht noch kein Fahrzeug. Die ersten Bestellungen sahen dabei sowohl eine Lieferung von Einzel-triebwagen für die RVT und die GFM, als auch die Lieferung von Triebzügen an die BLS und die BT vor.
Dabei bestellten diese vier
Bahngesellschaften
zusammen 20
Triebwagen
und diverse Zwischenwagen. Alleine die Hälfte der Einheiten war für die
BLS-Gruppe
bestimmt gewesen. GFM und RVT bestellten je zwei Exemplare in der
Bauart
als Alleinfahrer.
Letztlich blieben noch sechs leicht veränderte Einheiten der BT
übrig. Bei diesen sollte der Übergang zum
Steuerwagen
tiefer als sonst üblich angeordnet werden. So konnte ein etwas tieferer
Fussboden erreicht werden. Da nun aber keine freie Kombination mehr
möglich war, mutierten diese
Triebwagen
eigentlich zu
Triebzügen
mit der Bezeichnung RABDe 4/12. Es handelte sich jedoch immer noch um
Einzelfahrzeuge, wobei diese nie getrennt wurden.
Wir wollen uns ab jetzt nur noch mit den Trieb-, Zwischen- und
Steuerwagen
der BLS-Gruppe
befassen. Die Züge der anderen Bahnen hatten jedoch in vielen Bereichen
ähnliche Merkmale, wurden aber immer an den geplanten Einsatz angepasst.
Trotzdem bleiben wir bei den Fahrzeugen der BLS und sehen uns nun an, wie
diese Einheiten an die beteiligten Bahnen der BLS-Gruppe verteilt werden
sollten. |
|||||||||||
| Gesellschaft |
Triebwagen |
Zwischenwagen |
Steuerwagen |
||||||||
| BLS |
721
– 722 |
954 – 955 | |||||||||
| SEZ |
723
– 724 |
770
– 773 |
971 – 972 | ||||||||
| GBS | 725
– 729 |
780
– 783 |
982 – 986 | ||||||||
| BN |
730 |
790 | 992 | ||||||||
|
Der Erfolg mit diesen
Triebwagen
war so gross, dass weitere Einheiten bestellt werden sollten. Die BLS-Gruppe
wollte ihre Flotte erneuern und mit den Triebwagen konnte man wieder einen
einheitlichen Park von Fahrzeugen erreichen. Diesmal schloss sich die
EBT-Gruppe mit einer Bestellung an, so dass nun eine fünfte
Bahngesellschaft
mit solchen Zügen beliefert werden sollte. Die neuen
Pendelzüge
für die
Privatbahnen
schienen ihren Siegeszug zu beginnen.
Davon profitierten Bahnen, wie die SOB oder die MThB, die bei den
ersten EAV-Triebwagen
noch beteiligt gewesen waren, nun aber auf das Modell der
Staatsbahn
zurückgreifen konnten und so nicht zum hier beschriebenen Triebwagen
griffen. Letztlich sollten die fünf Bahngesellschaften insge-samt 49 Triebwagen dieser Baureihe beschaffen. In dieser zweiten Bestellung schlossen sich neben den beiden Betriebsgruppen auch wieder die GFM und die RVT an.
Wobei jetzt nur noch
Triebwagen
des Konzepts zwei beschafft wurden. Die Triebwagen des Kon-zeptes eins
wurden auch bei den Bahnen von den Fahrgästen in Frage gestellt, so dass
auch dort grössere Züge benötigt wurden.
Das Konzept zwei der BLS-Gruppe
hatte gesiegt. Es war so gut, dass selbst die
Staatsbahnen
bei der Entwicklung der
Triebwagen
RBDe 4/4
ähnliche Wege ging. Die Triebwagen wurden daher immer wieder verglichen,
was jedoch nicht leicht war, da es unterschiedliche Lösungen waren, die an
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst wurden. So wollte man damals bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch im
Regionalverkehr
140 km/h fahren.
Zum Vergleich soll hier erwähnt werden, dass sich die 34 ersten
EAV-Triebwagen
damals auf insgesamt zehn
Bahngesellschaften
aufgeteilt hatten. So gesehen, war nun die grössere Anzahl Triebwagen mit
weniger Bahnen erreicht worden, wobei sich hier natürlich die BLS-Gruppe
positiv auswirkte. Bei beiden vom EAV geforderten Beschaffungen war jedoch
die EBT-Gruppe dabei, die deswegen ihre neuen Triebwagen als RBDe 4/4 II
bezeichnen musste. |
|||||||||||
| Triebwagen |
Bahngesellschaft |
||||||||||
| 731 | Bern – Lötschberg – Simplon Bahn BLS | ||||||||||
| 732 – 733 |
Spiez – Erlenbach – Zweisimmen Bahn SEZ |
||||||||||
|
734 – 736 |
Gürbetal – Bern – Schwarzenburg Bahn GBS | ||||||||||
| 737 – 738 | Bern – Neuenburg Bahn BN | ||||||||||
| 739 |
Spiez – Erlenbach – Zweisimmen Bahn SEZ | ||||||||||
| 740 |
Gürbetal
– Bern – Schwarzenburg Bahn GBS |
||||||||||
| 741
– 742 |
Bern
– Neuenburg Bahn BN |
||||||||||
|
Das letzte Fahrzeug dieser Baureihe wurde im Jahre 1992 an die
BLS-Gruppe
ausgeliefert. Somit dauerte die Beschaffung dieser 22
Triebzüge
ganze zehn Jahre. Die Flotte der EBT-Gruppe konnte später zu diesen
Triebwagen
hinzugezählt werden, so dass wir letztlich von 35 Triebwagen der Baureihe
RBDe 4/4 sprechen können. Um korrekt zu bleiben, waren die Triebwagen der
EBT-Gruppe RBDe 4/4 II. Nur spielte das damals keine Rolle, denn es waren
die letzten Triebwagen, dieser
Bauart.
Die durch die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschafften neuen
Pendelzüge
RBDe 4/4
entstammten in ihren Grundzügen ebenfalls diesem Fahrzeugkonzept, das auch
die
Staatsbahnen
zu überzeugen vermochte. Einzig die
Front,
der
Antrieb
und die Innenausstattung wurden gegenüber den hier beschriebenen
Triebwagen
der
Privatbahnen
verändert. Die SBB-Züge haben zudem auch eine um 15 km/h höhere
Höchstgeschwindigkeit
erhalten.
Es bleibt eigentlich nur noch ein Hinweis und diesen betrifft die
Triebwagen
der BT. Wegen der speziellen
Kupplung
mutierten diese zu ersten
Triebzügen
für den
Regionalverkehr.
Damals konnte noch niemand erahnen, dass diese Triebzüge bereits bei der
nächsten Lieferung Triebwagen ablösen sollten. Damals fehlte schlicht der
Mut zu diesem Schritt, denn die RABDe 12/12 der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB zeigten, dass es auch so ging.
Bei den nachfolgend im Detail beschriebenen Fahrzeugen wird auf
die an die BLS-Gruppe
ausgelieferten Fahrzeuge Rücksicht genommen. Da jedoch mittlerweile auch
die Fahrzeuge der EBT-Gruppe im Bestand der BLS AG sind, werden die
Unterschiede dieser beiden
Triebwagen
natürlich in der Beschreibung eingebaut. Nicht näher eingegangen wird auf
die Veränderungen bei den Modellen, die an die anderen
Privatbahnen
geliefert wurden.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
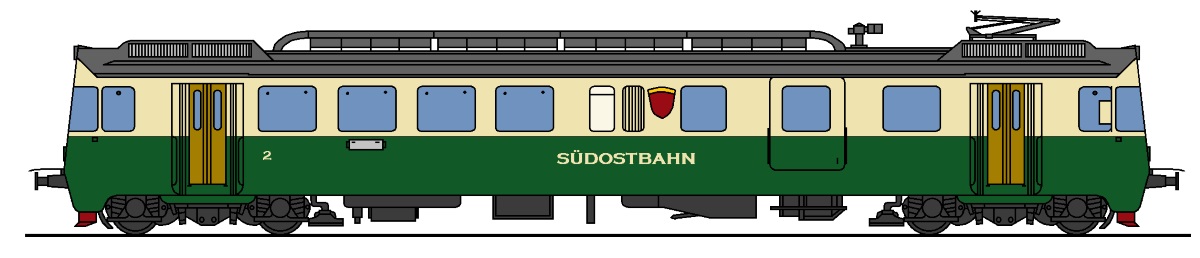

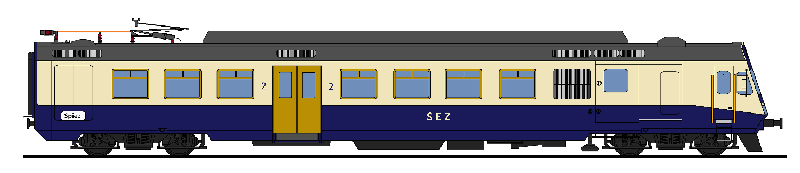 Das
Das

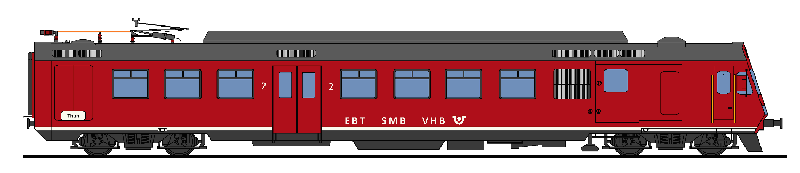 Die
weiteren Forderungen nach der Gestaltung der Innenräume wurden für jede
Gesellschaft separat definiert. Daher sollen diese Punkte hier nicht
weiter erwähnt werden.
Die
weiteren Forderungen nach der Gestaltung der Innenräume wurden für jede
Gesellschaft separat definiert. Daher sollen diese Punkte hier nicht
weiter erwähnt werden. Damit
war die BBC auch für die Endfertigung und die Inbetriebnahme der Züge
verantwortlich. Die Lieferfristen wurden so festgelegt, dass die neuen
Damit
war die BBC auch für die Endfertigung und die Inbetriebnahme der Züge
verantwortlich. Die Lieferfristen wurden so festgelegt, dass die neuen  Niemand
konnte damals ahnen, dass die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB ähnliche
Niemand
konnte damals ahnen, dass die Schwei-zerischen Bundesbahnen SBB ähnliche