|
Thermische Ausrüstung |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Wenn wir nun zur thermischen Ausrüstung kommen, dann behandelt man bei
einer
Diesellokomotive den Motor. Egal was für eine Lösung man beim
Antrieb wählte, der
Dieselmotor war das
Kraftwerk auf dem Fahrzeug und
daher wurde er auch gross gebaut und das konnte bei einer
Lokomotive immer
wieder Probleme geben. So musste ein Gewicht eingehalten werden und auch
der Einbauraum war beschränkt worden.
Davon mussten erst
noch zwei Exemplare eingebaut wer-den. Immerhin können wir bereits ohne
besseres Wissen vermerken, dass in einer
Lokomotive immer Motoren der
gleichen Hersteller eingebaut wurden und wir nur einen ansehen müssen.
Bei den Herstellern fanden sich die sehr bekannte Firma Daimler-Benz, die
schon bei Fahrzeugen der Strasse
Dieselmotoren baute. Das gleiche galt
auch für die bayrische Firma Maschinenbau Augsburg Nürnberg MAN, die sich
im Bereich der Nutzfahrzeuge einen Namen machen konnte. Es waren also zwei
Anbieter vorhanden, die über sehr grosse Erfahrungen im Bau von
Dieselmotoren verfügten. Wir können Sie jedoch ausblenden.
Da man aber sich auch beim Bau von Motoren
für Flugzeuge einen Namen machen, war die Wahl nicht falsch. Daher waren
auch von dieser Seite die passenden Motoren erhältlich und gerade Maybach
soll für uns wichtig werden, denn es waren solche Modelle verbaut worden. Zwischen den Herstellern der Dieselmotoren gab es durchaus Unterschiede, die hier nicht behandelt werden. Die später an die schweizerischen Bundesbahnen SBB übergebenen sieben Lokomotiven besassen ohne Ausnahme Motoren des Herstellers Maybach.
Daher werden wir uns diesen Motor
ansehen. Bei den Eckdaten waren die anderen Hersteller gleich. Nur beim
Aufbau gab es Unterschiede und daher sehen wir genauer hin. Die zwei Dieselmotoren einer Lokomotive arbeiteten immer auf ein Drehgestell. Bedingt durch die Dieselhydraulischen Antriebe, war das zu erwarten. Jedoch konnte auch die verlangte Leistung nur schwer mit einem einzigen Motor erzeugt werden.
Wenn sie verbaut wurden, dann kam
meistens ein elektrischer
Antrieb vor, der die
Leistung besser verteilen
konnte. All das ist hier nicht so wichtig, denn wir bleiben bei einem
Motor.
Um den mechanischen Unterschied zu den anderen Herstellern gleich zu
behandeln, muss erwähnt werden, dass die Firma Maybach eine
Kurbelwelle
aus Scheibenteilen und Lagerzapfen verwendete. Diese Lösung war ein
grosser Vorteil, denn die Teile konnten von unten im Gehäuse eingebaut
werden. Das erleichterte die Wartung, da bei einem Defekt an der
Kurbelwelle nicht gleich der komplette Motor zer-legt werden musste.
Der
Dieselmotor konnte alleine mit Luft und
Treibstoff betrieben wer-den.
Es war keine künstliche Zündquelle erforderlich. Die für die Ver-brennung
benötigte Luft wurde über die seitlichen
Lüftungsgitter angezogen. Damit
kein Schmutz in die
Zylinder gelangen konnte, waren diese mit
Filtermatten
versehen worden. Jedoch konnte diese gereinigte Luft nicht direkt dem
Motor zugeführt werden, denn sie wurde aufbereitet.
Die Firma Sulzer in Winterthur lieferte
diese an die Hersteller der Motoren. Der Grund war simpel, denn die
verfügbaren Modelle wurden dort entwickelt und daher waren kaum andere
Hersteller für diese Bauteile vorhanden. Die
Turbolader waren neu. Mit der nun vorhandenen Ladeluft haben wir erst einen Teil. Es muss noch erwähnt werden, dass diese nicht gekühlt wurde, denn beim Bau der Lokomotiven waren diese Ladeluftkühler noch nicht bekannt.
Sie kamen erst
wenige Jahre später und sie halfen, dass bei vergleichbarem Gewicht etwas
mehr
Leistung abgerufen werden konnte. Sie sehen, dass wir diese
Dieselmotoren noch nicht mit den heute üblichen Modellen vergleichen
können. Damit eine Verbrennung stattfinden kann, ist noch ein Treibstoff erforderlich. Dazu wurde bei den Lokomotiven Dieselöl verwendet. Wie bei Fahrzeugen üblich, war die Benutzung von Heizöl extraleicht nicht vorgesehen.
Der Grund waren die Behörden, denn auf
Treibstoffen wurde eine
Gebühr erhoben und diese mussten auch die Bahnen verrichten. Wobei in den
meisten Ländern diese mit einem geringeren Betrag belastet wurden. Mitgeführt wurde das Dieselöl in einem zwischen den beiden Drehgestellen ver-bauten Behälter. Dieser Tank musste wegen der Befüllung tief eingebaut werden. Es gab keinen Unterschied zu den Automobilen.
An einer als
Tanksäule bezeichneten Stelle wurde der
Treibstoff in den
Tank ge-füllt.
Eine Arbeit, die durchaus viel Zeit in Anspruch nehmen konnte, denn grosse
Motoren haben unweigerlich auch einen grossen Vorrat zur Folge. In den Lokomotiven der Serie V 200 waren nicht überall die gleichen Mengen erlaubt. Trotz der geringen Stückzahl gab es zwei Lösungen. Die Ursache dafür lag beim schon oft erwähnten Gewicht.
Wir werden später noch dazu
kommen. Es konnte ein Vorrat von 3000 oder 4000 Liter
Dieselöl mitgeführt
werden. Auch wenn in die Schweiz nur wenige Modelle kamen, es waren beide
Behälter vorhanden. Das war jedoch kein so grosses Problem. Mit einer einfachen Förderpumpe wurde der Treibstoff zum verbauten Einspritzgerät gefördert. Der Vorteil dieses Bauteils war, dass weniger Dieselöl gefördert werden musste, als das bei der Einspritzpumpe der Fall war. Das Gerät versorgte jedoch auch hier die einzelnen Einspritzventile in den Zylindern mit dem erforderlichen Dieselöl. Die Düse befand sich direkt im Verbrennungsraum. Daher war eine Direkteinspritzung verbaut worden.
Der Hub betrug 200 mm und die Bohrung
wurde mit 185 mm an-gegeben. Ein grosses Volumen, das viel Luft aufnehmen
konnte. Mit dem unteren Totpunkt schlossen die
Ventile wieder. Der nach oben eilende Kolben sorgte dafür, dass die gefangene Luft weiter verdichtet wurde. Dadurch stieg die Temperatur massiv an und der Treibstoff verbrannte in dem Moment, als er in den Verbrennungsraum gespritzt wurde.
Das
Dieselöl wurde daher ohne eine Zündquelle entfacht
und die damit verbundene Verbrennung erfolgte erst noch explosions-artig.
Jedoch musste das so sein, denn nur so konnte die Kraft erzeugt werden. Bedingt durch diese Explosion stieg der Druck im Verbrenn-ungsraum so stark an, dass der Kolben mit grosser Kraft nach unten gedrückt wurde. In der Folge wurde auch der Raum wieder grösser und der immense Druck flachte ab.
Die Verbrennung des
Dieselöls wurde Arbeitstakt genannt. Wer nun gezählt
hatte, erkannte, dass zuerst angesaugt wurde, dann wurde verdichtet und im
dritten Schritt erfolgte schliesslich die Verbrennung.
War der untere Totpunkt erreicht, öffneten die
Auslassventile und die
Abgase wurden ausgestossen. Der
Zylinder war damit wieder bereit frische
Luft aufzunehmen und danach zu verdichten. Wir haben damit einen ganz
normalen Viertaktmotor erhalten. Dabei regelte die
Nockenwelle die
Ventile
und auch die Einspritzung. Da bei einem so grossen Motor mehrere Zylinder
verbaut wurden, war auch die
Zündfolge in der Welle gespeichert worden.
Der
Dieselmotor hatte zwölf
Zylinder erhalten. Um die Baulänge der
Kurbelwelle und damit vom Motor zu verkürzen, waren diese in der V
Anordnung eingebaut worden. Dabei waren immer sechs Zylinder in einer
Reihe und es mussten zwei
Nockenwellen verbaut werden. Der Winkel der
beiden Reihen betrug 60°. Ein Wert, der bei solchen Motoren üblich ist und
der auch dafür sorgte, dass der grosse Motor in der
Lokomotive platz fand.
Danach gelangten
die
Abgase in den hier verbauten
Schalldämpfer und danach über die auf dem
Dach montierten Auslässe in die Umwelt. Eine weitere Aufbereitung, wie
etwa eine Reinigung oder gar eine
Kühlung gab es damals noch nicht. Da wir uns die Lokomotive im Zustand ansehen, wie sie in die Schweiz kam, muss erwähnt werden, dass bedingt durch die Abgase der Lärm als zu hoch eingestuft wurde. Daher musste der Schalldämpfer vor der Auslieferung verändert werden.
Die noch in Deutschland ausgeführten Arbeiten wurden
jedoch von einer externen Firma überprüft. Die spätere Am 4/4 war daher
leiser unterwegs, als das noch als V 200 der Fall gewesen war.
Ein Motor konnte im Bereich von 600 bis 1500 Umdrehungen in der Minute
betrieben werden. Für ein auf
Lokomotiven verbautes Modell war er daher
eher schnell laufend, denn üblich waren oft sehr geringe Drehzahlen. Mit
den höheren Drehzahlen war es jedoch möglich, dass die Drehzahlen schnell
angepasst werden konnten. Gerade bei den
Dieselhydraulischen
Antrieben war
das besonders wichtig, da die Drehzahlen direkter übertragen wurden.
Die dabei vom Motor maximal erzeugte
Leistung lag bei 809 kW. Wer die
Angaben in PS bevorzugt, kann mit dem Wert von 1 100 PS arbeiten. Zusammen
mit den zweiten Motor kommen wir auf die Angaben der
Lokomotive, die mit
1618 kW und 2 200 PS angegeben wurden. Wobei davon nicht alle Leistung den
Antrieben zur Verfügung stand, denn es musste noch ein Anteil für die
Schmierung und die
Kühlung abgezogen werden.
Dabei war die
Leistung nur
wichtig, wenn angesehen wur-de, wie schnell man war, wenn diese Kraft nicht
mehr zur Verfügung stand. Das waren Angaben, die wichtiger für die
Bestimmung der
Anhängelasten waren, als das bei der Leistung der Fall war.
Die
Lokomotive konnte eine
Anfahrzugkraft von 240 kN aufbringen. Damit
waren hier Werte vorhanden, die von vielen elektrischen Maschinen nicht
gehalten werden konnten. Wenn wir nun aber zur
Leistungsgrenze gehen, dann
zeigt sich ein anderes Bild, denn bei einem Wert von 25 km/h war noch eine
Dauerzugkraft von 149 kN vorhanden. Je schneller nun gefahren wurde, desto
geringer war die
Zugkraft und bei 140 km/h war kaum noch etwas vorhanden.
Auf flachen Abschnitten ist das durchaus
erreichbar. In Steigungen fiel dann das Tempo wieder in sich zusammen. Ein
Verhalten, das von den Dampflokomotiven her bekannt war und das nicht
geändert werden konnte. Die Bestimmung der Normallasten wurde auf diese Ge-schwindigkeit von 25 km/h festgelegt. In der Ebene durf-ten 1 700 Tonnen mitgegeben werden. Jedoch sank die Last bereits bei geringen Steigungen von bis zu 10 ‰ auf 800 Tonnen.
Auch wenn die
Lokomotive nicht unbedingt für
Steil-strecken geeignet war, haben wir noch den Wert für Neigungen von bis
zu 30 ‰. Die
Anhängelast betrug jetzt noch 350 Tonnen und das mit 25 km/h. So nackte Zahlen können verwirren. Wenn wir einen Vergleich anstellen müssen, dann kommen wir zu den Dampflokomotiven.
Ich
wählte hierzu die
Baureihe
C 5/6 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,
denn diese hatte bei einer vergleichbaren Geschwindigkeit nahezu die
gleiche
Anhängelast bekommen. Das war jedoch vor 40 Jahren der Fall.
Besser kann nicht gezeigt werden, wie schwer es mit
Dieselmotoren ist,
mehr
Leistung zu bekommen.
Wenn wir kleinere Teile, wie Werkzeug, aber auch die
Hilfsbetriebe noch hinzu nehmen, können wir die
Lokomotive auf die Waage
stellen. Die dabei erfassten Werte wurden immer mit den halbvollen
Vorräten bestimmt. Eine vollgetankte Maschine war daher schwerer. Jetzt
zeigten sich die unterschiedlichen
Treibstoffbehälter. Bei der kleineren
Version lag das Gewicht bei 73.5 Tonnen. Die grossen Modelle kamen jedoch
auf 81 Tonnen.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Hier müssen wir beim
Hier müssen wir beim
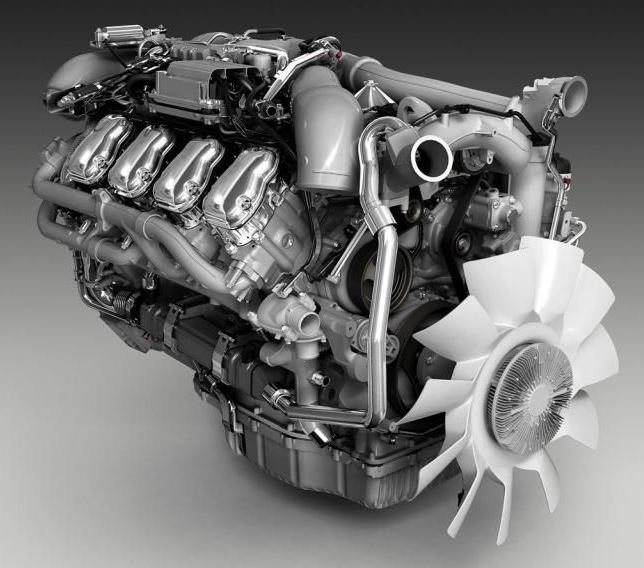


 Bevor wir uns den Leistungsdaten zuwenden, fol-gen wir noch dem Weg der
Bevor wir uns den Leistungsdaten zuwenden, fol-gen wir noch dem Weg der
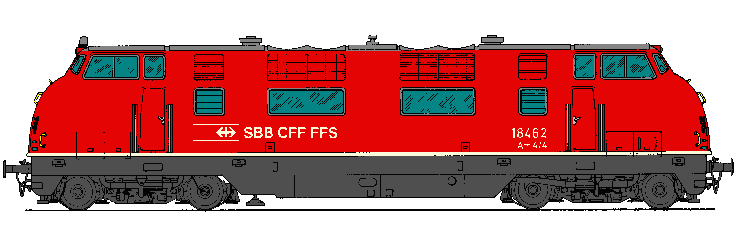 Auch wenn die
Auch wenn die
 Mit anderen Worten, die
Mit anderen Worten, die