|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bevor wir mit den eigentlichen Vorgängen
beginnen, muss erwähnt werden, dass es bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB seit einigen Jahren eine Bestrebung gab, die eine
erleichterte Schulung ermöglichte. Das hatte jedoch auch Auswirkung auf
die Bedienung, denn diese wurde vereinfacht. Gerade hier zeigte sich das
deutlich, denn auch bei der Bedienung wurden zwei
Lokomotiven
vereinigt und zwar die Reihen Ee
3/3 IV und Em 3/3. Beginnen wir auch hier die Bedienung mit
der Übernahme durch das Fahrpersonal. Dieses führte zuerst ein Rundgang um
die Maschine aus und suchte dabei nach Beschädigungen oder
Verschmutzungen, die ungewöhnlich waren. Nur wenn hier alle Kontrollen
erfolgreich waren, konnte die Maschine weiter in Betrieb genommen werden.
Dazu mussten jedoch zuerst die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
geöffnet werden.
Der Boden war mit wasserfest verklebten
Holzplatten belegt worden und die Decke verfügte über eine weisse
Abdeck-ung. Bleiben noch die Wände, welche ebenfalls in der hellgrünen
Farbe gehalten wurden. Es war keine Sitzgelegenheit vorhanden. Wie die anderen Rangierlokomotiven wurde auch diese Maschine stehend be-dient. Gerade im Rangierdienst mit dem steten Wechsel bei der Bedienseite, erachtete man eine solche Sitzgelegenheit eher als hinderlich. Man durfte den Einsatz auch nicht mit den
langen monoto-nen Fahrten der Strecke vergleichen, denn im
Rangierdienst
fanden nahezu pausenlos Handlungen statt. Die für die Bedienung wichtigen Anzeigen, Bedienelemente und Ventile waren auf, oder am Korpus angebracht worden. Dieser war wiederum von drei Seiten her zugänglich und sind an die vordere Stirnwand gestellt worden. Die Wand zwischen den Fenstern wurde für
Anzeigen und das
Funkgerät
benötigt. Daher konnte dort, wie man von aussen jedoch meinen könnte, auch
kein zusätzliches Fenster eingebaut werden. Um die
Lokomotive
in Betrieb nehmen zu können, gab es zwei Möglichkeiten. Diese führten
dazu, dass entweder der
Stromabnehmer
gehoben, oder der
Dieselmotor
gestartet wurde. Dabei war die Weisung an das Personal erlassen worden,
dass bei der Inbetriebnahme nach Möglichkeit immer zuerst die elektrische
Lösung zu wählen ist. Dieser werden wir folgen und daher zuerst den
elektrischen Teil der Maschine einschalten.
So konnte mit den bekannten Griffen der
Stromabnehmer
gehoben und der
Hauptschalter
eingeschaltet werden. Stand der Hebel für den
Kompressor
auf Automat, wurde sogleich damit begonnen die
Druckluft
zu ergänzen. Bevor die Fahrt begonnen werden durfte, musste die Funktion der Bremsen erprobt werden. Begonnen wurde dabei mit der Rangierbremse. Dabei musste der Bediener den Fahrschalter, der senkrecht nach oben stand mit der linken Hand nach hinten ziehen. Da die
Lokomotive
stand, wurde jetzt direkt die
Rangier-bremse
angelegt und der Druck im benachbarten
Brems-zylinder
konnte an einem
Manometer
abgelesen werden. Wichtig dabei war, dass die linke Hand benutzt wurde, denn je nach der Seite wo man sich vom Korpus befand, war dies effektiv eine andere Richtung. Daher galt auch bei dieser Lokomotive, dass sie für die Bedienung auf der rechten Seite ausgelegt wurde. So passte die neue Maschine ideal zu den
anderen
Ran-gierlokomotiven
und das Personal musste sich nicht an einer andere Bedienseite gewöhnen.
Ein Punkt, der die Schulung ebenfalls vereinfachte. Um die
Rangierbremse
wieder zu lösen, konnte der Hebel einfach wieder gehoben werden, bis er
senkrecht stand. Funktionierte die
Bremse
korrekt, durfte sich im
Bremszylinder
keine
Druckluft
mehr befinden. Diese konnte jedoch vorhanden sein, wenn der Lokführer aus
Versehen den roten Knopf im
Fahrschalter
drückte, denn dann blieb im Bremszylinder ein Druck von 0.8
bar
erhalten. Das war die angelegte
Schleuderbremse.
Sie haben richtig gelesen, hier wurde nicht
mehr das bisher übliche FV3b, sondern das leistungsfähigere Modell
verwendet. Besonders bei langen schweren Zügen, konnten die
Bremsventile
der Wagen dank dem
Hochdruckfüllstoss
schneller gefüllt werden, als das beim alten Modellen der Fall war. Bedient wurde das FV4a auf die gleiche Weise, wie das FV3b. Das heisst, dass der Griff gegen den Uhrzeiger verdreht werden musste, bis eine feine Raste bemerkt wurde. Damit wurde die Hauptleitung um 0.4 bar abgesenkt. Darauf reagierten das
Steuerventil
und die
Bremse
wurde angezogen. Ablesen konnte das Personal dies am
Manometer
zum
Bremszylinder.
Daher waren nun zwei Anzeigen vorhanden, die beachtet werden mussten. Mit dem Abschluss der Bremsprobe konnte die Sicherung der Loko-motive geändert werden. Mit dem Fahrschalter wurde dazu die Ran-gierbremse wieder angezogen. Anschliessend konnte die
Handbremse
gelöst werden. Soweit unter-schied sich dieser Schritt nicht von anderen
Baureihen. Stand die
Lokomotive
jedoch in geneigtem
Gleis,
musste allenfalls auch ein
Hemmschuh
entfernt werden. Wobei dieser bei der Aussenkontrolle erkannt wurde. Bevor jedoch mit der Maschine losgefahren
werden konnte, musste die
Beleuchtung
eingestellt werden. Das war bei
Rangierlokomotiven
nicht so schwer. Am Tag blieben die Lampen schlicht dunkel und bei
Dunkelheit, wurden diese einfach eingeschaltet. Die einzelnen Bilder waren
vorgegeben und wurden an der
Lokomotive
nicht verändert. Trotzdem musste sich das Personal damit befassen, denn
erst dann durfte der Griff zum
Wendeschalter
umgelegt werden.
Zudem musste die
Lokomotive
auch stehen, denn sonst konnte ein Wechsel der Fahrrichtung zu schweren
Schäden an den
Fahrmotoren
führen. Ein Punkt, der jedoch von den anderen so aufge-bauten Baureihen
stammte. Sofern nun eine Zustimmung des Weichenwärters vorhanden war, konnte die Fahrt begonnen werden. Dazu wurde der Fahrschalter angehoben und auf die andere Richtung aus der senkrechten Stellung bewegt. Die
Trennhüpfer
schlossen sich und die Maschine begann
Zugkraft
aufzubauen. Je mehr der
Fahr-schalter
abgelegt wurde, desto grösser war die erzeugte Kraft an den
Fahrmotoren.
Den Stromwert konnte man an einem
Instrument
kontrollieren. Damit das
Lokomotivpersonal
die gefahrene Geschwindigkeit erkennen konnte, war in beiden Fahrrichtung
ein
V-Messer
vorhanden. Dieser stammte aus dem Hause Hasler in Bern und dabei gab es
zwischen den Modellen einen Unterschied, denn nur eines der Geräte war mit
einer Aufzeichnung der Fahrdaten versehen worden. Das war, wie bei
Rangierlokomotiven
üblich, die Farbscheibe, welche eine Aufzeichnung des Restweges erlaubte.
Mit verbringen des
Fahrschalters
in die
Bremsstellung
wurde nun durch die Steuerung die
elektrische
Bremse aktiviert und so die Maschine verzögert. Reichte
deren
Bremskraft
nicht aus, aktivierte sich die
Rangierbremse.
Das Personal konnte sich so auf den
Haltepunkt
konzentrieren. Mit dem Griff zum Wendeschalter wurde die Fahrrichtung geändert und an-schliessend in der nun bekannten Art die Zugkraft aufgebaut. So waren schnelle Wechsel der Fahrrichtung kein Problem. Die Steuerung war, wie die
Lokomotive
für den Einsatz im
Rangierdienst
ideal aufgebaut worden. Ein Umstand, der den Betrieb förderte. Die
Be-dienelemene bekannter Baureihen erleichterte zudem die Bedienung und
da-mit auch die Schulung. Um an andere Fahrzeuge anzufahren, wurde die Geschwindigkeit reduziert und langsam gegen die Fahrzeuge bewegt. Sobald sich die Puffer berührten, wurde mit wenig Zugkraft der Druck gehalten. Jetzt musste die
Lokomotive
jedoch mit der
Schleuderbremse
gehalten wer-den. Dazu war im Kopf des
Fahrschalters
ein roter Knopf vorhanden. Wurde dieser gedrückt, wirkte die
Schleuderbremse mit dem vorgegebenen Druck. Anschliessend konnte die Zugkraft reduziert und die Rangierbremse angelegt werden. Da durch die Steuerung jedoch eine kurze Zeit keine Kräfte der Lokomotive vorhanden waren, wäre diese ohne die Schleuderbremse durch die Federn in den Puffern weggestossen worden. Erst wenn die
Rangierbremse
angelegt war, konnte der Knopf wieder los-gelassen werden. Die Maschine
war nun mit den anderen Fahrzeugen ver-bunden worden. Dieser Vorgang konnte zum Beispiel
erfolgen, weil eine
Gruppe
von Wagen über den
Ablaufberg
rollen sollte. Dieser Einsatz nannte man
Verschub
und dazu war die
Lokomotive
entsprechend ausgerüstet worden. Das galt auch für die Anzeige der
Geschwindigkeit. Diese wurde mit einem zusätzlichen Fein-V-Messer ergänzt.
Dieser erlaubte dank der feinen Aufteilung eine genaue Anzeige der
Geschwindigkeiten zwischen 0 und 9 km/h.
Diese sollte zwischen 6 und 9 km/h liegen
und nach Möglichkeit gleichbleibend erbracht werden. Mit der notwendigen
Erfahrung des Personals konnte so ein
Ablauf
durchgeführt werden, bei dem nicht angehalten werden musste. Jedoch war die Lokomotive dieser Baureihe nicht mit einem automatischen Verschub ausgerüstet worden. Dieser hätte er-möglicht, dass die Maschine während dem Ablauf durch den Rechner des Ablaufberges geregelt wurde. Diese Lösung hätte einen noch optimaleren
Betrieb ermöglicht. Jedoch wusste auch das
Lokomotivpersonal
mit der notwen-digen Erfahrung, wie die Geschwindigkeit auf einem
gleich-bleibenden Wert zu halten war. Musste nun ein Abschnitt ohne Fahrleitung, oder einer solcher mit falscher Spannung befahren werden, wurde kurz zuvor mit dem Dieselsteuerschalter auf dem Korpus der Dieselmotor ange-lassen. Durch die Steuerung war dieser bereits so
vorbereitet worden, dass er unverzüglich startete. Nachdem die
Zugkraft
abge-schaltet worden war, konnte der
Hauptschalter
ausgeschaltet und anschliessend der
Stromabnehmer
gesenkt werden. Wurde nun wieder
Zugkraft
verlangt, regelte die Steuerung den
Dieselmotor
so, dass die
Fahrmotoren
diese erzeugten. Abgesehen von den jetzt etwas geringeren
Geschwindigkeiten war für das
Lokomotivpersonal
kein Unterschied zu erkennen. Es war daher ein schneller Wechsel der
Betriebsart möglich und dazu musste nicht einmal angehalten werden. Es
reichte, wenn die
Lokomotive
während der Umschaltung rollte.
War wieder eine solche vorhanden, konnte
der
Stromabnehmer
gehoben und der
Hauptschalter
eingeschaltet werden. Die
Zug-kraft
wurde mit dem Wechsel der Betriebsart nun wieder elektrisch aufgebaut.
Auch jetzt ein einfacher Wechsel. Wie mit dem Dieselmotor verfahren wurde, war aus dem Betrieb bestimmt. Wurde in kurzer Folge wieder ein solcher Abschnitt befahren, war es möglich, den Motor laufen zu lassen. War es nur ein kurzer Ausflug, wurde der
Dieselmotor
mit dem Dieselsteuerschalter abgestellt und so die Belastung mit dem
Abgasen
eliminiert. Gerade diese sorgten dafür, dass die
Loko-motive
in erster Linie elektrisch betrieben wurde. Damit können wir den Dienst beenden und die
Lokomotive
abstellen. Erfolgte dies in einem
Gleis
der Aussenanlagen und wurden Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet,
musste der
Dieselmotor
vorgeheizt werden. Im Gegensatz zu den anderen mit solchen Motoren
ausgerüsteten Maschinen, wurde hier jedoch nicht die stationäre Anlage
genutzt. Vielmehr wurde die Maschine im elektrischen Modus abgestellt und
der Dieselmotor über den
Transformator
vorgeheizt. Wenn eine normale Remisierung möglich war,
erfolgte diese auf die gewohnte Weise mit ausschalten der
Lokomotive
und der
Sicherung
derselben. Anschliessend konnten die Hähne geschlossen und die
Aussenkontrolle abgeschlossen werden. Allfällige Schäden an der
Lokomotive, oder fehlendes Verbrauchsmaterial, wurden nun vom Fahrpersonal
mittels eines Reparaturauftrages gemeldet und die Arbeiten durch die
Werkstatt ausgeführt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Der
Zugang zum
Der
Zugang zum
 Auf
dem
Auf
dem  Geprüft
werden musste auch die
Geprüft
werden musste auch die
 Der
Griff zum Wendeschalter befand sich auf dem Korpus und er war bei beiden
Der
Griff zum Wendeschalter befand sich auf dem Korpus und er war bei beiden  Um
wieder zu verzögern wurde die
Um
wieder zu verzögern wurde die  Diese
Werte waren beim
Diese
Werte waren beim
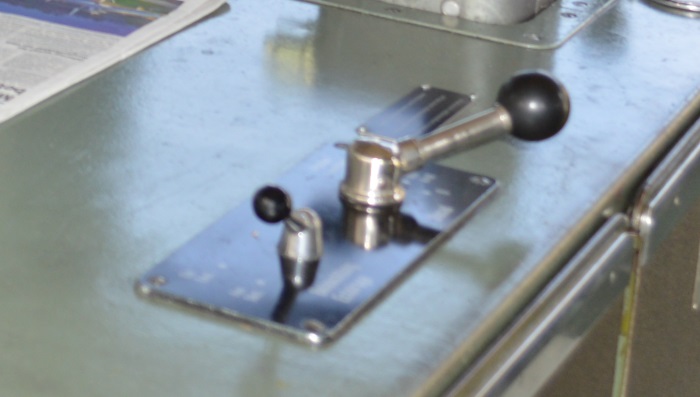 Dabei
galt auch, dass der
Dabei
galt auch, dass der