|
Entwicklung und Beschaffung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im Hinblick auf die um 1960 geplante
S-Bahn
Zürich wurde von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ein neues Fahrzeug
gesucht. Wie bei anderen Baureihen auch, sollte dazu ein
Pflichtenheft
erstellt werden. Auch wenn die Beschaffung dringlich war, die Ausarbeitung
wurde von den Fachkreisen mit bedacht vollzogen. Dabei verschlossen sich
die
Staatsbahnen
auch nicht komplett neuer Ansätze beim Bau von Fahrzeugen.
Die neuen
Triebzüge
für die
S-Bahn
mussten aber komplett neu entwickelt werden. Daher lohnt es sich, wenn wir
etwas genauer hinsehen, denn die Zeit, die am Anfang verloren ging, sollte
später auf-geholt werden.
Dieses neue
Triebfahrzeug
sollte zum Beispiel als dreiteilige Einheit formiert werden. Von der
Lösung mit
Pendelzügen
wurde damit trotz den grossen Erfolgen mit dem Kabel III, Abstand
genommen. Ein Vorgang, der sicherlich auf den Erfahrungen bei den
S-Bahnen
im Ausland basierte. Wir müssen bedenken, dass es damals in der Schweiz
schlicht noch kein System gab, das mit den S-Bahnen im Ausland
vergleichbar war.
Dort wurde mit solchen Einheiten gearbeitet und das durchaus sehr
erfolgreich. Trotzdem gaben die Schweizerischen Bundesbahnen SBB auch
Hinweise auf den geplanten Einsatz. Nötig war das, weil auch die
angeschriebenen Hersteller noch keine Erfahrungen mit
S-Bahnen
sammeln konnten. Mit der Angabe zur Strecke konnte aber der Charakter
aufgezeigt werden. Ein
Triebzug für Vororte ist nicht gleich, wie für das
Gebirge.
So sollten diese
Triebzüge
im Regelverkehr auf der Strecke Zürich – Meilen – Rapperswil und somit
an der Goldküste eingesetzt werden. Gerade dort war der Bedarf an
solchen Fahrzeugen sehr gross, denn die einspurige Strecke war sehr
gut ausgelastet. Auch ohne die
S-Bahn
konnte dort ein annähernd ähnlicher Betrieb erfolgen. Doch die
Staatsbahnen
wussten auch, dass es an Wochenenden zu grösseren
Stilllagern kommen konnte.
Zudem sollten die neuen Modelle am Wochenende auch mit Lokomotiven bespannte Züge auf dem restlichen Netz ersetzen.
Wobei die Fahrzeuge kaum eine grosse Verbreitung bekommen sollten, da
sie wegen dem regulären Einsatz im Raum Zürich eine Heimat finden
sollten. Auch wenn das Pflichtenheft letztlich recht umfang-reich war, auf die Angabe einer genauen Leistung des mit bis zu 125 km/h verkehrenden Triebzuges, wurde bewusst verzichtet. An deren Stelle trat eine Forderung nach bestimm-ten Werten bei der Beschleunigung und der Ver-zögerung.
Hier wurde daher ein Wert von 0.85 m/s2 verlangt. Das war
möglich, weil an den Fahrzeugen keine weiteren Wagen angehängt werden
sollten.
Ein Wert, der bei
Triebzügen
ebenfalls wichtig ist, war die maximal mögliche Steigung. Diese wurde
auf die Strecken im Zürcher Oberland abgestimmt und dort gab es
durchaus Neigungen, die mit den
Rampen
des Gotthards verglichen werden konnten. Daher erscheint es nicht so
speziell, dass gerade diese
Bergstrecke
als Massstab angenommen wurde. Mit anderen Worten, der Triebzug sollte
auch
starke Gefälle
befahren.
Um die
Adhäsion
auch bei schlechtem Zustand der
Schienen
optimal umzusetzen, sollten alle
Achsen
mit einem
Antrieb
versehen werden. So sollten geringere
Zugkräfte
pro
Radsatz
entstehen. Zudem sollten Abteile der beiden
Wagenklassen
und ein
Gepäckraum
eingebaut werden. Somit wurde die Bezeichnung als RABDe 12/12 geführt.
Womit auch klar war, dass die
Zugreihe R
für diese Modelle verlangt wurde.
Diese wurden aber mit der Forderung nach einer elek-trischen
Nutzstrombremse
wirksam verhindert. Mit der damals verfügbaren Technik war diese
Bremse
nur mit klassischen
Seriemotoren
möglich und man hatte auch dort grosse
Leistungen
umgesetzt. Ausgesprochen umfangreich waren die Hinweise zur Steuerung der Züge. Gerade in diesem Punkt wollten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit den Triebzügen neue Wege beschreiten. Ein wichtiger Punkt dabei war die Forderung nach einer automatischen Kupplung.
Diese sollte die
Vielfachsteuerung
von bis zu vier Einheiten erlaubten. Damit war auch klar, dass die bei
den letzten Modellen noch verlangte freie Kombination nicht
vorge-sehen war. Dass man sich bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB durchaus gewissenhaft vorbereitet hatte, zeigt die Tat-sache, dass auch Hinweise zu den pneumatischen Bremsen erwähnt wurden.
Dabei wurden die bei
automatischen Kupplungen
immer wieder entstehenden Schläge und
Stösse
erwähnt. Ein Hinweis, der nicht auf eigenen Erfahrungen basieren
konnte, denn bei den
Staatsbahnen
in der Schweiz gab es diese
Kupplungen
bisher gar nicht.
Um die
Stösse
auf den
automatischen Kupplungen
zu minimieren, sollte eine elektropneumatisch angesteuerte
Bremse
verbaut werden. Mit dieser
EP-Bremse
erhoffte man sich auch bei längeren Zügen eine ausgeglichene
Bremswirkung, da die Reaktionszeit deutlich geringer war, als bei der
automatischen Bremse.
Das waren durchaus durchdachte Ideen, die ebenfalls klar auf den
Erfahrungen von anderen Bahnen basierten.
Diese passte besser zur hektischen
S-Bahn.
Dazu sollten elektronische Bauteile angewendet werden. Deren
Programmierung erfolgte jedoch noch auf Basis der Hardware. Ein Teil der neuen Regelung war die Vorgabe, dass bestimmte Werte bei der Beschleunigung und bei der Verzögerung vom Fahrpersonal eingestellt wer-den konnten.
Auch das war auf den Einsatz einer
S-Bahn
ausge-legt worden und sollte das Personal bei schlechtem Zustand der
Schienen
entlasten. Gerade bei sich oft folgenden
Haltestellen
war das durchaus ein Vor-teil, den das
Lokomotivpersonal
zu nutzen wusste. Bleibt noch zu erwähnen, dass auch Bedingungen an das Aussehen gestellt wurden. Dazu wurde er-wähnt, dass die Merkmale der Einheitswagen für die Kasten galten. Bei der Front sollte sich diese an den Triebwagen RBe 4/4 orientieren.
Da auf den
Personenübergang
verzichtet wurde, konnten die entsprechenden Anpassungen vorge-nommen
werden. Jedoch war klar zu erkennen, auch die neuen
Triebzüge
mussten optisch in den Bestand passen.
Das
Pflichtenheft
wurde der einschlägigen Industrie übergeben. Diese sollten nach den
Angaben erste Muster ausarbeiten. Wobei hier eine intensive
Zusammenarbeit unerlässlich war. Wie das zu verstehen war, zeigt sich
nachher bei der Entwicklung dieser neuen
Triebzüge.
Der Entscheid sollte letztlich für ein Fahrzeug fallen, das von einem
Konsortium angeboten wurde und das die Bedingungen der
Staatsbahnen
optimal erfüllte.
Jedoch war damals das Werk der SLM mit dem Bau neuer
Lokomotiven
gut ausgelastet. Das galt auch für die Firma SWS, die eine grosse
Anzahl
Einheitswagen
an diverse Bahnen liefern konnte.
Zu diesen Zuliefern gesellte sich als Elektriker auch die Firma Brown
Boveri und Co BBC in Münchenstein. Hier lag das Problem gleich, wie
bei der SLM, denn es waren die Fachleute in Münchenstein, die mit der
Aufgabe einer
Lokomotive
mit hoher
Leistung
und
Zulassung
zur
Zugreihe R
beschäftigt waren. Wir erkennen deshalb ganz gut, dass die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB darum bemüht waren die Arbeiten zu
verteilen, das sollte die Lieferfristen verkürzen.
Zu den erwähnten Zuliefern gehörten weitere Firmen, die kleinere
Baugruppen an das Fahrzeug beisteuerten. Die Endmontage der neuen Züge
sollte in Meyrin bei der Firma Société Anonym des Ateliers de Sécheron
SAAS erfolgten. Die SAAS steuerte zudem den elektrischen Teil an das
Fahrzeug bei. Damit war klar, dass auch die MFO nicht beteiligt sein
sollte. Dort waren jedoch auch noch
Lokomotiven
im Bau, so dass das kein Problem war.
Vom diesem Angebot wurden von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB in
einer ersten Bestellung im Jahre 1963 vorerst 20 Exemplare geordert.
Auf die Entwicklung von
Prototypen
sollte zu Gunsten eines vorgezogenen Fahrzeuges verzichtet werden. So
erhielten die
Staatsbahnen
für die
S-Bahn
Zürich passsende
Triebzüge.
Da diese jedoch nicht beschlossen wurde, wurden diese Triebzüge
schnell zum «Goldküsten-Express».
Zumal sich auch die neue
Lokomotive
als Re 4/4 II erfolgreich
präsentieren konnte. Die
Triebzüge
RABDe 12/12 wurden zu Exoten in einem Bestand, der immer einheitlicher
werden sollte, denn alte Baureihen verschwanden.
Da die Lieferzeit kurz war, und weil nur ein Fahr-zeug der Serie
vorgezogen wurde, mussten im Vorfeld gewissen Schlüsselkomponenten
erprobt werden. Das war schon immer so, aber bei den hier
vorgestellten
Triebzügen
ging man auch jetzt einen Schritt weiter. So sollten während dem Bau
die
automatische Kupplung
und die neue
EP-Bremse
erprobt werden. Dazu sollten bestehende Fahrzeuge aus dem Bestand der
Staatsbahnen
verwendet werden.
Gebaut wurde die
automatische Kupplung
von der Firma Georg Fischer. Diese wurde mit Bauteilen für die
Vielfachsteuerung
ergänzt. Daher wurde der Typ als GF/S-Bahn bezeichnet. Wie bei allen
so gelagerten
Kupplungen
musste die Funktion in Bezug auf die Gleisanlage geprüft werden. Dabei
standen Punkte im Vordergrund, die bestimmte Stellungen bei den
Fahrzeugen ergaben. Somit mussten zwingend mehrere Fahrzeuge
umgerüstet werden.
Daher wurde der
Triebwagen
Be 4/6 mit der Nummer 1615
umgerüstet. Dazu gesellten sich die beiden Wagen B4ü 5527 und AB4ü
3741. Die so formierte
Komposition
verkehrte ab 1963 auf der Strecke Zürich – Turgi – Koblenz. Dabei
musste der Triebwagen in den
Endbahnhöfen
immer wieder umgesetzt werden, so dass die
automatische Kupplung
oft gelöst und verbunden wurden. Eine durchaus gute Betriebserprobung
für die
Kupplung.
Besonders die bei den Erbauern von
automatischen Kupp-lungen
gefürchteten engen S-Bogen stellten ein grosses Problem dar. Mit dem
Musterzug konnten so allenfalls noch Anpassungen an der
Kupplung
vorgenommen werden. Nach den Versuchen wurde der Zug jedoch wieder
normalisiert. Die dabei frei werdenden Kupplungen flossen die die Fertig-ung der hier vorgestellten Züge ein. So waren die gemach-ten finanziellen Aufwendungen nicht verloren. Natürlich wurden die automatischen Kupplungen revidiert und die bei den Versuchen gemachten Verbesserungen umgesetzt.
Ein kompletter Neubau konnte so aber verhindert werden. Ein Punkt, der
zeigt, dass bei den
Staatsbahnen
durchaus auf geringe Kosten geachtet wurde. Eine weitere Schlüsselkomponente war die neue elektro-pneumatische Bremse. Erste Erfahrungen mit diesen EP-Bremsen hatten die Staatsbahnen bei der Reihe Re 8/12 schon gemacht.
Jetzt sollte diese aber die normale
Hauptleitung
nutzen. Fachlich wurde in dem Fall von einer indirekten
EP-Bremse
gesprochen. Eine Lösung, die es erlauben sollte, den defekten
Triebzug
auch ohne diese
Bremse
mit einer normalen
Hilfslokomotive
abzuschleppen.
Bei der
EP-Bremse
lag der Fokus auf deren
Durchschlagsgeschwindigkeit.
Diese sollte deutlich höher sein, als das bei der normalen
Hauptleitung
der Fall war. Die
Druckluft
bewegte sich annähernd mit Schallgeschwindigkeit. Die elektrischen
Signale der EP-Bremse wurden jedoch nahezu mit Lichtgeschwindigkeit
übermittelt. Mit einem kurzen Zug wären die Unterschiede nicht zu
erkennen gewesen. Daher musste eine längere
Komposition
verwendet werden.
Mit den acht Wagen wurde der Zug rund 200 Meter lang. Damit konnten
die Unterschiede beim Absprechverhalten erkannt werden. Auch wenn es
sich nur um Sekunden handeln sollte, die Ergebnisse waren klar.
Es wurde zudem darauf geachtet, dass dieser
Pendelzug
in
Dienstplä-nen
blieb, die keine mit Zusatzwagen versehenen Züge enthielten. Technisch
hätten diese kein Problem ergeben, aber die Messungen wurden gestört.
Man wollte die Wirkung prüfen und nicht die mögliche Kombination mit
anderen Fahrzeugen. Die Verstärkungen am Schluss hätten dafür gesorgt,
dass die Vorteile schlicht verloren gingen. Daher der klare Einsatz.
Die Erprobung der
EP-Bremse
begann am 24. April 1964. Dabei sollte der
Pendelzug
die Erfahrung in der Praxis liefern. Im Hinblick, dass diese
Bremse
auch bei anderen Zügen angewendet werden könnte, waren diese Versuche
sinnvoll. Um auch Erfahrungen bei hohen Geschwindigkeiten zu machen,
wurde auch der
Triebzug
RABDe 8/16 mit dieser Bremse
versehen. Zwischen Münsingen und Wichtrach erfolgten dann Fahrten mit
bis zu 150 km/h. Auch der Pendelzug wurde nach den Versuchen wieder mit der normalen Bremse versehen. Die gemachten Erfahrungen konnten aber genutzt werden, so dass diese 20 Triebzüge zwischen dem 15. September 1965 und dem 10. November 1967 an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB übergeben wurden. Es wird Zeit, wenn wir uns die Triebzüge der Baureihe RABDe 12/12 genauer ansehen. Dabei beginnen wir auch hier mit dem Kasten. |
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
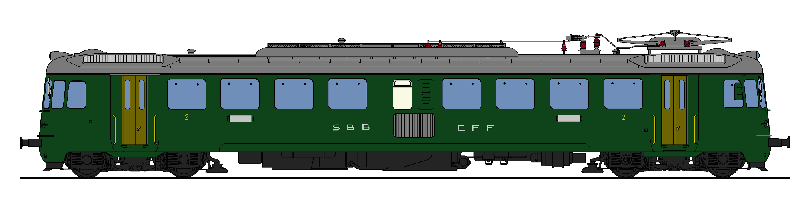 Wie
seriös gearbeitet wurde, zeigt nur schon die Tatsache, dass für die
Entwicklung der Baureihe
Wie
seriös gearbeitet wurde, zeigt nur schon die Tatsache, dass für die
Entwicklung der Baureihe  Daher
wurde im
Daher
wurde im  Gewisse
technische Errungenschaften beim Aufbau der Antriebstechnik wurden im
Gewisse
technische Errungenschaften beim Aufbau der Antriebstechnik wurden im 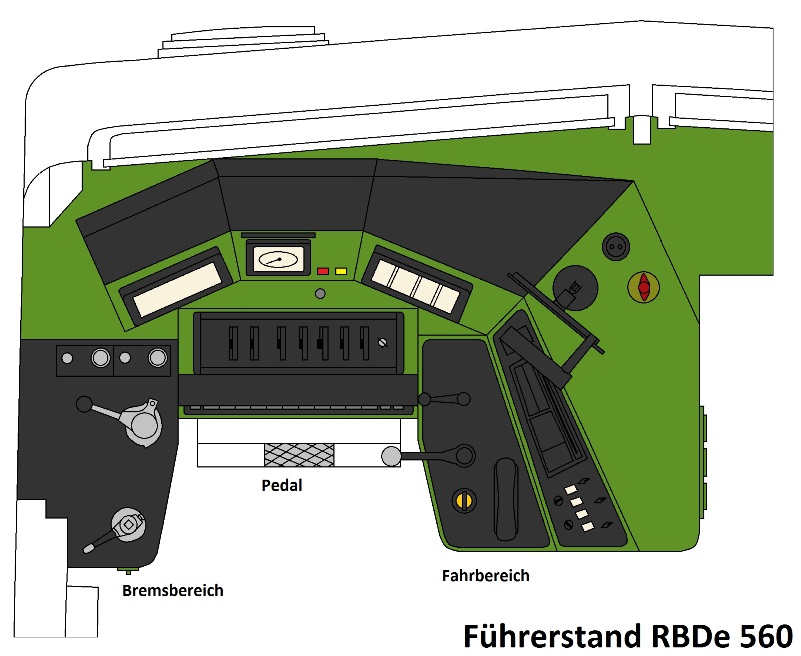 Auch
bei der Bedienung wollten die Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB neue
Wege gehen. Auf dem mit den
Auch
bei der Bedienung wollten die Schweizeri-schen Bundesbahnen SBB neue
Wege gehen. Auf dem mit den
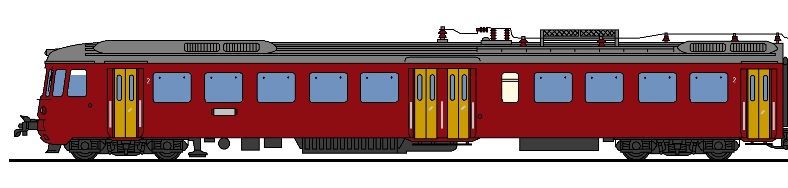 Die
Kasten wurden bei zwei Firmen gebaut. Das waren die Flug- und
Fahrzeugwerke Altenrhein FFA und die Schindler Waggon Pratteln SWP.
Letztere lieferte auch die
Die
Kasten wurden bei zwei Firmen gebaut. Das waren die Flug- und
Fahrzeugwerke Altenrhein FFA und die Schindler Waggon Pratteln SWP.
Letztere lieferte auch die
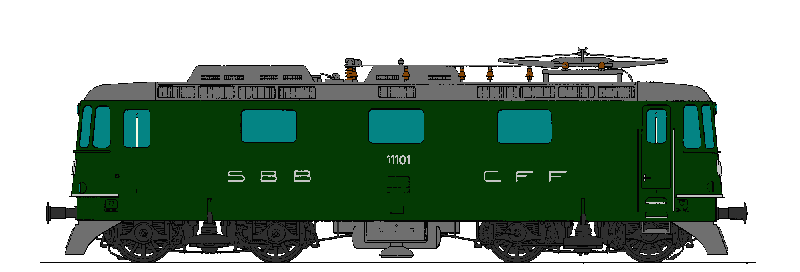 Die
Nummern für die
Die
Nummern für die  Wenn
der kurze Zug nicht für den regulären Verkehr genutzt wurde, erfolgten
andere Versuche. So mussten die
Wenn
der kurze Zug nicht für den regulären Verkehr genutzt wurde, erfolgten
andere Versuche. So mussten die 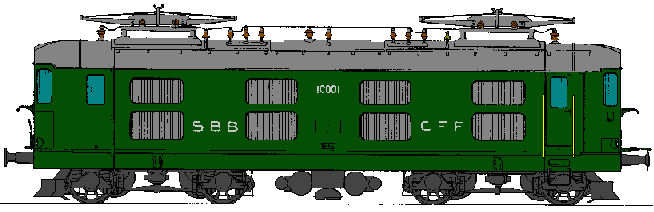 Als
Als