|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Kommen wir zu den Neben- und
Hilfsbetrieben. Dabei beginnen wir auch hier
zuerst mit den
Nebenbetrieben. Wie bei anderen Baureihen werden damit die
Verbraucher, die nicht mit der direkten Funktion des Fahrzeuges zu tun
hatten, bezeichnet. Ohne diesen Teil konnte der
Triebzug mehrere Tage
eingesetzt werden, jedoch auf Kosten des Komforts für die Fahrgäste. Das
galt hier nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr.
Diese führte eine Spannung von 1000 Volt und war damit so hoch, wie bei den Reisezug-wagen. Das war schon etwas speziell, denn bei Triebzügen suchte man oft andere Lös-ungen. Es konnte an der Anzapfung eine Leistung von 60 kVA bezogen werden. Das war jedoch eine nur für den halben Triebzug ausreichende Heizleistung.
Somit mussten immer beide
Transformatoren genutzt werden. Eine Umschaltung
war nicht möglich, da der ganze Zug die
Anzapfung schlicht überfordert
hätte. Trotzdem war diese Leitung besonders aufgebaut worden und wir
müssen etwas genauer auf diesen Teil sehen.
Im Gegensatz zu den
Lokomotiven wurde hier nicht mehr von der
Zugsheizung
gesprochen. Im
Triebzug wurde eine
Zugsammelschiene eingebaut und diese
stand in dem Moment unter
Spannung, wenn der Triebzug eingeschaltet wurde.
Trotzdem mussten auch in dieser Leitung Schaltelemente eingebaut werden.
Nötig waren diese aus zwei Gründen. So hätte ein
Kurzschluss auf der
Zugsammelschiene zum Ausfall des halben Zuges geführt.
War der
Triebzug ausgeschaltet und die Steuerung nicht aktiv, fielen diese
Schalter ab und die Leitung wurde unterbrochen. Jedoch wurde nun ein
weiterer
Heizhüpfer aktiv, der die beiden Hälften verband. Er öffnete,
wenn die beiden anderen
Hüpfer geschlossen waren. Nötig war dieser dritte
Heizhüpfer jedoch wegen einer besonderen Forderung im
Pflichtenheft der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB und wir müssen das ansehen.
An den beiden Enden des
Triebzuges endet diese je-doch in einer unter dem
rechten Hilfspuffer eingebau-te
Heizsteckdose. Ein Schaltelement war in der
Leit-ung zu dieser Steckdose jedoch nicht mehr vorhan-den. Diese Heizsteckdose war nur auf dieser Seite vorhan-den und sie entsprach sowohl bei der Position, als auch beim Aufbau den anderen Baureihen. So hätte zumindest in der Theorie ab dem Triebzug auch ein Wagen versorgt werden können.
Dies wurde aber durch die geringe nur auf den halben Zug
ausgelegte
Leistung verhindert. Jedoch konnte das
Pflichtenheft in diesem
Punkt ohne grosse Pro-bleme umgesetzt werden. Bedingung war, dass alle Triebzüge ausgeschaltet und remisiert waren. Danach konnte zwischen den Zügen mit einem Hilfsheizkabel die Verbindung hergestellt werden.
Wenn das erfolgt war, durfte die
Vorheizanlage
angeschlossen und die
Triebzüge vorgeheizt werden. Ein grosser Aufwand,
der auch auf andere Weise gelöst werden konnte. Zumal die ganze
Einrichtung zwingend entfernt sein musste, wenn die Fahrzeuge in Betrieb
genommen wurden.
Als Nutzer dieser
Nebenbetriebe gab es nur die
Heizung in den Abteilen.
Diese wurde nach den Grundsätzen der
Einheitswagen aufgebaut. So wurde mit
der
Spannung ein
Ventilator angetrieben. Der
Lüfter bezog die gefilterte
Luft aus dem Aussenbereich beschleunigte diese und drückte anschliessend
die Luft durch Kanäle. Die entlang der Wände verlaufenden Kanäle besass
seitliche Schlitze, so dass die Luft in den Innenraum gelangen konnte.
Speziell hier war, dass
dies das ganze Jahr erfolgte und nicht nur währ-end der Zeit wo geheizt
werden musste. Bei den
Einheitswagen fehlte dazu im Sommer nur die
Spannung. Wir haben damit eine Lüftung erhalten. Wurde nun durch den Thermostat in den Abteilen erkannt, dass es zu kühl werden könnte, schloss er und das Heizregister wurde von der Zugsammelschiene mit Energie versorgt.
Damit
erhitzten die in den Kanälen verbauten
Widerstände stark. Der nun vorbei
strömende Luftzug kühlte sie und nahm dabei deren Wärme auf. Das Abteil
wurde mit warmer Luft versorgt und so geheizt. Es war daher eine moderne Heizung vorhanden, die damals durchaus als Standard angesehen werden konnte. Klimaanlagen wurden im Nahver-kehr nicht eingesetzt und als diese Fahrzeuge gebaut wurden, nur selten vorhanden.
Sie waren so selten, dass sie bei den
TEE-Zügen explizit vorgeschrieben
wurden. Trotzdem war der
Triebzug im Winter angenehm warm und die
schrecklich stinkenden
Widerstände zu Beginn der Heizperiode waren
ver-schwunden.
Durch die ständig laufende
Lüftung wurde im Sommer aber auch so das
Fahrzeug gekühlt. Die Metalle wurden durch die Sonne erhitzt und gaben
diese Wärme an den Innenraum ab. Diese konnte von der dort vorhandenen
Isolation mit Spritzasbest etwas abgehalten werden. Bevor Sie wütend in
die Tasten greifen, damals wusste niemand, dass dieser Werkstoff
ausgesprochen gefährlich für die Gesundheit der Arbeiter war.
Aber gerade im Sommer gelangte immer noch viel Wärme in den Wagen. Durch die Lüftung konnte nun aber der Bereich etwas gekühlt werden.
Das Abteil wirkte für die Reisenden angenehm und das
unabhängig der Jahreszeit. Ein erster Schritt zu den
Klimaanlagen.
Trotzdem gab es Bauteile, die aktiv gekühlt werden mussten.
Für die
Kühlungen und andere nicht direkt mit der Traktion verbundene
Bauteile wurde eine andere Versorgung erwähnt. Auch wenn Sie nicht direkt
der Traktion dienten, es waren ausgesprochen wichtige Baugruppe. Deren
Ausfall führte dazu, dass der
Triebzug abgestellt werden musste. Dieser
Stromkreis wurde daher immer wieder als
Hilfsbetriebe bezeichnet. Diese
waren auch hier vorhanden und sie wurden geteilt.
In jedem
Transformator war für die
Hilfsbetriebe eine eigene
Wicklung
vorhanden. Diese war jedoch nicht galvanisch von der
Primärspule getrennt
worden. Vielmehr erlaubte diese zweite
Spule eine genaue Einstellung der
Spannung. Bei einem Abgriff direkt ab der
Primärwicklung hätte man eine
ungefähr passende Spannung erhalten. So aber konnte diese optimal
eingestellt werden, was die Funktion der Hilfsbetriebe verbesserte.
Die
Wicklung für die
Hilfsbetriebe ergab eine
Spannung von 220
Volt. Das
entsprach den damals üblichen Werten in der Landesversorgung. Abweichend
davon war jedoch mit 16 2/3
Hertz die
Frequenz. Bei einigen Baugruppen
ergab das aber kein Problem. Grösser waren die Schwierigkeiten bei der
verfügbaren
Leistung. Die erlaubten 36 kVA reichten nicht für den ganzen
Triebzug, daher mussten beide
Transformatoren genutzt werden.
So wurde die von der Spule abgegebene Spannung über eine Sicherung zu einem Schalter geführt. Dabei be-grenzte diese Schmelzsicherung den Strom in der Leit-ung.
Bei einem Defekt konnte sie durch das
Lokomotivper-sonal einmal
ersetzt und anschliessend in einer Werk-statt repariert werden. Der erwähnte Schalter war für den Depotstrom vorge-sehen. Wurde er umgestellt, erfolgte eine Trennung der Hilfsbetriebe von der Wicklung.
Dafür
wurden diese einer Steckdose zugeschaltet. Mit dem dort eingesteckten
Kabel konnten die Verbraucher versorgt werden. Wichtig und möglich war das
nur im Unterhalt. Daher waren diese Kabel in den Werkstätten und in den
Depots vorhanden. Von dort stammte auch der Name.
Ob nun vom Kabel, oder von der
Wicklung versorgt, nach dem
Depotumschalter
waren die Verbraucher eingebaut worden. Dabei betrachten wir den
Endwagen
mit der elektrischen Ausrüstung, denn diese musste gekühlt werden. Die
üblichen Verdächtigen waren der
Transformator und die
Fahrmotoren. Ich
beginne mit dem Transformator, denn dieser war für die
Hilfsbetriebe
schlicht nicht vorhanden. Uns stellt sich so die Frage nach dem warum?
Auch bei diesem
Transformator wurden die
Wicklungen in einem Gehäuse
eingebaut. Dieses wiederum füllte man mit einem speziellen
Öl. Es wurde
Transformatoröl verwendet, das die
Isolation verbesserte und gleichzeitig
die Wärme von den
Spulen abführte. Dabei nutzte man in diesem Fall
schlicht die thermischen Eigenschaften von unterschiedlich warmen
Flüssigkeiten. Das Öl wurde so auf natürliche Weise an das Gehäuse
verdrängt.
Trotzdem
waren sich die Erbauer nicht sicher, ob diese Lösung bei den häufigen
Beschleunigungen im Bereich einer
S-Bahn ausreichten. Zumal der
Transformator elektrisch auch belastet wurde, wenn mit der
elektrischen
Bremse gearbeitet wurde. Daher wurde der Transformator so aufgebaut, dass nachträglich auch eine künstliche Kühlung möglich war. Die Anschlüsse und der Platz für eine Ölpumpe und den in dem Fall benötigten Kühler waren vorhanden.
Jedoch
wurden bei der Herstellung diese Baugruppen nicht ein-gebaut. Wir werden
später bei den Umbauten erkennen, ob die
Kühlung des
Transformators
verbessert werden musste. Bei Aus-lieferung war aber eine natürliche Lösung
vorhanden. Nicht möglich war die Lösung des Transformator bei den Fahr-motoren. Diese waren im Drehgestell so kompakt eingebaut worden, dass eine Eigenventilation nicht optimal arbeiten konn-te.
Aus diesem Grund wurde bei
den Motoren auf eine von den
Hilfsbetrieben versorgte
Ventilation gesetzt.
Dazu müssen wir uns aber zuerst auf das Dach begeben, denn dort wurde die
Luft über die
Lüftungsgitter mit
Filtermatten vom
Ventilator angezogen.
Der
Ventilator beschleunigte die
Kühlluft und presste sie durch die Kanäle
und einen
Faltenbalg zu den
Fahrmotoren. Dort wurden die
Wicklungen
umströmt und dabei sowohl die Wärme, als auch allenfalls entstandener
Schmutz aufgenommen. Letztlich gelangte die warme Luft im Bereich der
Motoren wieder ins Freie. Eine künstliche
Ventilation, die jedoch bei
voller
Leistung recht laut war, weil die Luft nicht beruhigt wurde.
Wurde das Tempo jedoch
überschritten, erfolgte die Umschaltung auf den paral-lelen Betrieb. Erst
jetzt stand die volle
Leistung bei der
Kühlung zur Verfügung. Eine Lösung,
die durchaus bei anderen Baureihen auch so gelöst worden war. Es zeigte sich jedoch nach der Inbetriebsetzung der ersten Triebwagen, dass die Ventilation als zu laut empfunden wurde. Auch aus diesem Grund wurden die Züge vom Personal mit der Bezeichnung «Mirage» versehen.
Weil
der
Triebzug den gleichen Lärm machte, was das passend. Daher wurde später
die Geschwindigkeit für die Umschaltung auf 30 km/h eingestellt. Bei den
sich noch in Auslieferung befindlichen Triebzügen erfolgte das noch beim
Herstel-ler. Beim Endwagen kamen noch die kleinen Verbraucher im Führerstand dazu. Dieser wurde auf die gleiche Weise geheizt, wie bei den Lokomotiven. Auch alle anderen von dort bekannten Verbraucher waren vorhanden.
Dazu gehörte
auch die Anzeige der
Spannung in der
Fahrleitung. Daher war diese aus
Sicht der
Hilfsbetriebe nur vorhanden, wenn der Teil auch aktiv war. Warum
das nicht so war, werden wir später noch erfahren. Um den Endwagen abzuschliessen, muss noch erwähnt werden, dass hier auch das für die eingebauten Batterien erforderliche Ladegerät vorhanden war. Es wurde das statische Modell vom Typ WESTAT G 7434 verwendet.
Dieses gab
eine
Spannung von 36
Volt
Gleichstrom ab. Dabei war ein
Strom von bis zu
40
Ampère vorhanden. So reichte die
Leistung für die
Batterieladung aus
und wir können den
Endwagen somit abschliessen.
Der über eine weitere
Sicherung angeschlossene
Kompressor befand sich
unter dem Mittelwagen. Daher wechseln wir auf diesen und dort fanden sich
auch die vorher erwähnten
Ventilatoren für die
Fahrmotoren und ein
weiteres
Ladegerät für die
Batterien. Diese wurden vom
Endwagen eins
versorgt. Genau genommen fanden wir hier alle Verbraucher mit Ausnahme der
Bauteile im
Führerstand, diesen gab es hier jedoch nicht.
Ein
grosses Problem ergab sich damit jedoch nicht, denn die von den
Hilfsbetrieben bezogene
Leistung war nur zu einem geringen Teil für die
Erwärmung des
Transformator verantwortlich. Zumal effektiv nur der
Mittelwagen das Problem war.
Bevor wir jedoch die
Hilfsbetriebe beenden können, müssen wir noch schnell
zu den Störungen. Fiel der Teil eins wegen einer Störung komplett aus,
waren die Nutzer im Mittelwagen auch nicht mehr in Betrieb. Es war keine
Erzeugung von
Druckluft mehr vorhanden. Zudem fiel auch das dort
eingebaute
Batterieladegerät aus. Jedoch kam der
Triebzug aus Mangel an
Druckluft viel eher zum Stillstand, als wegen entladenen
Batterien.
Damit nun mit dem
Triebzug aber trotzdem die Fahrt fortgesetzt werden
konnte, konnte der Mittelwagen auf den Teil zwei umgestellt werden. So
stand die Erzeugung von
Druckluft, aber auch die in diesem Fahrzeug
verbaute
Batterieladung wieder zur Verfügung. Wie sich das auf die
Spannung in der
Batterien auswirkte, ist jedoch ein Teil der Steuerung.
Diese werden wir nun ansehen und damit die
Hilfsbetriebe des Zuges
beenden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
Die
 Das
Das
 Um den Überdruck im
Um den Überdruck im 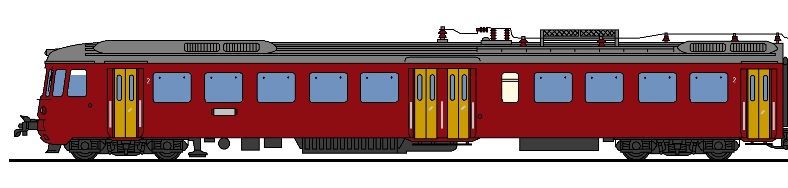 So konnte aber viel Wärme abgehalten werden. Im Winter blieb diese im
Innenraum, im Sommer draus-sen.
So konnte aber viel Wärme abgehalten werden. Im Winter blieb diese im
Innenraum, im Sommer draus-sen. Ich beschränke mit vorerst auf den
Ich beschränke mit vorerst auf den
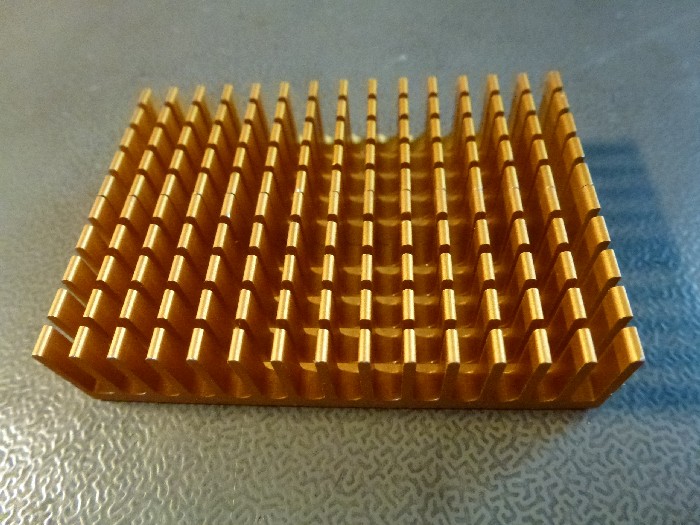 Die Metalle nahmen dann die Wärme auf und gaben diese an die Aussenluft
ab. Durch den Fahrtwind wurden die Bleche zusätz-lich gekühlt. Um diesen
Effekt zu verbessern waren zudem spe-zielle Kühlrippen vorhanden.
Die Metalle nahmen dann die Wärme auf und gaben diese an die Aussenluft
ab. Durch den Fahrtwind wurden die Bleche zusätz-lich gekühlt. Um diesen
Effekt zu verbessern waren zudem spe-zielle Kühlrippen vorhanden.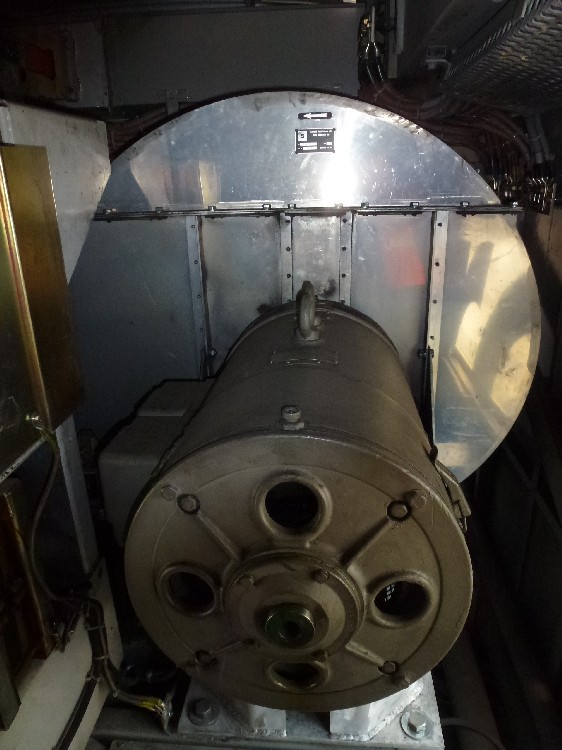 Aus diesem Grund wurden die
Aus diesem Grund wurden die
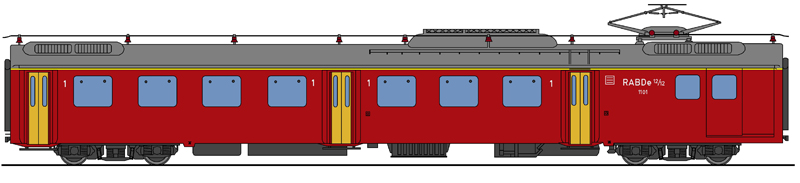 Eigentlich fehlt uns nur noch der
Eigentlich fehlt uns nur noch der