|
Der Pendelzug |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im Betrieb war kaum eine
Lokomotive Re 450 ohne
einen
Pendelzug zu sehen. Diese waren als feste
Kompositionen vorgesehen
und die sollten nur im Unterhalt getrennt werden. Gerade dort, konnte dank
den einzelnen Fahrzeugen auf die kurzen Anlagen gefahren werden. Die neuen
Pendelzüge, die jedoch als
Triebzüge verkehrten, benötigten daher keine
Ausbauten bei den
Unterhaltsanlagen. Kosten, die gerne gespart wurden.
Die
S-Bahn
in Zürich hatte somit einen rund 100 Meter langen Zug, der mit zwei
weiteren Einheiten auf die maximale Länge von 300 Metern vergrössert
werden konnte. Selbst die benötigten Reserve-wagen bildeten einen
kompletten
Pendelzug. Die Reihenfolge war auch einheitlich. Nach der Lo-komotive erfolgte ein Wagen in der zweiten Wa-genklasse. Im folgte das Modell, das Sitzplätze in beiden Wagenklassen anbieten konnte. Zum Schluss war da noch der Steuerwagen, der wiederum nur Abteile in der zweiten Wagenklasse enthalten hatte.
Die Anordnung sollte die Klassen nicht zu
stark ver-schieben, wenn einmal eine
Komposition anders ge-stellt eingereiht
wurde. Um nun den Pendelzug auch zu formieren, müssen wir uns die Wagen auch ansehen. Dabei werde ich nicht so ins Detail gehen, wie das bei der Loko-motive der Fall war.
Der Grund ist simpel, denn dieser
Artikel behandelt die Baureihe Re 450 und nicht den damit verbundenen
Pendelzug. Die Maschine konnte durchaus auch ohne diesen eingesetzt
werden. Ein Punkt, der bei den festen
Kompositionen nicht zu erwarten ist,
doch der Einsatz wird das bestätigen.
Die Wagen wurden nicht bei den gleichen Firmen
bestellt, wie die
Lokomotive. Hier waren
Wagenbauer gefragt und die hatten
keine leichte Aufgabe. Das widerspiegelte sich auch im Preis. Die Wagen
kosteten zwischen 1 677 000 und 2 113 000 Schweizer Franken. Für Wagen ein
durchwegs hoher Preis, der aber der speziellen Konstruktion geschuldet
war. Um Kosten zu senken, versuchte es der Hersteller jedoch mit einem
modularen Aufbau.
Beim selbsttragenden Kasten waren die Öffnungen für die Fenster,
die
Einstiegstüren und andere Funk-tionen vorhanden. Der so aufgebaute
Wagen hatte eine Länge von 26 800 mm erhalten und er konnte
Druckkräfte
bis zu 1500 kN aufnehmen.
Für den Hersteller war jedoch die grösste
Herausforderung der Aufbau von zwei Etagen. Auch wenn ein etwas grösseres
Lichtraumprofil erlaubt war, die Höhe konnte wegen der
Fahrleitung nicht
beliebig gewählt werden. Möglich war das nur, wenn im oberen Deck die
Reisenden durch die Einzüge des Kastens an Platz verloren. Anders hätten
die
Tunnel noch mehr erweitert werden müssen. Es war also ein Kompromiss,
der umgesetzt wurde.
Bei den beiden Zwischenwagen waren die üblichen
Personenübergänge vorhanden, die mit einem
Gummiwulst abgedeckt wurden.
Lediglich der
Steuerwagen hatte am hinteren Ende einen
Führerstand
erhalten. Dieser entsprach aber mit leichten Abweichungen bei der
Abmessung dem Modell auf der
Lokomotive. Weiter darauf eingehen werden wir
nicht, da dieser Bereich zuvor ausführlich vorgestellt worden ist.
Der komplette Zug hatte über die beiden
automatischen Kupplungen an den beiden Enden eine totale Länge von 98 800
mm erhalten. Damit lag der Zug, der wegen der
Schraubenkupplung zwischen
den Wagen straff gekuppelt werden konnte, etwas unter den Vorgaben des
Pflichtenheftes. Jedoch handelte es sich lediglich um 1200 mm, was nicht
so viel war, dass ein Ausgleich erfolgen musste. Gerechnet wurde mit 100
Meter.
Der Rahmen wurde aus Stahl erstellt und
er war, wie bei der
Lokomotive, gekröpft ausgeführt worden. In der
Draufsicht war mit Ausnahme eines
Drehgestells keine Kopfträger vorhanden.
Das betroffene
Drehgestell befand sich beim
Steuerwagen unter dem
Führerstand.
Hier musste ein Stirnträger montiert werden, damit die erforderlichen
Bauteile der
Zugsicherung
Integra-Signum
und von
ZUB 121 befestigt werden konnten. Diese Teile und der Führerstand
sorgten letztlich auch dafür, dass dieser Wagen zum schwersten im
Pendelzug wurde. Ein Punkt, der aber bei Steuerwagen so zu erwarten war
und den wir später noch ansehen.
In jedem
Drehgestell waren zwei
Achsen eingebaut
worden. Diese liefen in mit
Fett geschmierten
Rollenlagern und sie
besassen zwei
Monoblocräder. Das war bei den Wagen seit Jahren so üblich
und die Lösung zeigte, dass genug lange Laufleistungen zu erwarten waren.
Dabei hatte das neue
Rad lediglich einen Durchmesser von 920 mm erhalten.
Da schon die
Einheitswagen II solche Achsen hatten, konnte auf deren
Ersatzteile zurückgegriffen werden.
Der Abstand der beiden mit
Flexicoilfedern
abgefederten
Achsen betrug 2 500 mm und war daher eher gering, was den
Lauf in den
Kurven deutlich verbesserte. Somit wurde auch bei den Wagen
darauf geachtet, dass ein schonender Einsatz möglich wurde. Gerade bei den
schweren
Doppelstockwagen war das von grosser Bedeutung. Eine radiale
Einstellung, wie bei der
Lokomotive, gab es jedoch bei den Wagen nicht
mehr.
Muster dafür waren sicherlich die neuen Einheitswagen IV, die teilweise auch so gefedert wur-den.
Hier waren die
Federn aber we-gen der Höhe des Wagens von 4 600 mm
wichtig, denn sie konnten leicht eingestellt wer-den. Die Abbremsung der Wagen erfolgte mit zwei auf der Achs-welle montierten Bremsschei-ben. Diese Wellenbremsscheiben waren bei Reisezugwagen mitt-lerweile üblich und sie erzielten gute Werte bei der Bremsrech-nung.
Der komplette
Pendelzug er-reichte ein
Bremsverhältnis von
135% und war daher für die höchste
Bremsreihe zugelassen. Damals war das
wichtig, da nur so die
Höchstgeschwindigkeit auch ausgefahren werden
konnte.
Jedoch sollte der
Pendelzug im Notfall einen
deutlich kürzeren
Bremsweg erhalten. Daher wurde in jedem Wagen bei einem
Drehgestell eine
Magnetschienenbremse montiert. Diese entsprach den
üblichen Modellen. Der Vorteil dieser
Bremsen lag auch darin, dass sie von
der
Haftreibung unabhängig waren. Wenn deswegen die
Scheibenbremsen nicht
die volle
Bremskraft aufbringen konnte. Wirkten diese
Zusatzbremsen auf
den Bremsweg verkürzend.
Abweichend davon war nur der Bereich zwischen der Türe und dem
Führerstand, denn dort wurde auf das weisse Band verzichtet. Die rote
Front und das schmale Dach entsprachen, wie die
Laufwerke der
Lokomotive. Besonders auffällig waren die Einstiegstüren. Diese wurden über den Drehgestellen angeordnet und sie besassen einen gelben Anstrich. Zudem schlossen sie sich aussenglatt zur Wand ab. Das erlaubte es, dass diese Züge ohne Zugführer verkehren konnten.
Somit verkehrten bei
der
S-Bahn in Zürich die ersten kondukteurlosen Züge der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB. Eine Massnahme, die das Personal deutlich verringerte. Auch die Bahnanschriften waren vorhanden. Diese konnten jedoch wegen der unteren Fensterreihe nicht an der üblichen Stelle angebracht werden. Daher wurden sie nach oben in das weisse Band verschoben.
Auch hier wurde das Signet der
Staatsbahnen mit deren
Abkürzungen in drei Sprachen verwendet. Lediglich die Farbe war nun
schwarz, damit man die Anschrift auch erkennen konnte. Es waren daher
beide Varianten vorhanden. Bei den Wagen wurde die Druckluft ebenfalls benötigt. Sie übernahm dabei einige Funktionen und wurde auch für die Luftfedern benötigt. Entnommen wurde diese Luft aus der Speiseleitung, die durch den ganzen Zug geführt wurde.
Lediglich beim
Steuerwagen war sie
noch für die Versorgung der
Bremsventile benötigt worden. Der ganze Zug
bezog daher die
Druckluft von der
Lokomotive, deren System wir bereits
kennen.
Die pneumatischen
Bremsen der Wagen wurden durch die
EP-Bremse sicher gestellt. Jedoch war auch eine Abbremsung mit der
automatischen Bremse möglich. Deren
Hauptleitung war daher ebenfalls durch
den Zug geführt worden. Wichtig war diese Lösung, wenn die Wagen mit
anderen
Triebfahrzeugen in den Unterhalt überführt werden sollten. Der
Pendelzug arbeitete jedoch im Normalfall mit der direkten EP-Bremse.
Das war vor
allem bei der zweiten
Wagenklasse eine Verbes-serung gegenüber dem
Pflichtenheft, wo der Komfort der
Ein-heitswagen verlangt wurde. Das
Muster besass in der zweiten Wagenklasse noch Bezüge aus Kunstleder, das
im Sommer recht heiss werden konnte. In der ersten Wagenklasse unterschieden sich die Sitze nicht gross von jenen in der zweiten Klasse. Die engere Bestuhlung war von den Triebzügen RABDe 12/12 übernommen worden.
Für etwas mehr
Komfort waren die Kopfpolster mit weissen Tüchern versehen worden. Zudem
wurde der
Sitzteiler gegen-über der zweiten
Wagenklasse leicht erhöht.
Trotzdem lag der Komfort hinter den
Personenwagen des
Fernverkehrs zurück. Beim Komfort gab es Neonleuchten im ganzen Fahrzeug, die eine gute Ausleuchtung erlaubten. Das mittige Leuchtband war zudem so aufgebaut worden, dass die Reisenden vom Licht, das immer eingeschaltet war, nicht geblendet worden.
Trotzdem wirkten die Wagen eher kühl und
nicht für längere Fahrten geeignet. Jedoch ist eine
S-Bahn bekanntlich
kein
Fern-verkehr und daher waren die Wagen ideal.
Im Gegensatz zu den
Führerständen waren die Wagen
nicht mit
Klimaanlagen versehen worden. Für die Abkühlung im Sommer war
eine
Lüftung vorhanden, die so stark war, dass durch den Austausch der
Luft der Innenraum auf nahezu die Werte ausserhalb des Fahrzeuges gekühlt
werden konnte. Die Züge waren daher in den heissen Monaten im Sommer
deutlich angenehmer, als das bei den
Einheitswagen der Fall war.
Diese übernahm auch die
Lüftung,
so dass sie das ganze Jahr eingeschaltet war. Hier fand sich der Grund für
den neuen Namen für die bisher bei den Bahnen verwendete
Zugsheizung. Die Anzahl der Sitzplätze war in den Wagen unterschiedlich. Der nach der Lokomotive eingereihte Wagen der zweiten Wagenklasse besass insgesamt 136 Sitzplätze. Diese wurden mit vier Klappsitzen ergänzt.
Bei einer
S-Bahn waren aber auch die Stehplätze
wichtig, denn viele Reisenden mit kurzen Strecken standen sehr oft. Hier
konnten weitere 171 Personen in den Wagen steigen. Total fanden also 311
Personen einen Platz.
Der zweite Wagen hatte weniger Sitzplätze. Das war
eine Folge davon, dass hier die Plätze der ersten
Wagenklasse vorhanden
waren. In dieser waren 81 Sitze verfügbar. In der auch vorhanden zweiten
Wagenklasse waren es noch 38 Sitze. Damit total 119 Sitzplätze. Die Anzahl
Klappsitze wurde auf drei reduziert und auch bei den Stehplätzen war mit
169 Personen ein geringerer Wert vorhanden. Total fanden also 291
Reisenden im Wagen Platz.
Beim
Steuerwagen waren ebenfalls weniger Sitzplätze
vorhanden. Obwohl hier nur solche der zweiten
Wagenklasse vorhanden waren,
gab es nur 132 Sitzplätze. Die geringere Anzahl war dem
Führerstand
geschuldet. Bei den Klappsitzen waren wieder vier vorhanden und die Anzahl
der Stehplätze wurden wegen dem Gewicht des Fahrzeuges auf 161 verringert.
So konnten im Steuerwagen weitere 297 Personen mitreisen.
Auch bei der
Lokomotive war der Bediener nicht in der
Kalkulation enthalten. Trotzdem war für einen 100 Meter langen Zug eine
sehr grosse Anzahl vor-handen, die dem bei der
S-Bahn in Zürich erwar-teten
Verkehr entsprach. Die Wagen des Pendelzuges hatten mit Gewichten zwischen 65.4 und 67.3 Tonnen ein ansehnliches Gewicht erhalten. Das war aber eine Folge davon, dass es sich hier um Doppelstockwagen handelte.
Diese mussten kräftiger gebaut werden und boten auch mehr Platz für die
Reisenden. Wegen den zu-gelassenen
Achslasten mussten unter jedem Wagen
zwei
Drehgestelle eingebaut werden. Vollbesetzt konnten durchaus über 70
Tonnen vorhanden sein. Der komplette Wagenzug erhielt ein Gewicht von 199.5 Tonnen. Für die Lokomotive war das eine sehr geringere Last, denn diese hätte auch schwe-rere Züge führen können.
Jedoch war bei einer
S-Bahn auf
die Beschleunigung ein sehr wichtiger Punkt und daher wurde der grösste
Teil der verfügbaren
Zugkraft dafür aufgewendet. Der
Pendelzug war daher
ideal für den Einsatz ausgelegt worden. Bleibt noch, dass auch die Wagen
nur 130 km/h schnell fahren durften.
Damit haben wir nun den ganzen
Pendelzug behandelt.
In der Folge werden wir von diesem sprechen. Wobei sich im Einsatz zeigen
wird, dass es auch zu Abweichungen kommen konnte. Die Züge, die im Betrieb
jedoch als
Triebzüge behandelt wurden, bildeten auch deshalb lange Zeit
das Rückgrat der
S-Bahn in Zürich. Zumindest so lange, bis die Industrie
in der Lage war, auch doppelstöckige Triebzüge zu bauen. 1986 ging das
noch nicht.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Jeder
Jeder
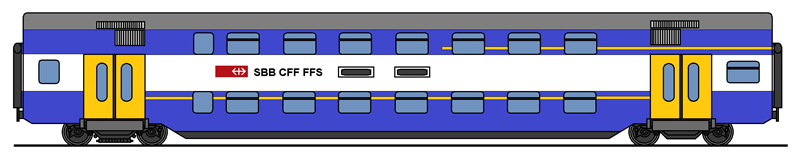 Der modulare Aufbau der Wagen zeigte sich bei deren
Abmessungen und beim Aufbau. Auch für den Bau der Wagen wurden Stahlbleche
verwendet, die mit Hilfe der elektrischen
Der modulare Aufbau der Wagen zeigte sich bei deren
Abmessungen und beim Aufbau. Auch für den Bau der Wagen wurden Stahlbleche
verwendet, die mit Hilfe der elektrischen
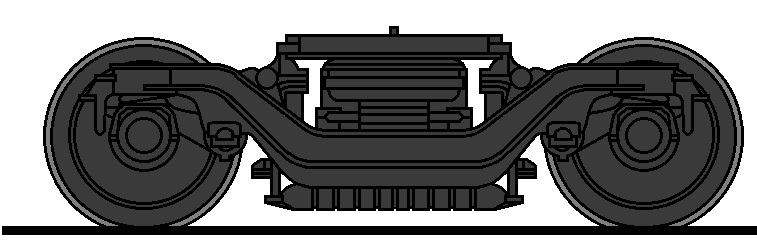 Jeder Wagen wurde auf zwei
Jeder Wagen wurde auf zwei
 Gegenüber dem Kasten war das
Gegenüber dem Kasten war das

 Im Innenraum dominierten die Farbe Gelb für die
Wände bei den Einstiegen und bei den Treppen, sonst wurde weiss verwendet.
Die Sitze waren mit einem blauen Stoffbezug versehen worden.
Im Innenraum dominierten die Farbe Gelb für die
Wände bei den Einstiegen und bei den Treppen, sonst wurde weiss verwendet.
Die Sitze waren mit einem blauen Stoffbezug versehen worden. Die
Die