|
Personal auf den Schleudern |
|||
| Navigation durch das Thema |
|
||
|
Nachdem wir bisher mehrheitlich die Maschinen betrachten hatten, kommen
wir nun zur Besatzung. Einsätze mit Schneeschleudern benötigen mehr
Personal, als ein normaler Zug. Zudem sind solche Fahrten spektakulär und
immer wieder eine reizvolle Aufgabe für die Bosse der
Depots.
So tummelten sich schnell mehr Leute auf einer Schneeschleuder, als
eigentlich dafür vorgesehen waren. Dabei begann alles noch recht
überschaubar.
Noch
geht es um Personal, das benötigt wurde. Dabei wurde dieses durchaus aus
den Reihen des Personals genommen, denn eigentlich war die Arbeit eines
Chefs ja im Büro und nicht auf ein-er lärmigen Schneeschleuder. Die Aufgaben waren klar zugewiesen worden und jeder wusste, was er zu tun hatte. Man be-nötigte deshalb sicher einen Mitarbeiter, der die Schleuder bediente. Dieser stammte aus dem Depot.
Das
war meistens ein Handwerker, der speziell für diese Einsätze geschult
worden war. Kennt-nisse über das Fahrzeug waren natürlich ele-mentar
wichtig und so wurden diese Leute auch in der Bedienung zum Fahren
ausgebildet.
Hinzu kam noch eine Person, die sich auf der Strecke auskannte und die
wusste, wo sich die Hindernisse befanden. Die ideale Person dafür war der
Bahnmeister, aber auch der
Streckenwärter
des betreffenden Abschnittes. Eine kleine Besatzung, die eigentlich nur
noch mit einem Lokführer ergänzt werden musste, weil nur dieser in den
fahrdienstlichen Belangen geschult war und der auch spezielle
Betriebsformen beherrschte.
Gerade beim Lokführer war die Regelung eigentlich so, dass er sich auf dem
Fahrzeug befand, das den Fahrantrieb besass. Dort wurde letztlich
entschieden, ob gefahren wird oder nicht. Daher befand er sich bei den
geschobenen Modellen auf der
Lokomotive und nicht wie erwartet auf
der Schneeschleuder. Eine Besonderheit, die durchaus gewählt wurde, weil
man das Personal reduzieren wollte und das seit der ersten Schleuder.
Rotary:
Die Rotary kam wirklich mit
wenig Personal aus. Auf dem Fahrzeug selber waren somit wirklich nur der
Bahnmeister und der Maschinist zu finden. Am hinteren Ende der
Schneeschleuder sorgte ein weiterer Mann für ausreichend Dampf. Das war,
wie bei den Dampflokomotiven ein
Heizer.
Nur sie wussten, wie der
Kessel
optimal zu betreiben war. Vorne war man mit dem Schnee und nicht mit der
Erzeugung des Dampfes beschäftigt.
Die
Aufgaben waren dabei klar geregelt und Bosse verirrten sich kaum auf diese
heisse und schmutzige Schleuder. Auch der Lokführer verirrte sich nicht
auf das Fahrzeug, denn es war ja keine
Lokomotive, sondern nur ein Wagen der
von einer solchen geschoben wurde. Damit können wir noch einen Lokführer
und einen weiteren
Heizer
auf der Dampflokomotive dazu zählen. Damit sind wir bei einem Bestand von
fünf Mann.
Diese Schublokomotive war wohl hinter der Schleuder positioniert, hatte
jedoch auch die fahrdienstlichen Obliegenheiten zu bereinigen. Das heisst,
ein Befehl, der die Fahrt auf der Strecke zuliess, richtete sich stets an
den Lokführer und damit an die Schublokomotive. Weigerte sich dieser zu
fahren, blieb die Schleuder stehen, denn einen eigenen
Antrieb
hatte sie ja nicht. Jedoch war damit sicherlich für genügend
Gesprächsstoff gesorgt.
Das war auch der Fall, als
die
Fahrleitung
eingeführt wurde und die Schleuder zusätzlich mit einer elektrischen
Lokomotive ergänzt wurde. Sie sehen, dass die Lokomotiven durchaus besetzt
waren. Daran änderte sich erst etwas, als die Dampflokomotive durch eine Diesel-lokomotive ersetzt wurde. Die Schublokomotive hatte somit nur noch einen Lokführer, der die fahrdienstlichen Aufgaben immer noch übernom-men hat.
Das heisst, auch
jetzt war die Ansprechperson für die
Fahrdienstleiter der Lokführer der
Schublokomotive. Er erhielt die Aufgaben und musste diese dem Personal auf
der tobenden Schleuder mitteilen. Hinzu kamen dann noch eine grosse Anzahl Mitarbeiter, die um die Schneeschleuder herum am Arbeiten waren. Besonders in den Bahnhöfen musste der Schnee zwischen den Geleisen vor die Schleuder gebracht werden.
Die Rotary konnte bekanntlich nur die eigentliche
Fahrspur räumen. Es waren durchaus Arbeiten, die gefährlich waren, denn
mit dem grossen Schleuderrad durfte man sich auf keinen Fall anlegen, denn
das endete nicht gut. Der Einsatz war klar. Die Dampflokomotive schob die Rotary vor den Schneekegel. Dann wurde die Schleuder in Gang gesetzt und der Dampf-maschine das Kommando «volle Kraft voraus» erteilt.
Der
Rotary schnaubte und heulte vor sich her und hinten
schnaufte die schiebende Dampflokomotive was sie konnte. Das konnte
durchaus bedeu-ten, dass sich die
Zylinder der
Lokomotive kaum bewegten,
weil vorne die Schleuder feststeckte.
Als dann der Schnee kam, flog eine
grosse Fontäne in die grosse weite Welt der Urner, oder Tessiner Bergwelt.
Dabei konnte man zwischen links und rechts unterschieden. Einzig mit der
Drehzahl konnte die Distanz etwas eingestellt werden. Trotzdem wusste das
Personal wissen, was es macht, denn sonst konnten durchaus geräumte
Anlagen erneut zugeschleudert werden. Es war dann plötzlich doppelt so
viel Arbeit vorhanden.
Was im Weg der Schneefontäne war, musste
sich in Deckung begeben, denn der Schnee flog einfach zur Seite. Gross
regulieren konnte das Personal nichts. So kam es, dass ein Stein in der
Lawine die Scheibe eines Hauses zerschlug und der
Rotary den Schnee
freudig in die gute Stube warf. Kein Anblick, den eine tapfere Hausfrau
gerne hatte. So waren die Fensterläden der Häuser stets schnell
geschlossen, wenn der
Rotary zu hören war.
Xrote:
Mit der elektrischen Schneeschleuder änderte sich daran eigentlich nichts.
Da aber kein Feuer mehr zu beherrschen war, verschwand der
Heizer auf der
Schneeschleuder und auch sein Kollege auf der Schublokomotive war nicht
mehr vorhanden. Alle anderen Personen blieben notgedrungen erhalten.
Weiterhin hatte der Lokführer die Aufgaben fahrdienstlicher Natur
zugeteilt und er befand sich auf der Schublokomotive.
Das erfolgte von
Hand und während dieser Zeit setzte die
Loko-motive um. Mit der Maschine
verschwand natürlich auch der Lokführer für einen kurzen Moment von der
Schleuder. Speziell war bei dieser Schleuder nur, dass der Lokführer die Geschicke des ganzen Zuges beeinflussen konnte. Schaltete er den Hauptschalter aus, blieb sowohl Lokomotive, als auch die Schleuder stehen.
So musste man darauf achten, dass das
Triebfahrzeug
nicht Probleme bekam. Das war aber nicht so leicht, wie man meinen könnte,
die Kräfte waren recht hoch und in den
Fahrmotoren flossen hohe
Ströme,
obwohl sich diese kaum drehten.
So war klar, als Schublokomotive kam
eine Maschine zur Anwendung, die man gerne losgeworden wäre. Eine dankbare
Aufgabe für die ungeliebten Exemplare der Baureihe
Ae 4/6. Bei diesen
kleinen Geschwindigkeiten machte selbst der unbeliebte
SLM-Universalantrieb
keinen grossen Lärm und wenn, wurde er von der Schleuder übertönt. Dumm
war nur, dass die
Lokomotive diese Tortur überraschend gut überstand. Die Baureihe Ae 4/6 war in diesem Punkt leider für das Lokomotivpersonal sehr gut gebaut worden. Doch wie schon erwähnt, der Lärm vom SLM-Universalantrieb merkte man bei den sehr geringen Geschwindigkeiten kaum. Die Besatzung der Schleuder freute sich ab der Lokomotive, da sie sehr feinfühlig reguliert werden konnte. In der Folge war die Xrote kaum vor einer anderen Baureihe zu sehen.
Es ist vielleicht sinnvoll, wenn ich
noch ein paar Worte zu der Schublokomotive verliere. Die Maschine war
stark belastet. Nicht nur, dass sie hohe Kräfte bei geringer
Geschwindigkeit erzeugen musste, die
Lokomotive war immer in einem
Schneesturm zu finden und daher schnell mit Schnee bedeckt. Gleiches galt
natürlich auch für die Schleuder, nur war diese für den Einsatz in einer
solchen Umgebung ausgelegt worden, Lokomotiven nicht unbedingt.
Dampflokomotiven waren heiss und so
schmolz der Schnee um an den Umlaufblechen wieder zu gefrieren. Für das
Personal entstand so eine glatte Geschichte. Dies obwohl es diese
Situation nicht lustig fand. Die elektrische
Lokomotive musste nach dem
Einsatz vom Schnee befreit werden. Das Dach war oft mit Schnee bedeckt.
Xrotm:
Bei den vier Dieselschleudern gab es zwischen der alten Schleuder und der
neuen «Beilhack» kaum Unterschiede. Auch beim geplanten Personal änderte
sich wenig bis gar nichts. Das heisst, der Lokführer war immer noch da und
suchte sich nun einen Platz auf der Schneeschleuder. Bei normalem Bestand
an Personal war so eine klare Aufgabenteilung vorhanden. Wobei der
Lokführer damit bemüht war die Vorschriften einzuhalten.
Die Besatzung änderte sich deshalb oft zum Lokführer und zum Chef des
Lokführers. Ergänzt mit dem Bahnmeister ging es dann los. Jetzt hatte aber
genau der Lokführer das sagen auf der Schleuder. Keine leichte Aufgabe,
denn wer widerspricht schon seinem Chef? Zumindest dann, wenn er den Job behalten will? Sicherlich ein Lokführer, der auf die Einhaltung von Vorschriften pochte. Meistens dann, wenn der Depotchef schleudern wollte und das wegen der Zugslage nicht erlaubt wurde.
Vermutlich fielen dann auch mal markige
Worte auf der Schneeschleuder. Später im warmen Büro durfte sich der
Lokführer anhören, dass er so nicht mehr auf die Schleuder komme. Wie oft
dann heimlich gelächelt wurde, weiss ich nicht.
Die Chefs lösten die Aufgabe mit dem
nervigen Lokführer recht einfach. So kamen immer wieder andere Leute auf
die Schleuder. Freunde der Bosse und auch andere Gwundernasen. Die
Schleuder wurde regelrecht mit Leuten überrannt. Platz gab es da kaum noch
und der Lokführer musste sich immer wieder an seine Position kämpfen. Das
nachdem er oft in den
Maschinenraum verdrängt wurde und keine Ahnung
hatte, ob die Vorschriften eingehalten wurden.
Die fahrdienstlichen Vorschriften, die
der Lokführer überwachen sollte, wurden in der Folge schlicht vergessen.
Das war dann aber noch nicht das Ende vom Spiel, denn Lokführer sind
bekanntlich stur und so wurde mit Ellbogen dafür gesorgt, dass er dort
blieb, wo er hingehörte, nämlich dort, wo er erkennen konnte, ob der Chef
das rote Signal auch wirklich so beachtet, wie er das eigentlich müsste.
Eingreifen konnte er jedoch nie.
Der Lokführer hatte dabei immer
noch die fahrdienst-lichen Aufgaben zu übernehmen, denn nur er durfte sich
auf den Strecken bewegen. Der Chef, der mit der Schleu-der fuhr, hatte die
Berechtigung schon lange verloren.
Der Lokführer war aber nie von seinem
Chef zu bändigen und er machte viele Ideen mit einem kategorischen «Nein»
zu nichte. Trotzdem, waren die Fahrten mit der «Beilhack» immer wieder
eine Wohltat für die Verfasser des Narrenblattes in Erstfeld. Ich will
Ihnen diese Sachen nicht verheimlichen, denn sie zeigen gut, wie chaotisch
es bei der
Schneeräumung oft zu und her ging. War wohl keine gute Idee den
Verfasser als Lokführer vorzusehen.
So ging es mit viel Personal zum grossen
Kampf. Darunter ein Lokführer, den man einfach im Reservezimmer griff.
Diese Einsätze wurden oft so überstürzt gestartet, dass der Schleuder
schon nach kurzer Zeit das
Dieselöl ausging, hatte man doch in der Hektik
vergessen zu tanken. Natürlich war das nicht ein Ruhmesblatt des Chefs und
der Lokführer konnte nur den Kopf schütteln. Die Fahrt zur Tankstelle
konnte er dann absegnen.
Wenn alles
klappte, konnten die drei bis vier Mannen auf der Schleuder viel Schnee
wegräumen, es sei denn, der Föhn machte Konkurrenz. Nur den schlägt
bekanntlich niemand. Dem ist auch die beste Schleuder nicht gewachsen. So
gab es Situationen, wo der Schleuder in Göschenen buchstäblich der Schnee
ausging und das während der Arbeit. Die Schleuder kehrte dann schneller
wieder nach Erstfeld zurück als geplant.
So wurde mit der
Beilhack-Schleuder oft der Zwischenraum zwischen den beiden
Geleisen
gesäubert. Dieser hatte aber so komische kleine Signale, die im Schnee
nicht zu sehen waren. Damit man deren Position erkennen konnte, waren im
Herbst lange Stangen daran montiert worden. Nur, das nützte wenig, wenn der Bahnmeister schrie «Halt Zwerg!» und der Boss das ignorierte. Das Zwergsignal segnete das zeitliche und wurde irgendwo in die weite Welt der Urner Bergwelt befördert.
Konsequenterweise natürlich mit der Stange,
die der Schleuder auch kein grosses Hindernis war. Der
Depotchef von
Erstfeld sollte so schon einmal dem
Bahnhof Wassen zu komplett neuen
Zwergsignalen verholfen haben. Um den beengten Platzverhältnissen gerecht zu werden, wurde später eine Person ersetzt. Nein, nicht der Lokführer, sondern der Bediener der Schneeschleuder.
Die Bedienung der Schleuder wurde jetzt ganz einfach von
speziell geschulten Lokführern übernommen. So war besser geregelt, wie der
Ablauf fahrdienstlich geregelt war. Die Zwerge und die Vorschriften
dankten es, denn beide wurden jetzt während der Arbeit berücksichtigt.
XTm:
Die Bedienung der Kleinschleudern der Baureihe
XTm wurde noch mehr
vereinfacht. In einem
Bahnhof konnten auch Leute des Baudienstes fahren.
Das heisst, die Schleuder wurde mit nur einem Mann bedient und so ein
optimaler Personalbestand verwirklicht. So war der Einsatz dieser
Schleuder oft billiger, als die Verwendung der grossen Schleudern, die
mehr Personal benötigten. Die Folge war klar, die «Grossen» blieben
stehen.
Da auch die Schneeschleuder im
Bahnhof
nur rangierte, war es für die Traktorführer des Baudienstes kein Problem
die
XTm zu bedienen. Das reichte sogar, dass die kleine Schleuder auch auf
der Strecke verkehren konnte. Der Bahnmeister wurde zudem nicht benötigt,
da die Leute des Baus besser wussten, was wo eingebaut worden war, als
dies oft beim Bahnmeister der Fall war. Auf jeden Fall band die
Schneeräumung weniger Personal.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Doch
bevor wir uns um die einzelnen Schleudern kümmern, behandeln wir einmal
den Sollbe-stand. Ich erwähne dann bei jeder Schleuder die Auftritte der
Bosse und die Zuteilung der jewei-ligen Aufgaben.
Doch
bevor wir uns um die einzelnen Schleudern kümmern, behandeln wir einmal
den Sollbe-stand. Ich erwähne dann bei jeder Schleuder die Auftritte der
Bosse und die Zuteilung der jewei-ligen Aufgaben.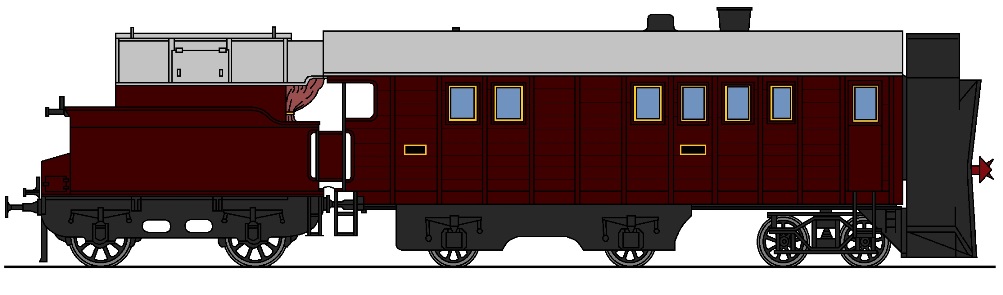
 Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass man ab 1896 fünf Personen auf der
Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass man ab 1896 fünf Personen auf der
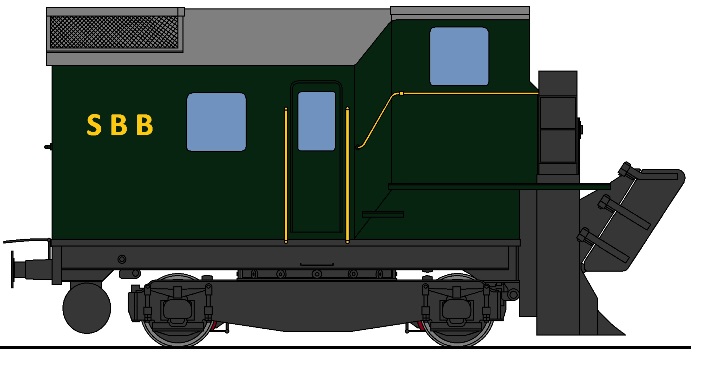 Die Besatzung der Schleuder musste den
Lokführer oft bremsen, weil die Schleuder nicht mehr mitmachte. Sie hatte
einfach zu wenig
Die Besatzung der Schleuder musste den
Lokführer oft bremsen, weil die Schleuder nicht mehr mitmachte. Sie hatte
einfach zu wenig
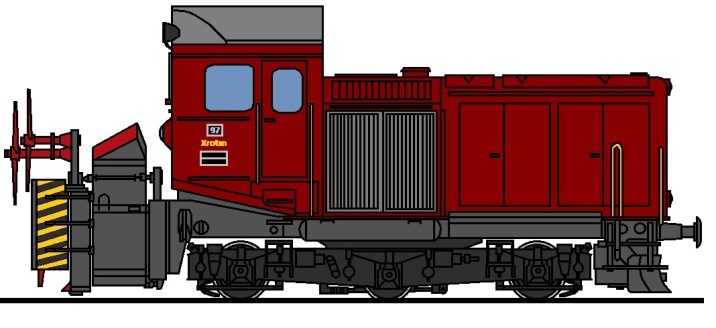 Das war auch kein Problem. Es sei denn,
der Bediener der Schleuder entpuppte sich als Chef des Lokführers. Das war
sehr oft der Fall, denn die Schleudern wurden gerne zur Chefsache ernennt.
Das war auch kein Problem. Es sei denn,
der Bediener der Schleuder entpuppte sich als Chef des Lokführers. Das war
sehr oft der Fall, denn die Schleudern wurden gerne zur Chefsache ernennt. Kam mit den Maschinen von Beilhack auch
ein grösseres
Kam mit den Maschinen von Beilhack auch
ein grösseres
 Da war der Lokführer jedoch nicht
alleine. Auch der Bahn-meister hatte grosse Probleme dem grossen Boss zu
erklären, was er zu tun und lassen hatte.
Da war der Lokführer jedoch nicht
alleine. Auch der Bahn-meister hatte grosse Probleme dem grossen Boss zu
erklären, was er zu tun und lassen hatte.