|
1902: Die Staatsbahnen übernehmen |
||||||
|
Im Jahr 1902 änderte
sich bei den Eisenbahnen in der Schweiz viel. Mit der Gründung der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB verschwanden die ersten grossen
Privatbahnen
der Schweiz. Von dieser damals durchgeführten Verstaatlichung blieb
vorerst nur die
Gotthardbahn
verschont. Diese sollte aber im Jahre 1909 auch zur neuen
Staatsbahn
geschlagen werden. Damit war nun aber eine mächtige Bahn im Land
vorhanden.
Als sich noch
herausstellte, dass bei den von den
Privatbahnen
übernommenen Maschinen ein grosses Chaos ergab, musste die junge
Staatsbahn
dafür sorgen, dass schnell eine ausreichende Bereinigung vorgenommen
werden konnte. Das erhoffte man sich, wenn ein neues System für die
Bezeichnungen eingeführt werden könnte. Aus diesem Grund begannen die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB sehr früh mit einer Überarbeitung.
Die Hauptlast der
Arbeit trugen immer noch die Dampflokomotiven, daher war klar, dass auch
ein neues System auf diese abgestimmt werden musste. Jedoch sollten auch
die Exoten neu eingebunden werden. Das waren die ersten elektrischen
Lokomotiven.
Auch wenn niemand an einen Durchbruch dieser Vehikel glauben wollte, man
stand ihnen eine Nebenrolle zu und daher sollten sie eingebunden werden.
Weitere Exoten, die
damals bereits mit Dampf betrieben verkehrten, waren die Fahrzeuge, die
neben dem
Kessel
auch noch Platz für Reisende bereit stellen konnten. Man fand sie in
erster Linie bei einzelnen
Strassenbahnen,
aber auch bei der neuen
Pilatusbahn,
die nur so auf der steilen Strecke fahren konnte. Das ergab gerade einmal
24 Fahrzeuge, was aber immer noch mehr war, als die elektrischen Ungetüme.
Noch gab es die
elektrischen Modelle nicht und bei denen sollte der Begriff nicht mehr
angewendet werden. Was sich die Schweizerischen Bundesbahnen SBB dafür
ausgedacht haben, werden wir später ansehen. Neu sollte bei der Bezeichnung auch berücksichtigt werden, dass die meisten Maschinen mit Laufachsen versehen wurden. Das war ein Wunsch, der schon 1887 geäussert wurde.
Doch noch war nicht
klar, wie das genau vorgenommen werden sollte, denn es gab im alten System
noch die Hinweise zum verbauten
Tender.
Hier war sich die
Staatsbahn
schnell sicher, denn die Unterscheidung sollte nicht mehr so dargestellt
wer-den.
Die neue Bezeichnung der
Lokomotiven
sollte Auskunft über deren Aufbau geben und zudem einige Informationen zur
Geschwindigkeit liefern. Zudem sollten die
Achsfolgen damit
auch besser benannt werden. Auch wenn alle Punkte neu waren, einen
gänzlichen Wechsel, wie es damals in anderen Ländern vollzogen wurde, gab
es hingegen nicht. Noch konnte die Macht der
Gotthardbahn
alle Wünsche etwas mildern.
Daher wurde eine Bezeichnung aus Buchstaben und
Zahlen eingeführt. Auch wenn Sie effektiv von den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB eingeführt wurde, sollte diese Bezeichnungen in der
ganzen Schweiz angewendet werden. Die kleineren
Bahngesellschaften
hatten damals schlicht nichts mehr zu bestellen und auch die
Gotthardbahn
stand kurz vor der Verstaatlichung und stellte auf das System der
Staatsbahnen
um.
|
||||||
|
Lokomotiven mit
Schlepptender |
||||||
|
A |
Höchstgeschwindigkeit über 75 km/h |
A 2/4 oder
A 3/5 |
||||
|
B |
Höchstgeschwindigkeit 70 - 75 km/h |
B 3/4 |
||||
|
C |
Höchstgeschwindigkeit 60 - 65 km/h |
C 5/6
oder C 4/5 |
||||
| D |
Höchstgeschwindigkeit 45 - 55 km/h |
D 1/3 oder D 3/3 |
||||
|
Wenn Sie sich mit dem
Schema von 1887 befasst haben, dann haben Sie sicherlich schon bemerkt,
dass bei den Buchstaben nicht geändert wurde. Die angegebenen
Geschwindigkeiten blieben gleich. Da damals nur die
Schnellzüge mit bis zu
100 km/h verkehrten, reichte diese Aufteilung. Zudem war die Zuordnung der
Lokomotiven
entfallen. Mit anderen Worten, es konnte nun auch andere Maschinen geben,
die der Klasse A zugeordnet wurden.
Die Maschinen mit
einem
Stütztender
wurden neu den
Tender-lokomotiven
gleich gestellt. Der Grund war, dass diese Modelle demnächst verschwinden
sollten und dass deren
Tender
auch nicht so leicht ausgetauscht werden konnte. Die nun doch recht kurz ausgefallene Bezeichnung für Loko-motiven mit einem Schlepptender wurde nicht mehr mit einer weiteren Ergänzung versehen. Aus der A3t wurde schlicht noch ein Modell der Reihe A.
Damit haben wir eigentlich einen Rückschritt,
doch dieser wurde mit der neuen Bezeichnung für die
Achsfolge
wieder ausgeglichen, denn dieser sollte umfangreicher werden und aus einem
einfachen Bruch bestehen.
Dabei wurden im Zähler, also bei der Zahl
oberhalb vom Strich, die
Triebachsen
angegeben. Der Nenner benannte die totale Anzahl von
Achsen. So
ergaben sich Brüche, wie 3/5. Jedoch war eine Bezeichnung 5/3 nicht
möglich. Der Zähler musste immer kleiner oder gleich dem Nenner sein. Die
Achsen der
Schlepptender
wurden jedoch nicht aufgeführt. Das war bisher auch nicht der Fall
gewesen, so dass sich hier nichts änderte.
Aufgegeben wurde die spezielle Bezeichnung für
Lokomotiven der
Lokalbahnen. diese waren nun den normalen Strecken gleich gestellt.
Dadurch wurde deren Buchstabe E frei. Mit diesem sollten nun aber die
Tenderlokomotiven
bezeichnet werden. Deren
Höchstgeschwindigkeit
wurde mit einem zweiten Buchstaben angegeben. In der Folge sah das bei den
Tenderlokomotiven so aus, wie in der Tabelle gezeigt.
|
||||||
| Tenderlokomotiven | ||||||
|
Ea |
Höchstgeschwindigkeit
über 75 km/h |
Ea 3/6 |
||||
|
Eb |
Höchstgeschwindigkeit 70 - 75 km/h |
|
||||
|
Ec |
Höchstgeschwindigkeit 60 - 65 km/h |
Ec 3/5 |
||||
|
Ed |
Höchstgeschwindigkeit 45 - 55 km/h |
Ed 4/5 |
||||
|
E |
Für Nebenlinien und Rangierdienst |
E
3/3 oder E 4/4 |
||||
|
Tenderlokomotiven wurden neu generell
mit dem Buchstaben E bezeichnet. Trug eine
Lokomotive in der
Bezeichnung ein grosses E, war es ein Modell, das die Vorräte selber
mitführte. Da solche Maschinen auch im
Rangierdienst
eingesetzt wurden, kamen diese neu in den Pool für die Tenderlokomotiven.
Konnten die Maschinen jedoch schneller als 40 km/h fahren, gab es neu den
zweiten klein geschriebenen Buchstaben.
Von den insgesamt
sechs
Achsen
waren deren drei angetrieben wor-den. Wir haben daher mehr Erfahrung, als
mit der alten Bezeichnung von 1887, die hier von einer
Lokomotive der Reihe A3
ausgegangen wäre.
Damit hatte man klar
definiert, dass es sich um eine
Tenderlokomotive
handelt und die Abgabe der Geschwindigkeit war ebenfalls vorhanden. Doch
damit kommen wir zu den Modellen mit
Stütztender.
Diese wurden neu als Tenderlokomotiven geführt und dabei die
Achsen
des
Tenders
in die Angabe der
Achsfolge
aufgenommen. Aus der B2E entstand so die neue Baureihe Ec 2/5, womit wir
erkennen, dass es doch leichte Unterschiede bei der Geschwindigkeit gab.
Es gilt noch zu
erwähnen, das das bisher vorgestellte System für die Bezeichnung auch
ausserhalb der Schweiz angewendet wurde. Besonders in Bayern wendete man
das Muster mit anderen Buchstaben an. Bekannt in diesem Zusammenhand waren
sicherlich die
Schlepptenderlokomotiven
der Reihe S 3/6, die als
Schnellzugslokomotive
bei der königlich bayrischen
Staatsbahn
Gesellschaft in dieser Zeit in Betrieb genommen wurde.
Das bisher
vorgestellte System galt genau genommen nur für die
Lokomotiven, die auf
Normalspur
verkehrten. Das war schon beim System von 1887 so gewesen und stellte
daher keine Änderung dar. Durch die neue Ordnung der
Dampfmaschinen
wurde jedoch das bisher noch verwendete F frei gestellt. Diese sollten nun
die neuen Exoten auf den
Geleisen
in der Schweiz bekommen. Es waren die elektrischen Modelle.
|
||||||
|
Elektrolokomotiven |
||||||
|
F |
Elektrische
Lokomotiven erhielten
ein Gross geschriebenes F so wie bei den
Tenderlo-komotiven
und kleine Buchstaben für die Geschwindigkeit. |
Fb 5/7 oder
Fc 2x 3/4 |
||||
|
Die exotischen elektrischen
Lokomotiven bezeichnete
man damals noch nach dem Muster der
Tenderlokomotiven.
An der Stelle des dort verwendeten E, trat nun einfach das F. Das war ja
frei geworden, weil auf die spezielle Bezeichnung für
Rangierlokomotiven
verzichtet wurde. Doch mit den Exoten kam es zu einem Punkt, der auch die
Exoten bei den Dampflokomotiven betreffen sollte, denn die
Achsfolge
wurde nicht immer gleich angezeigt.
Aus der schon erwähnten D6 der Gotthardbahn sollte so die neue Ed 2x 3/3 werden.
Die im Versuchsbetrieb auf der Strecke zwischen
Seebach und Wettingen eingesetzten Modelle MFO 1 und MFO 2 konnten nun
aber auch als Reihe Fc 2 x 2/2 geführt werden.
Hatte die
Lokomotive jedoch einen
asymmetrische Aufbau erhalten, wurden die einzelnen
Laufwerke von
vorne nach hinten geführt. Sofern im vorlaufenden Teil noch eine
Laufachse
vorhanden war, ergab das die
Achsfolge
2/3 + 2/2. Eine nun doch recht lange Bezeichnung, wenn noch die beiden
Buchstaben einer der neuen elektrischen Maschinen dazu kamen. Sie sehen,
man hatte bei der Angabe der
Achsen
wirklich viele Möglichkeiten.
Vom System, das 1887
eingeführt wurde, behielt man, dass
Lokomotiven mit der gleichen Bezeichnung mit den Nummern
unterschieden werden sollten. Das musste die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB bei der Baureihe
A 3/5
vornehmen, da es dort Muster der Jura – Simplon – Bahn
JS (700),
der
Gotthardbahn
(900) und eigene Modelle (600) gab. Auch bei anderen Baureihen war das so,
womit es erstmals in der Schweiz zu vierstelligen Nummern kam.
Soweit die
Normalspur,
wir können zu den weiteren Exoten und den Modellen für
Schmalspur
wechseln. Deren Anzahl der Strecken war damals stetig gestiegen und mit
der Verstaatlichung der
JS,
kam mit der Brünigbahn sogar eine dazu, die ganz besonders exotisch war,
denn es handelte sich um eine Strecke mit
Adhäsion
und
Zahnrad.
Eine Kombination, die bereits 1887 berücksichtigt wurde und die man nicht
veränderte.
|
||||||
|
Schmalspur- und
Tramway und Zahnradlokomotiven |
||||||
|
G |
Bei Schmalspurlokomotiven wurde auf den Zusatz mit dem
klein geschriebenen Buch-staben verzichtet. |
G 3/4 |
||||
|
H |
Alle Zahnradlokomotiven erhielten nur das H |
H 2/2 |
||||
|
HG |
Bei schmalspurigen Zahnradlokomotiven mit zusätzlichem
Adhäsionsantrieb wurde die Bezeichnung für die Schmalspurlokomotive hinten
angestellt. |
HG 3/3 |
||||
|
So durchdacht das neue System der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB war, es hatte eine Kategorie von
Fahrzeugen noch nicht berücksichtigt. Es waren die damals noch nicht so
oft eingesetzten
Triebwagen.
Diese sollten neu in einer eigenen
Gruppe
geführt und dabei näher zu den Wagen verschoben werden. Die
Staatsbahnen
sahen die angetriebenen Wagen damals eher als spezielle
Personenwagen an.
Das war zum Beispiel
bei den damals vorhandenen Modellen die Reihen CZ. Dabei stand das C für
die dritte
Wagenklasse
und das Z für das in diesem Fahrzeug vorhandene
Postabteil. Eine
Rei-henfolge, die auch bei Wagen üblich war. Diese Angaben wurden zusätzlich mit einem weiteren klein geschriebenen Buchstaben ergänzt. Im System von 1902 war dazu der Buchstaben m vorgesehen worden. Dabei stand dieser Hinweis für das motorisierte Fahrzeug.
Der nachfolgend
eingefügte Bruch, wie bei den
Lokomotiven gab dann noch die Auskunft über die
Achsfolge.
Hinweise zur
Höchstgeschwindigkeit
fehlten bei diesen Fahrzeugen jedoch grundsätzlich.
Eingeführt wurde
dieses Bezeichnungssystem im Jahre 1902 und es war für die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB verbindlich. Es sollte auf Geheiss der Behörden auch von
den damals noch verbliebenen
Privatbahnen
angewendet werden. Wie schon erwähnt, waren davon auch Gesellschaften im
Ausland angetan und führten ähnliche Systeme ein. Somit können wir
annehmen, dass es sich um eine gute Lösung handelte.
Wie gut das auf
Dampflokomotiven ausgelegte System für die Bezeichnung von den Baureihen
war, zeigte sich nach rund elf Jahren. Die elektrischen
Lokomotiven hatten sich
gemausert und sie sollten nun mit der Lötschbergbahn den grossen
Durchbruch schaffen. Als sich die Schweizerischen Bundesbahnen SBB im
Jahre 1918 auch für dieses
Stromsystem
und neue elektrische Fahrzeuge entschieden, war das System bereits wieder
überholt.
|
||||||
| Zurück | Navigation durch das Thema | Weiter | ||||
| Home | Depots im Wandel der Zeit | Die Gotthardbahn | ||||
| News | Fachbegriffe | Die Lötschbergbahn | ||||
| Übersicht der Signale | Links | Geschichte der Alpenbahnen | ||||
| Die Lokomotivführer | Lokführergeschichte | Kontakt | ||||
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||||
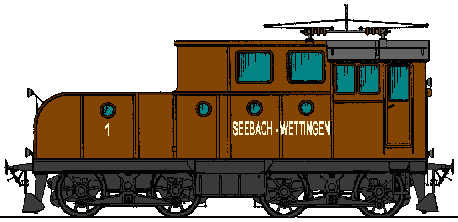 Zur
Zeit, als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch immer mehr Bahnen,
die verstaatlicht wurden, wuchsen, begannen im Raum Seebach erste Versuche
mit einer neuartigen Technik. Die komisch aussehenden Maschinen wurden
nicht mehr mit Dampf und
Zur
Zeit, als die Schweizerischen Bundesbahnen SBB durch immer mehr Bahnen,
die verstaatlicht wurden, wuchsen, begannen im Raum Seebach erste Versuche
mit einer neuartigen Technik. Die komisch aussehenden Maschinen wurden
nicht mehr mit Dampf und
 Eine
Lösung für diese Fahrzeuge hatte man noch nicht, denn noch wusste man
nicht einmal, wie sie bezeichnet werden sollten. Da oft von angetriebenen
Wagen gesprochen wurde, entschied man sich für
Eine
Lösung für diese Fahrzeuge hatte man noch nicht, denn noch wusste man
nicht einmal, wie sie bezeichnet werden sollten. Da oft von angetriebenen
Wagen gesprochen wurde, entschied man sich für
 Neu
war eigentlich nur, dass man bei diesen vier Buchstaben nur noch die
Neu
war eigentlich nur, dass man bei diesen vier Buchstaben nur noch die
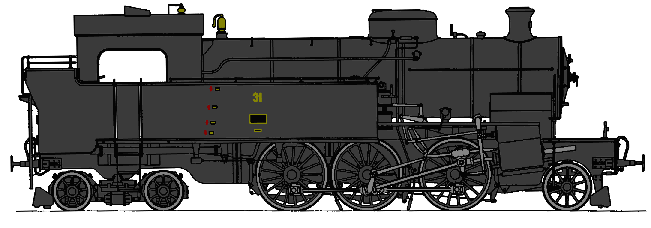 Als
Muster sehen wir uns die Baureihe Ea 3/6 der Bern – Neuenburg -Bahn BN an.
Es handelte sich dabei um eine einfache
Als
Muster sehen wir uns die Baureihe Ea 3/6 der Bern – Neuenburg -Bahn BN an.
Es handelte sich dabei um eine einfache
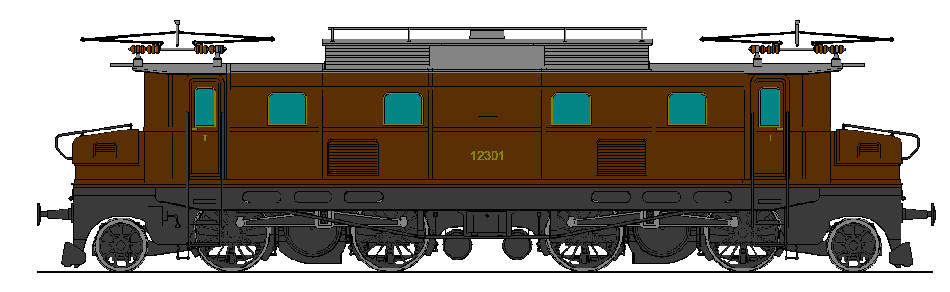 Bei
der Angabe für die
Bei
der Angabe für die