|
Laufwerk und Antrieb |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Das
Laufwerk
bestand aus zwei identischen
Drehgestellen. Diese wurden jeweils Rücken an Rücken
unter dem Kasten eingebaut. Eine
Kurzkupplung,
die eine direkte
Verbindung
zwischen den beiden Drehgestellen ergeben hätte, gab es jedoch nicht mehr.
Daher musste die
Zugkräfte
auf die
Lokomotivbrücke
übertragen werden. Dazu kommen wir später, denn zuerst sehen wir uns ein
Drehgestell genauer an, denn dieses hatte die
Achsfolge
1B.
Ein Aufbau, der
jedoch den anderen Baureihen zu jener Zeit entsprach und so keine Neuerung
bedeu-tete. Die gegenüber von anderen Baureihen schwäch-eren Bleche waren
eine direkte Folge von der Reduktion beim Gewicht, denn die
Achslast
durfte nicht überschritten werden. Dieser stabile Drehgestellrahmen wurde schliesslich auf der jeweiligen aussen liegenden Seite der Loko-motive mit einem quer verlaufenden Blech abge-schlossen Dieses Abschlussblech wurde deutlich breiter ausgeführt, als das beim üblichen Rahmen der Fall war.
Es entstand so ein
Stossbalken,
der jedoch gegenüber dem
Plattenrahmen
abgestützt werden musste. Eine Lösung, die damals in der Schweiz durchaus
üblich war.
Mittig in diesem
Stossbalken
wurden die
Zugvor-richtungen
eingebaut. In diesem Bereich mussten sich die Erbauer, aber auch der
Besteller an die geltenden Normen der
UIC
halten. Daher wurde federnd im Rahmen des
Drehgestells ein
Zughaken
eingebaut. Die hier eingebauten
Spiralfedern
sorgten dafür, dass der Haken gegen den Stossbalken gezogen wurde. Eine
seitliche Verschiebung, wie sie heute üblich ist, gab es jedoch nicht.
Schliesslich wurde am
Zughaken
noch die
Schraubenkupplung
nach
UIC
angebaut. Diese bestand aus den üblichen Bauteilen. Da diese
Kupplung
damals noch sehr oft beschädigt werden konnte, wurde auch bei dieser
Lokomotive eine
Notkupplung
bestehend aus einem Bügel eingebaut. Auch wenn dieser Bügel zusätzliches
Gewicht bedeutete, war die Kupplung vorgeschrieben worden. Sie sehen, hier
konnte der Hersteller wirklich kaum etwas verändern.
Nur so konnten die
Kräfte in den
Plattenrahmen
abgeleitet werden. Ansonsten wäre der
Stossbalken
beschädigt worden. Ein Problem, das hier wegen den schwächeren Blechen
gross war. Als Stossvorrichtungen wurden die damals üblichen Stangenpuffer verwendet. Diese Puffer federten die eingebaute Stange mit der Hilfe von Spiralfedern ab, so dass die Stösse in einem bestimmten Masse abgefangen werden konnten.
Damit die Einleitung
von den anderen Fahrzeugen ideal war, wurden die
Stan-genpuffer
mit runden
Puffertellern
versehen. Dabei kam, wie damals üblich, ein flaches und ein gewölbtes
Modell zur Anwendung.
Auf dem
Drehgestellrahmen
wurde eine
Plattform
montiert. Diese bestand aus einem einfachen Umlaufblech und dem darin
aufgebauten
Vorbau.
Diese Vorbauten waren damals durchaus beim Bau von
Lokomotiven üblich und sie boten Platz für kleinere
Komponenten, die im
Maschinenraum
keinen Platz mehr fanden. Bevor wir uns jedoch diesen Vorbau ansehen,
betrachten wir die darum herumlaufende Plattform etwas genauer.
Das Bodenblech der
Plattform
war einfach aufgebaut worden und besass keine spezielle Oberfläche. Daher
konnte das Blech bei Nässe sehr schnell rutschig werden. Damit sich das
Personal in diesem Fall festhalten konnte, war ein Geländer vorhanden.
Dieses wurde sowohl bei der
Front, als auch bei den Seiten aufgebaut und
gab der
Lokomotive ihr spezielles Gesicht, denn solche Geländer waren
damals durchaus nicht üblich.
Damit das auch während der Fahrt möglich war, wurde an der oberen
Kante des
Stossbalkens ein
Übergangsblech mit den entsprechenden
Handgriffen eingebaut. Damit das Blech beim Kuppelvorgang nicht störte,
konnte es senk-recht aufgestellt und verriegelt werden. Wir können uns daher den auf dem Drehgestell montierten Vorbau ansehen. Dieser bestand aus den beiden Seiten-wänden, der Front und der Abdeckung. Wir beginnen auch hier mit den beiden Seitenwänden.
Die beiden Wände waren, wie beim Kasten, identisch
aus-geführt worden und sie besassen jeweils eine Klappe. So konnte der sich
dort befindliche
Quarzsand
leicht von aus-sen aufgefüllt werden. Eine
Lösung, die oft angewendet wurde. Somit kommen wir zur Front, diese war als einfache Wand ausgeführt worden und besass weder Türen, noch waren Lüftungsgitter vorhanden. Die Ecken wurden zu-dem gerundet ausgeführt.
Das war auch zum oberen Bereich der Fall. Dieser war nach
vorne geneigt ausgeführt worden, so dass der Blick über den
Vorbau auf die
Strecke verbessert wurde. Ein Punkt, der bei längeren Vorbauten, wie bei
der Reihe Ce 6/8 II nicht gegeben war.
Die bisher verschlossene
Kiste besass auf der oberen Seite eine Abdeckung. Diese war jedoch nicht
so breit, wie der
Vorbau. Jedoch war so ein Zugang zum Innenraum
vorhanden. Ein Punkt, der auch bei der wenig älteren Maschine der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Fall war. Auch der um den Vorbau
herumführende Handlauf war hier sehr gut zu erkennen. Wer auf dem
Umlaufblech stand, konnte sich daher beidseitig festhalten.
Gerade diese
Lokomotive
zeigte, dass die spezielle Bauweise der Reihe
Ce 6/8 II damals durchaus
nicht unüblich war. Die Reihe Ce 4/6 war nahezu gleich aufgebaut. Trotzdem
sprach man bei der Maschine für die BLS-Gruppe nicht von einer
«Krokodilbauweise», da die kurzen
Vorbauten diesen Umstand nicht so
deutlich zeigten. Wobei die hier verwendeten Übernamen wie
«Voralpenschnüffler», oder «Dekretsmühle» nicht nur schmeichelhaft waren.
Damit können wir die Bereiche
auf dem
Drehgestellrahmen abschliessen. In diesem eingebaut wurden die
beiden
Triebachsen. Davor befand sich schliesslich unter dem
Vorbau die
bewegliche
Laufachse. Wir beginnen die Betrachtung des eigentlichen
Fahrwerkes mit dieser
Achse. Ausgeführt wurde diese Laufachse als
Adamsachse und daher war sie letztlich auch im Rahmen des
Drehgestelles
eingebaut worden. So konnte sich jedoch in den Führungen bewegen.
Der Vorteil der
Adamsachse
bestand darin, dass sie mit einem Abstand von 1 450 mm zur ersten
Triebachse
eine sehr kurze Bauweise ermöglichte. Die im
Drehgestellrahmen eingebauten Führungen erlaubten es der
Laufachse, sich
seitlich so zu verschieben, dass die Radien der vorgesehenen Strecken ohne
Probleme befahren werden konnten. Durch den Aufbau wurde die Laufachse in
der Führung jedoch automatisch zentriert.
Das war möglich, da
sich diese
Lager nicht so schnell erwärmten, wie das bei den sich
drehenden Lagern der
Achse der Fall war. Aus diesem Grund wurden bei den
dort verbauten
Gleitlagern
andere Lösungen ver-wendet. Es kamen bei den drehenden Lagern Lösung-en zur Anwendung, die über Lagerschalen aus Weissmetall verfügten. Um die Reibung zusätzlich zu vermindern und um die schnell drehenden Gleitlager zu kühlen, musste das Achslager zusätzlich geschmiert werden.
Hier verwendete man eine
Sumpfschmier-ung, die das
Schmiermittel
Öl
gleichmässig auf die Achswelle übertragen konnte. Es waren daher keine
Neuerung vorhanden. Beidseitig wurden auf der Achswelle die Räder aufgezogen. Wie bei Laufachsen üb-lich, wurden Speichenräder verwendet. Diese Räder wurden zusätzlich mit einem Verschleissteil in Form einer Bandage ver-sehen.
Damit hatte die
Laufachse
bei den
Rädern einen Durchmesser von 850 mm erhalten. Das entsprach den
Werten, bei der Baureihe
Be 5/7. Somit konnten deren Ersatzachsen auch
hier verwendet werden, was den Unterhalt vereinfachte. Die Laufachse wurde mit hoch liegenden Blattfedern, die in speziellen Federstützen gehalten wurden, abgefedert.
Diese
Federung mit
Blattfedern sorgte dafür, dass die
Laufachse sehr ruhig im
Gleis lief. Zudem erlaubten die Stützen auch, dass
die
Feder eingestellt werden konnte. Bei der fertigen
Lokomotive konnte so
die
Achslast der Laufachse auf einen Wert von zehn Tonnen beschränkt
werden. Genau genommen waren es 9.9 Tonnen.
Wir können damit zu den
beiden
Triebachsen wechseln. Auch diese
Achsen wurden innen gelagert und
sie wurden mit
Gleitlagern versehen. Die verwendeten
Achslager entsprachen
sowohl bei der Ausführung, als auch bei der
Schmierung
der vorher
vorgestellten
Laufachse. Daher konnten hier die gleichen
Schmiermittel
verwendet werden. Eine seitliche Verschiebung, oder gar eine radiale
Einstellung erlaubten die
Lager jedoch nicht.
Jedoch
war die Reduktion auch nur möglich, weil bei der hier vorgestellten
Maschine, kleinere
Trieb-räder verwendet wurden. Es ist daher gut zu
erken-nen, dass der Durchmesser keine so grosse Rolle spielte. Auch bei den Triebrädern wurden Speichenräder verwendet, die mit einer Bandage als Verschleissteil ausgeführt wurden. Der Durchmesser des fertig aufgebauten Rades betrug 1 230 mm und war daher sehr klein ausgefallen.
Jedoch wurde mit der
Hilfe der kleinen
Räder
und der Ausführung als
Speichenrad, letztlich das
Ge-wicht der
Lokomotive verringert. Ein Punkt, der bei der Reihe Ce 4/6
wegen den geringen
Achslasten wichtig war. Die Triebachsen wurden mit tief liegenden Blatt-federn gegenüber dem Drehgestell abgefedert. Die Federn wurden ebenfalls in Federstützen eingebaut.
Wie bei der
Laufachse
konnte so die
Achslast
mit der
Federung optimal eingestellt werden. Das führte dazu, dass
die maximale Last auf den angetriebenen
Achsen bei 12.3 Tonnen lag. Daher
erreichte die 68 Tonnen schwere
Lokomotive ein
Adhäsionsgewicht von
deutlich über 48 Tonnen.
Um das
Laufwerk vor
Beschädigungen zu schützen, wurden am
Drehgestellrahmen unmittelbar vor
der
Laufachse die üblichen
Schienenräumer
eingebaut. Auch bei diesem oft
beschädigten Bauteil wurde darauf geachtet, dass vorhandene Ersatzteile
genutzt werden konnten. Daher waren die verwendeten Modelle auch bei der
Reihe
Be
5/7 und bei den Dampflokomotiven der auf elektrischen Betrieb
ungestellten Bahnen vorhanden.
Damit in diesem Fall die Bleche
nicht zur Seite weggedrückt wurden, verband man sie mit einer Stange.
Somit entsprachen die
Schienenräumer der üblichen
Bauart. Ein Punkt, der
erst mit Einführung der
Bahnräumer geändert werden sollte. Es wird Zeit, dass wir die beiden Drehgestelle einbauen. Dabei stützte sich der Kasten auf zwei seitlich auf dem Drehgestellrahmen montierten Gleitplatten ab. Diese sorgten dafür, dass der Kasten nicht ins wanken geraten konnte.
Weil sich
der Kasten jedoch auf diesen Platten bewegen konnte, mussten diese
geschmiert werden. Auch hier konnten dazu
Fette verwendet werden. Eine
Federung war hier jedoch nicht mehr vorhanden. An der Position gehalten wurde der Kasten mit einem normalen Drehzapfen. Dieser wurde am Kasten montiert und reichte tief in den Drehgestellrahmen, wo er in einer beweglichen Aufnahme endete.
Diese erlaubte es dem
Drehgestell sich
gegenüber dem Kasten frei zu be-wegen. Zudem konnten dank dieser
Konstruktion die
Zugkräfte übertragen werden. Es konnte deshalb auf die
früher bei der
Ce 6/6 noch benötige
Kurzkupplung
verzichtet werden.
Jedoch konnte der
Drehzapfen
nur die
Zugkräfte übertragen. Die im Betrieb jedoch auch auftretenden
Stosskräfte wurden nicht damit übertragen. Traten diese auf, wurden die
beiden
Drehgestelle zueinander verschoben. Sie stützten sich in dem Fall
über zwei
Puffer gegeneinander ab. Die Länge über Puffer, die mit 14 390
mm angegeben wurde, konnte sich daher im Betriebseinsatz leicht verändern,
jedoch war diese nicht so gross, dass sie erwähnt werden muss.
In diesem Bereich gab es jedoch die grössten
Unterschiede zwischen den
Lokomotiven. Dabei bestanden diese Abweichungen
nicht nur zwischen den Baureihen Ce 4/6 und Be 4/6. Wir müssen daher diese
Getriebe etwas genauer ansehen.
Bei den von der
Maschinenfabrik Oerlikon MFO gebauten Modellen mit den Nummern 301 bis 307
wurde eine
Übersetzung von
1:3.78 vorgesehen. Die bei der BBC gebauten
Lokomotiven der Baureihe Ce 4/6 wurden wegen dem anderen
Fahrmotor jedoch
mit einer Übersetzung von 1:3.86 ausgeliefert. Für die Reihe Be 4/6 wurde
wegen der höheren
Höchstgeschwindigkeit das
Getriebe erneut verändert. So
betrug bei diesen Maschinen die Übersetzung 1:3.06.
Das schräg verzahnte
Getriebe
war in einem geschlossenen Gehäuse eingebaut worden. Dabei war das
Zahnrad
in einer
Blindwelle gelagert worden. Wie die
Lager der Motorwelle wurde
auch die Welle in
Gleitlagern gelagert. Diese mussten mit
Öl geschmiert
werden. Wegen den damit doch recht grossen Anzahl Schmierstellen, wurde
auf der
Lokomotive eine
Schmierpumpe eingebaut. Dank dieser
Ölpumpe konnte
die
Schmierung auch optimiert werden.
Bei der notwendigen
Schmierung der Zähne, wurde jedoch eine andere einfache Lösung verwendet.
Das Gehäuse war mit einer
Ölwanne versehen worden. Dort befand sich das
Schmiermittel und das
Zahnrad lief durch dieses. Dabei nahmen die Zähne
das
Öl auf und übertrugen dieses auf das Ritzel. Durch die Fliehkraft
wurde das Schmiermittel jedoch auch an die Wände geschleudert und lief
anschliessend wieder in die Wanne.
Dank dieser Scheibe, die schon bei den Baureihen für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet wurde, konnte auf Gegengewichte verzichtet werden.
Auf den
Scheiben wurden schliesslich die
Kurbelzapfen eingebaut. Wir haben daher
eine damals übliche
Vorgelege-welle erhalten. Ab der Vorgelegewelle wurde das Drehmoment mit leicht gepfeilten Triebstangen auf die beiden Triebräder übertra-gen. Diese leichte Pfeilung der Stangen war nötig, weil die Drehzapfen der Blindwelle und der Triebachsen nicht auf der gleichen Höhe angeordnet werden konnten.
Das war eine Lösung, wie sie schon bei der
Reihe
Be 4/6 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB angewendet wurde. So
waren beim Bau die Erfahrungen vorhanden. Der notwendige Ausgleich der Federung wurde im ver-schiebbaren Kurbellager der Blindwelle sichergestellt. Die beiden Triebachsen waren jedoch in der Triebstange fest gelagert.
Auch bei diesen
Lagern wurden die üblichen
Gleitlager
ver-wendet. Um die
Lagerschalen aus
Weissmetall zu kühlen und um die
Reibung zu verringern, wurde eine
Schmierung mit
Nadellagern verwendet.
Bei diesen musste das
Schmiermittel jedoch manuell ergänzt werden.
Jedoch gab es beim
Stangenantrieb zum Muster der
Staatsbahnen einen deutlich erkennbaren
Unterschied. Da die
Vorgelegewelle wegen dem verfügbaren Platz nicht
mittig eingebaut werden konnte, waren die Stangen unterschiedlich lang.
Dabei war die zu der nach der Innenseite gerichteten
Triebachse geführte
Triebstange deutlich länger, als die andere Stange. Das war ein Merkmal
dieser Baureihe und wurde selten angewendet.
Damit haben wir das
Drehmoment des
Triebmotors auf die
Triebachsen übertragen. In den
Rädern
wurde dieses mit Hilfe der
Adhäsion zwischen der
Schiene und der
Lauffläche in
Zugkraft umgewandelt. Diese Kraft wurde schliesslich vom
vorderen
Drehgestell mit dem
Drehzapfen auf den Kasten und so auf das
hintere Drehgestell übertragen. Dort wurden dann die gebündelten Zugkräfte
den Zugvorrichtungen zugeführt und so auf die
Anhängelast übertagen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Als
tragendes Element für das
Als
tragendes Element für das  Da
die
Da
die
 Der Zugang zu dieser
Der Zugang zu dieser
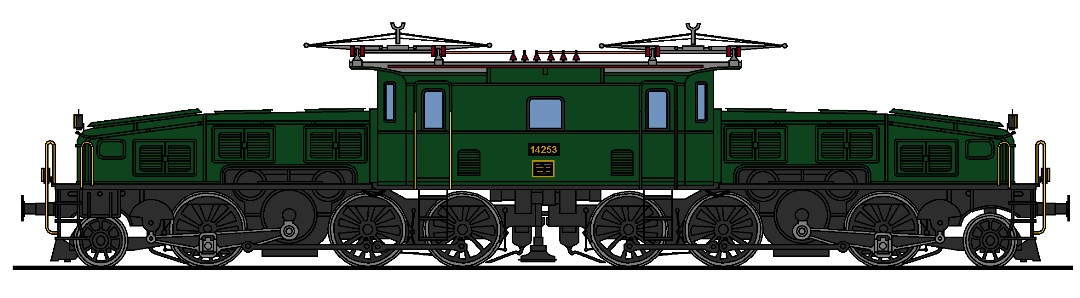
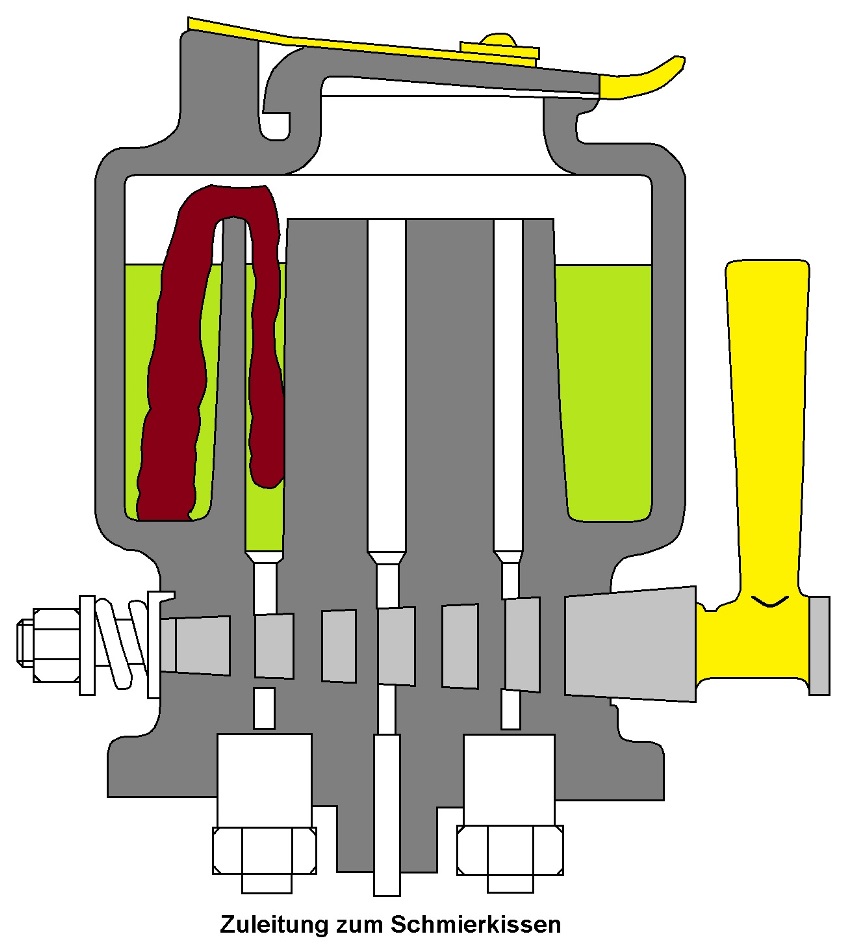
 Der feste
Der feste
 Die Aufgabe der beiden
seitlich nach hinten gezogenen
Die Aufgabe der beiden
seitlich nach hinten gezogenen
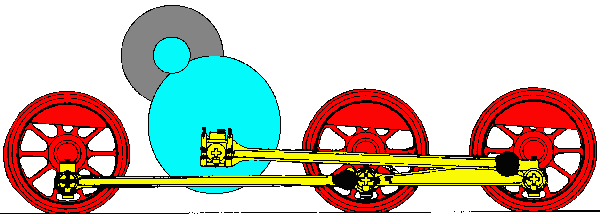 Damit können wir zum
Damit können wir zum
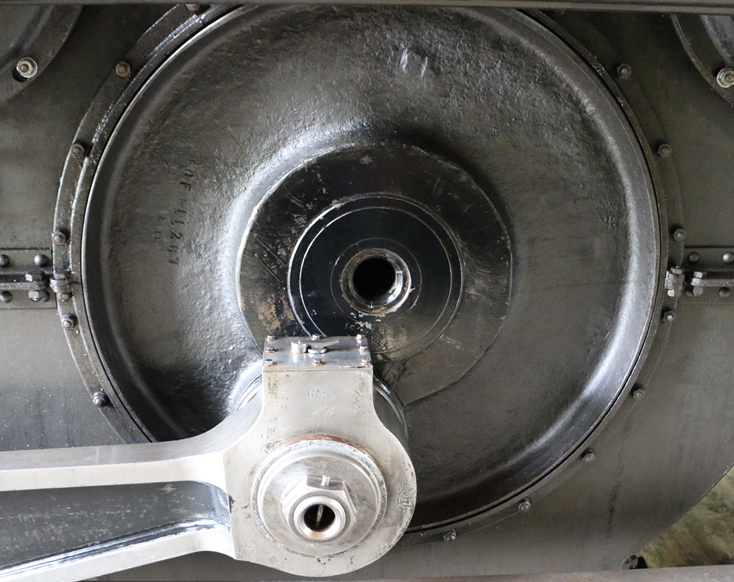 Die
Die