|
Laufwerk mit Antrieb |
|||||||||||
| Navigation durch das Thema | |||||||||||
|
Kommen wir zum einfachsten Teil der beiden
Baureihen.
Das
Laufwerk
und damit die
Drehgestelle
waren identisch ausgeführt worden. Auf den Hinweis zu den einzelnen
Lösungen können wir uns ersparen. In diesem Zusammenhang sehen wir uns
eine besondere Eigenart an. Elektrische
Lokomotiven
benötigten für den Stromfluss an den
Achsen
Erdungsbürsten.
Diese verhindern, dass der
Strom
über die
Lager
fliessen konnte.
Jedoch konnte die
Fahrleitung
auf die
Lokomotive
fallen und so war eine gesicherte
Erdung
vorhanden. Effektiv war aber schon zu Beginn vorgesehen, eine elektrische
Version zu bauen und so wurden diese Bauteile auch bei der
Diesellokomotive
eingebaut. Wir können uns nun auf ein Drehgestell beschränken, denn diese waren identisch aufgebaut worden. Es han-delte sich auch nicht um eine komplett neue Konstruk-tion. Die
Laufwerke
wurden von der
Versuchslokomotive
DE 2500 übernommen. Eine Massnahme, die dafür sorgte, dass die Kosten für
jede
Lokomotive
gemildert werden können. Da die Versuchslokomotive in Deutschland
ver-kehrte, müssen wir uns diesen Teil genau ansehen.
Als tragendes Element wurde ein Rahmen aufgebaut. Genau handelte
es sich um einen Hohlrahmen, der aus einzelnen Stahlblechen bestand. Die
Bleche wurden mit Hilfe der elektrischen
Schweisstechnik
verbunden. Gerade beim Bau von
Drehgestellen
konnten keine anderen Materialen verwendet werden, denn hier mussten
grosse Kräfte übertragen werden und zudem musste eine gewisse Elastizität
vorhanden sein und das bot Stahl.
In jedem
Drehgestellrahmen
wurden drei
Achsen
eingebaut. Im Unterschied zur älteren
Baureihe
Bm 6/6 wurden die
Radsätze
gleichmässig verteilt. Der dadurch entstandene feste
Radstand
wurde mit 3 800 mm angegeben und damit war der Aufbau für drei eingebaute
Triebachsen
ausgesprochen kurz ausgefallen. Wenn wir andere Lösungen als Vergleich
ansehen, dann waren Werte von über vier Metern durchaus üblich.
Daher wurden hier
Scheibenräder
verbaut, die zu-sammen mit dem aufgezogenen
Radreifen
einen Durchmesser von 1 260 mm erhielten. Damit konn-ten hier durchaus die
Bandagen
der
Baureihe
Re 4/4 II verwendet werden. Gerade in diesem Bereich zeigt sich, dass die Durchmesser der Räder oft nicht frei gewählt wer-den können. Bedingt durch das für die Strecke ge-baute Muster DE 2500 waren grössere Räder vor-handen.
Den Schweizerischen Bundesbahnen SBB kam das zu Gute, weil schon
zahlreiche
Lokomotiven
der Strecke über diese
Räder
verfügten. Die Vorhaltung der Ersatzräder und
Achsen
war daher kein so grosses Problem. Zumal damals die
Bandage
ge-wechselt wurde.
Die
Achsen
wurden in aussen liegenden
Lagern
ge-halten. Wie damals durchaus üblich kamen hier die doppelreihigen
Rollenlager
zur Anwendung. Diese hatten sich seit Jahren bewährt und dank der
dauerhaften
Schmierung
mit
Fett
konnte der Unterhalt gemildert werden. Diese geschlossenen
Achslager
waren auch der Grund für die benötigten
Erdungsbürsten,
denn dank diesen war die
Lokomotive
sicher mit der Erde verbunden.
Speziell waren die Gehäuse der
Achslager,
diese waren sehr locker im Rahmen geführt worden. Dabei war jedoch keine
radiale Einstellung möglich, denn gerade diese Richtung war als einzige
blockiert worden. Der Grund waren die für die
Zugkraft
benötigen Lenkstangen. Jedoch war auch ein seitliche Spiel erforderlich,
denn sonst können mit einem dreiachsigen
Drehgestell
schlicht keine
Kurven
befahren werden.
Damit konnten mit den
Drehgestellen
Radien bis hin-unter auf 80 Meter befahren werden. Solche waren jedoch
selten und dann oft auch nur in
Anschlussge-leisen
vorhanden. Ein freier Einsatz war aber nicht möglich. Um die erwähnten Werte beim Querspiel einzuhalten waren Anschläge benutzt worden. Dank diesen konn-te das Spiel sehr genau eingestellt werden, was zu einer guten Führung im Gleis sorgte.
Wie sich das auswirken sollte, werden wir später noch ansehen,
denn noch ist die
Achse
nicht mit dem
Drehgestellrahmen
verbunden worden und das war bekanntlich erforderlich, denn die
Lokomotive
sollte ja nicht von den Achsen fallen. Bei jedem Achslager wurden zwei Federn eingebaut. An Stelle der hier oft verbauten Schraubenfedern kamen erstmals die neuartigen Flexicoilfedern zum Einbau.
Wichtig waren diese, weil die
Federn das seitliche Spiel der
Achsen
mit Torsion ausgleichen mussten. Hier sollten sich die neuen
Federn
deutlich besser zeigen, als das bei den üblichen
Schraubenfedern
der Fall war. Die anderen Eigenschaften blieben jedoch gleich.
Daher waren auch die
Flexicoilfedern
mit einer kur-zen Schwingungsdauer behaftet. Ohne entsprechende Massnahmen
konnten sich diese
Federn aufschaukeln, was zu einem unruhigen Fahrverhalten
führte. Um dies zu verhindern mussten
Dämpfer
verbaut werden. Hier waren diese aber nur bei den beiden Endachsen
vorhanden und daher müssen wir einen etwas genaueren Blick auf die
mittlere
Achse
werfen, denn die war leicht anders.
Damit dieser Effekt nicht durch einen
Dämpfer
behindert wurde, musste auf die
Stossdämpfer
verzichtet werden. Auf das Fahrverhalten der
Lokomotive
wirkte sich das jedoch nicht negativ aus, da das
Drehgestell
mit den Endachsen geführt wurde. Auch wenn die Flexicoilfedern gut waren, die Achsen waren damit noch nicht im Rahmen geführt worden. Dazu waren an den Gehäusen der Achslager Lenker eingebaut worden.
Diese führten die
Achsen
im
Drehgestellrahmen
und sie liessen nur das seitliche Spiel und die vertikalen Bewegungen zu.
In der Längsrichtung war eine starre Führung vorhanden. Diese verhinderte
auch eine passive radiale Einstellung der
Radsätze.
Das so aufgebaute
Drehgestell
musste unter der
Lokomotivbrücke
eingebaut werden. Auch hier war eine
Federung
mit jeweils zwei
Flexicoilfedern
verbaut worden. Dank dieser zweistufen Federung bekamen die
Lokomotiven
ein ruhige Fahrverhalten. Der Abstand der beiden Drehpunkte wurde mit
8 620 mm angegeben und er war recht gering ausgefallen. Auch daher konnten
sehr enge
Kurven
und
Kuppen
mit der Lokomotive befahren werden.
Einen
Drehzapfen
gab es jedoch hier nicht mehr. Das
Drehgestell
wurde durch die Rückstellkraft der
Flexicoilfedern
unter der
Lokomotive
zentriert. Möglich wurde dies, weil die
Zugkräfte
nicht über diese Stelle übertragen wurden. Zudem wurden die beiden
Drehgestelle mit einer
Querkupplung
versehen. Diese sollte die Führungskräfte des Drehgestells verringern und
so auch der Verschleiss an den
Spurkränzen
verringern.
Auch wenn hier viele Massnahmen zur Verringerung umgesetzt wurden,
die beiden
Baureihen
erreichten die Bedingungen für die
Zugreihe R
nicht. Alleine durch die fehlende radiale Ein-stellung waren die Kräfte
immer noch zu hoch. Da beide Modelle jedoch nur für eine
Höchst-geschwindigkeit
von 85 km/h ausgelegt wurden, war das kein so grosses Problem. Jedoch
zeigte sich hier auch, dass es
Rangierlokomotiven
im eigentlichen Sinn waren.
Wobei wir aktuell nicht von
Lokomotiven
sprechen dürfen. Wir haben lediglich den Kasten auf dem
Laufwerk
abgestellt. So aufgebaut entspricht das Fahrzeug eher einem Wagen. Um
daraus eine Lokomotive zu machen, muss ein
Antrieb
verbaut werden. Mit der
Achsfolge
Co’Co’ können wir zudem erkennen, dass jede über einen eigenen Antrieb
verfügte. Da diese gleich aufgebaut wurden, beschränken wir uns auf eine
Achse.
Jede
Achse
war mit einem
Tatzlagerantrieb
versehen worden. Bedingt durch die geringe
Höchstgeschwindigkeit
und die leichten Motoren, war dieser einfache
Antrieb
vertretbar. Dabei wurde der Motor mit Hilfe von
Rollenlager
auf der Achse und mittels flexibler Elemente am
Drehgestellrahmen
abgestützt. Das führte dazu, dass der Motor zur ungefederten Masse
gehörte. Um optimal zu arbeiten, waren alle im
Drehgestell
auf der gleichen Seite eingebaut worden.
Das vom Motor erzeugte
Drehmoment
wurde mit einem
Getriebe
auf die
Achse
übertragen. Dabei war das Ritzel mit einer
Federung
versehen worden. Diese war wichtig um die
Dreh-momentpulsation
der Motoren aufzufangen und so vom Getriebe fern zu halten. Auch wenn hier
mit
Drehstrom
gearbeitet wurde, konnte dieser Effekt ebenfalls auftreten. Sie sehen,
dass man auch einen möglichst geringen Verschleiss an den Bauteilen
achtete.
Das
Getriebe
selber lief in einem geschlossenen Gehäuse und es wurde auf die übliche
Weise geschmiert. Das
Öl
lagerte in einer Wanne und wurde vom
Zahnrad
aufgenommen. So gelangte dieses auf das Ritzel und durch die Fliehkraft
wurde überschüssiges Öl an die Wand geschleudert. Das bei den ersten
Modellen um 1900 ausgedachte Prinzip war so gut, dass die Art der
Schmierung
bis zu dem Tag nicht verändert wurde.
Wichtiger war jedoch die im
Getriebe
vorhandene
Übersetzung.
Diese wandelte das
Dreh-moment
so um, dass die Drehzahl verringert wurde und die Kraft anstieg. Hier
wurde diese Übersetzung mit
1 :
7.69 angegeben. Ein Wert, der jedoch nur für die Kraft, jedoch nicht
für die Drehzahl stimmte. Jedoch waren solche Angaben bei den
Lokomotiven
durchaus üblich. Es gab daher keinen Unterschied zu den anderen
Baureihen.
Mit dem
Getriebe
wurde das umgewandelte
Drehmoment
auf die
Achse
und somit auf die
Räder
übertragen. In diesen wurde mit Hilfe der
Haftreibung
zwischen
Lauffläche
und
Schiene
das Drehmoment in
Zugkraft
umgewandelt. Über die an den
Lagern
vorhandenen Führungen gelangte die Zugkraft auf das
Drehgestell.
Noch müssen wir und den Weg ab diesem auf die
Lokomotivbrücke
ansehen, denn dazu fehlte der
Drehzapfen.
Der Unterschied bestand darin, dass hier die Stangen so-wohl auf
Zug- als auch auf
Stosskräfte
belastet wurden. Der tiefe Angriffspunkt war auch hier vorhanden und so
wurde das
Drehgestell
nicht entlastet.
Nicht von der
Lokomotive
und der
Anhängelast
benötigte
Zugkraft
wurden wiederum in Beschleunigung umgewan-delt. Es waren hier also die
natürlichen Effekte vorhanden und das galt auch für den Zustand der
Schienen.
Bei einer schlechten Ausnutzung der
Adhäsion
konnte die Zugkraft in sich zusammen fallen. Daher mussten geeignete
Massnahmen dagegen vorgenommen worden und die Lenkstangen reichten nicht
aus.
Aus diesem Grund wurden, wie das auch bei den anderen
Baureihen
üblich war, einfache
Sandstreueinrichtungen
eingebaut. Bei diesem wurde mit der Hilfe von
Druckluft
aus einem Behälter
Quarzsand
auf die
Schienen
geblasen. Dadurch konnte die
Haftreibung
verbessert werden. Damit wirklich gute Ergebnisse vorhanden waren, wirkten
die Einrichtungen jeweils auf die vorlaufende
Achse
jedes
Drehgestells.
Es waren also vier Achsen damit versehen worden.
Damit haben wir das
Drehgestell
fertig aufgebaut. Dieses hatte alleine ein Gewicht von 22 Tonnen erhalten
und stellte damit einen grossen Teil des Gewichtes dar. Wir hingegen sind
damit bei dem Abmessungen angelangt, denn die
Lokomotive
steht nun auf den eigenen
Rädern
und daher können auch die Höhen bestimmt werden. Bei diesen gab es
zwischen den beiden
Baureihen
Unterschiede, die wir ansehen müssen.
Sie
waren daher so hoch, dass darüber kaum was von der Strecke erkannt werden
konnte. Bedingt durch die Länge, entstand eine sehr unübersichtliche
Lokomotive,
bei der vom
Führerstand
aus, die
Puffer
nicht zu erkennen wa-ren.
Wenn wir nun zur
Lokomotive
Ee 6/6 II kommen, dann fällt auf, dass diese mit einer kompletten Höhe von
4 550 mm deutlich höher war, als das Modell mit
Dieselmotor.
Der Grund für diesen Unterschied war, dass das Dach gleich hoch war und
hier darauf noch die Ausrüstung für den elektrischen Betrieb aufgebaut
werden musste. Sie sehen, dass sich der veränderte Aufbau durchaus auch
negativ für die elektrische Variante auswirken konnte.
Auch wenn wir die bei der
Baureihe
Am 6/6 auf den
Vorbauten
vorhandenen Aufbauten ausblenden, waren die Vorbauten bei der Reihe Ee 6/6
II mit 3 190 mm etwas tiefer. Da es jedoch keine grosse Differenz war,
änderte sich an der Übersicht nichts. Auch hier haben wir eine Maschine
erhalten, bei der die
Puffer
und somit das Ende nicht erkannt werden konnten. Das war immer ein Problem
von zentralen
Führerhäusern
und nicht der beiden Baureihen.
Zum Schluss bleiben wir noch etwas bei der Sicht vor die
Lokomotive.
Diese war bei der
Baureihe
Ee 6/6 II auf beide Seiten schlecht. Bei der
Diesellokomotive
Am 6/6 wurde das Haus etwas nach vorne verschoben. Daher änderte sich dort
der Winkel etwas und so konnte zumindest in einer Richtung erahnt werden,
wo sich die
Puffer
befinden. Rückwärts war es jedoch noch schlimmer und das gerade im
Rangierdienst,
wo viel Personal im
Gleis
arbeitet.
|
|||||||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||||||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||||||||
|
Copyright 2025 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||||||||
 Diese
wurden auch bei der
Diese
wurden auch bei der
 Jede
Jede
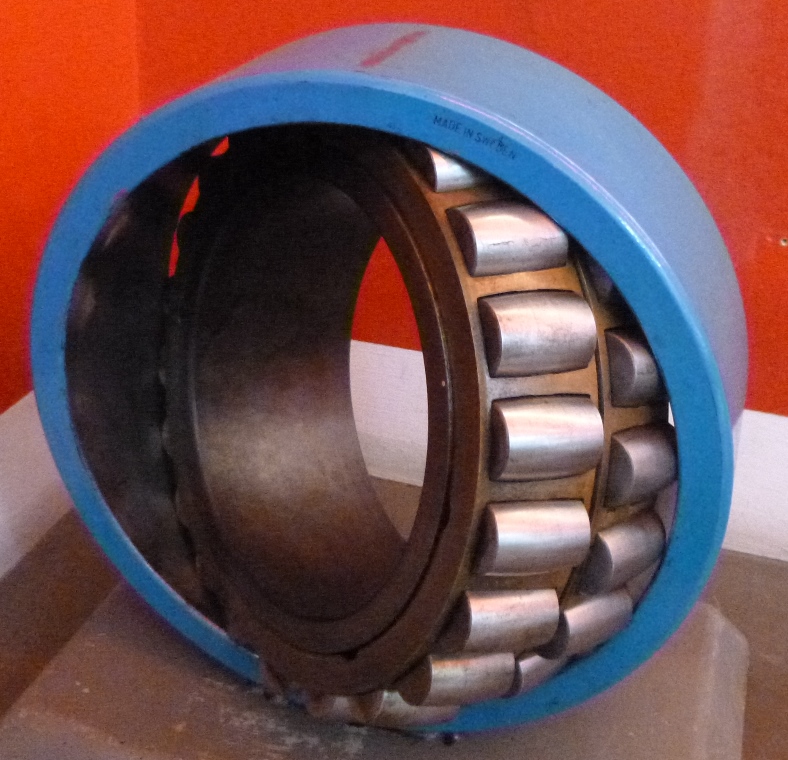 Das
bei der mittleren
Das
bei der mittleren
 Um
mit der
Um
mit der
 Gerade
der Verschleiss der
Gerade
der Verschleiss der
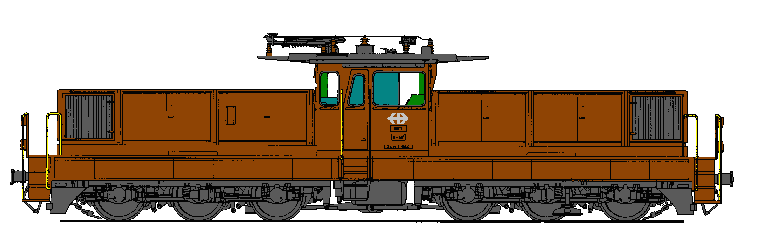 Die
im
Die
im
 Bei
Bei