|
Ablieferung und Überführung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Ein Thema, das bisher eher nebensächlich
war, ist die Ablieferung der Fahrzeuge. Das Fahrzeug wurde gebaut, im Werk
kurz geprüft und dann dem späteren Besitzer übergeben. Das war hier
eigentlich nicht anders, aber trotzdem gab es ein Problem, denn es stellte
sich die Frage, wo der Kunde das Fahrzeug übernehmen soll und in welchem
Zustand sich dieses befinden musste. Bei
Privatbahnen
war das meist eine Grenze der Anlagen.
Danach verschob man es mit der
Werkslokomotive über das vorhandene
Anschlussgleis
in den nächsten
Bahnhof.
Dort wurde dann die Übergabe durchgeführt und so hatten die Maschinen in
diesem Punkt Orte, wie Seebach, Mün-chenstein oder Meyrin. Diesmal bestand jedoch das Problem, dass der Hersteller in Spanien war. Deshalb wurden auch die Formalitäten im Werkvertrag geregelt. Dort stand, dass jede neu gebaute Lokomotive an einem bestimmten Schweizer Grenzbahn-hof übergeben werden soll. Das war durchaus üblich und bedeutete, dass
der Trans-port dorthin vom Hersteller zu besorgen ist. Für den Laien
stellt sich natürlich die Frage nach dem Problem, denn bei den Autos geht
das doch einfach. Klar klappt es bei den Autos. Die werden auf Bahnwagen, oder auf LKW in die Schweiz transportiert, dort für den Handel vorbereitet und dann Ihrem Händler ausgeliefert. Das funktionierte auch, wenn das Auto bei
einer in Spanien ansässigen Marke gebaut wurde. Das Problem bei dieser
Lokomotive war, dass sie fertig montiert, ein Gewicht von
72 Tonnen hatte. Zudem war sie mit den Abmessungen auch nicht gerade mit
einem Auto zu vergleichen. Als Transportwege boten sich zwei
Möglichkeiten an. Darunter befand sich auch der LKW. Ein Spezialtransport,
der jedoch nicht leicht zu planen gewesen wäre. Die schwere Ladung hätte
nur auf spezielle Fahrzeuge verladen werden können. Danach war der Weg
über die Strassen zu finden. Mit den Abmessungen waren viele Strassen
nicht passierbar. Zudem hätten mit den LKW auch die Pyrenäen überquert
werden müssen.
Viele Fragen, deren Lösung jedoch noch
einfach war, denn in Frankreich passte die
Spurweite.
Das war in Spanien nicht der Fall, denn dort fuhr man auf
Breitspur. So gesehen, war der Weg auf der Schiene ein-facher, auch wenn es wegen der fehlenden Zulass-ung in den Ländern Probleme gab. Doch wenn wir bei den Problemen sind, diese gab es sogar noch vor dem Transport zu lösen. Dazu müssen wir in das Werk des Herstellers
wech-seln. Für diesen war damals die Lieferung einer
Lokomotive für
Normalspur
auch etwas neues und so gab es im Werk auch keine passende Anlage, die man
nutzen konnte. Im Herstellerwerk war jedoch schnell ein spezielles Gleis mit Normalspur vorhanden. Auf eine passende Fahrleitung musste man ja nicht achten. So genügte es, wenn man ein
Gleis
hatte. Das bedeutete, dass die
Lokomotive ganz normal endmontiert werden konnte. Die
Probefahrten
und ersten Einstellungen fanden auf dem eigenen Gleis des Herstellers
statt. Somit war nun in Spanien eine fertige und geprüfte Lokomotive, die
in die Schweiz musste. Die nun betriebsbereite und fertige
Lokomotive, musste nun den Weg in die Schweiz unter die
Räder
nehmen. Genau dort begannen jedoch ersten die Probleme. Genau genommen,
begannen diese Schwierigkeiten schon im Werk. Ausser dem erwähnten Gleis,
gab es keine Möglichkeit, mit der Lokomotive auch nur einen Meter zu
fahren. Die
Spurweite
der neuen Lokomotive passte einfach nicht zu der in Spanien verwendeten
Breitspur.
Ein Strassentransport mit der fertigen Lokomotive hätte eine Höhe von fast 5 Meter erreicht, was wegen einigen Tunnel und Unterführungen auch nicht ging. Es blieb so nur noch die
Schiene,
die jedoch nicht passte. Nur, was nicht passt, wird bekanntlich pas-send
gemacht und so eine Lösung gefunden. Die fertige und geprüfte Lokomotive wurde im Her-stellerwerk für den Transport wieder zerlegt. Wo-bei diese Zerlegung nicht so umfangreich war, wie man meinen könnte. So wurden zuerst alle nicht zum Profil in Frank-reich und Spanien passenden Teile entfernt. Dazu gehörten zum Beispiel die Empfänger für die in der Schweiz verwendeten Zugsicherungssysteme. Zudem wurden die normalen
Drehgestelle auch de-montiert und auf einem Wagen
der RENFE verladen. Deren
Bauart
war durchaus auch in Europa üblich, denn es waren einfache
Flachwagen.
Eine
Teilung
des Transports war jedoch nicht möglich, die die Wagen als Bremswagen
genutzt wurden. Anschliessend wurde die neue
Lokomotive auf spezielle Hilfsdrehgestelle der RENFE
abgestellt. So war die eigentliche Lokomotive in der Lage das 1 676 mm
breite Breitspurnetz von Spanien zu befahren. Damit stand die neue
Maschine für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nun auf einem
Gleis
mit
Breitspur
und so auf einer
Spurweite,
die es in der Schweiz nicht gab. Eine Neuerung, die aber keine Rolle
spielte, denn es war ein Frachtstück. Da man in Spanien jedoch die gleichen
Kupplungen
und
Puffer,
wie bei den Bahnen mit
Normalspur
hatte, konnte die
Lokomotive mit dem
Flachwagen
normal gekuppelt werden. Dieses aus zwei Fahrzeugen bestehende Frachtstück
konnte so in ganz normalen
Güterzügen
der RENFE eingereiht werden. Damit war das Problem mit dem Transport
zumindest auf der ersten Etappe gelöst und die Lokomotive gelangte ohne
eigene
Bremse mit den
Drehgestellen an die französische Grenze.
Port Bou ist eine der Trennstellen zwischen
der spanischen
Breitspur
und der europäischen
Normalspur.
Viele Güter, die mit der Bahn transportiert werden, müssen hier umgeladen
werden. Vereinzelt kamen aber auch spezielle Wagen zum Einsatz. Für die Fahrzeuge mit umspurbaren Drehgestellen waren im Bahnhof von Port Bou die entsprechenden Anlagen vorhan-den. Jedoch konnte der Transport in die Schweiz diese nicht nutzen. Sowohl die
Lokomotive, als auch der
Flachwagen
mit den beiden
Drehgestellen konnten nicht auf die neue
Spurweite
umgestellt werden. Somit war vorerst die Reise zu Ende. Man musste nun den
Transport verändern und somit die Lokomo-tive umbauen. Die auf dem Flachwagen mitgereisten Drehgestelle wurden abgeladen und auf einem Gleis mit Normalspur abgesetzt. Anschliessend wurde die Lokomotiven mit Hilfe von zwei Strassenkränen ab den spanischen Hilfsdrehgestellen gehoben. Die beiden
Kräne
versetzten die Maschine so, dass sie nun wieder auf den eigenen mit dem
Drehzapfen
geführten
Drehgestellen stand. Diese wurden nun mechanisch
wieder so montiert, dass die Weiterfahrt geschleppt möglich wurde. Das
bedeutete, dass die Leitungen für die
Druckluft
nicht verbunden wurden. Daher konnte die
Lokomotive auch bei den
Normalspurbahnen
nicht gebremst werden.. Die dazu erforderlichen Arbeiten wurden von
Leuten des Herstellers vorgenommen. Eine Umbauaktion, die wegen den
Strassenkränen unter freiem Himmel erfolgen musste. Bei Regen sicherlich
keine angenehme Situation für die beteiligten Arbeiter. Sie müssen wissen,
dass diese Aktion bei jeder
Lokomotive ausgeführt werden musste und warten, bis das
Wetter passte, war nicht vorgesehen. Das Transportgut sollte so schnell
wie möglich die Schweiz erreichen.
Die Maschine in Port Bou wurde, wieder in
Güter-zügen,
durch Frankreich geschleppt und erreichte so letztlich Basel und damit
einen
Bahnhof
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Es überrascht Sie vielleicht, dass nicht
das wesentlich nähere Genève, als Ziel des Transportes gewählt wurde.
Jedoch war das im Werkvertrag so geregelt worden. Doch auch jetzt war die
Reise vorerst beendet. Dabei waren jedoch nicht technische Punkte das
Problem. Da die
Lokomotive in Spanien gebaut wurde, musste sie in der
Schweiz eingeführt werden. Daher stand nun die zolltechnische Behandlung
des Frachtstückes an. Erst jetzt ging die Verantwortung für den
Transport an den späteren Besitzer und somit an die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB über. Die Reise in der Schweiz konnte jedoch nicht in
eigener Kraft erfolgen. So fehlten noch die demontierten Teile und die
Drehgestelle waren bekanntlich nur mechanisch mit
dem Rest des Fahrzeuges verbunden worden. Das Ziel der neuen
Lokomotive sollte der
Bahnhof
von Winterthur sein.
Dieser erreichte letztlich den Bahnhof Winterthur Wülflingen und somit den Rangierbahnhof der Stadt im Kanton Zürich. Dort wurde das Frachtstück aus Spanien
letztlich dem
Anschlussgleis
der Schweizerischen Lokomo-tiv- und Maschinenfabrik SLM zugestellt. Im Werk der SLM sollte schliesslich die Endmontage der Lokomotive erfolgen und somit auch die letzten Leitungen und Verbindungen verbunden werden. Speziell an dieser Situation war, dass ausgerechnet die SLM bei der Vergabe des Auftrages an der Lokomotive aus Spanien gescheitert war. Nun oblag es dem dortigen Werk, die
Maschine für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB fertig zu stellen.
Sicherlich nicht leicht für die Arbeiter dort. Damit war der Transport jedoch abgeschlossen, so dass die Lokomotive an die Schweizerischen Bun-desbahnen SBB übergeben werden konnte. Daher war letztlich auch für die in Spanien
hergestellte
Dieselelektrische Baureihe Am 841 der Übergabebahnhof in der
Schweiz und mit Winterthur in dem
Bahnhof,
den bisher sehr viele halbfertige
Lokomotiven verlassen hatten. Die SLM war schliesslich nur
bei Dampflokomotiven alleiniger Hersteller gewesen, Dieser
Ablauf
der Arbeiten wurde 40x wiederholt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bei
den Schweizerischen Bundesbahnen SBB war das eigentlich nicht anders. Das
neue Fahrzeug wurde bei einem der Hersteller montiert und einer kurzen
Prüfung unterzogen.
Bei
den Schweizerischen Bundesbahnen SBB war das eigentlich nicht anders. Das
neue Fahrzeug wurde bei einem der Hersteller montiert und einer kurzen
Prüfung unterzogen. Einfacher
erscheint daher der Transport auf den eigenen
Einfacher
erscheint daher der Transport auf den eigenen  Die
72 Tonnen schwere
Die
72 Tonnen schwere
 Ziel
des in Spanien verkehrenden
Ziel
des in Spanien verkehrenden
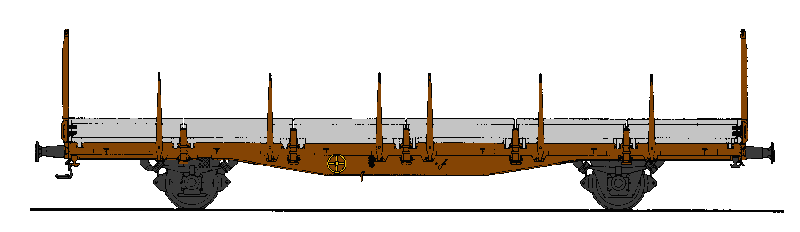 Nach
Abschluss dieser Arbeiten, wurden die Hilfs-drehgestelle auf den
Nach
Abschluss dieser Arbeiten, wurden die Hilfs-drehgestelle auf den
 Die
geschleppte
Die
geschleppte