|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Sowohl die
Beleuchtung, als
auch die Steuerung, sind zwei Bereiche auf einer
Lokomotive, die von der
Versorgung aus der
Fahrleitung unabhängig arbeiteten. Es macht bekanntlich
durchaus Sinn, wenn in der Nacht der Fehler, der verhindert, dass man die
Maschine einschalten kann, mit Licht sucht. Aber auch der Befehl die
beiden
Stromabnehmer zu heben, kann nur erfolgen, wenn die Lokomotive
ausgeschaltet war.
Diese mussten aber mit elektrischem
Strom versorgt werden. Daher benötigte
die Maschine ein
Bordnetz, dass dafür sorgte, dass das Licht nicht so
schnell aus ging. Da die erforderliche Energie auf der Lokomotive gespei-chert werden musste, war ein Speicher erforderlich. Da man damals jedoch nur Gleichstrom speichern konnte, kam dieses Stromsystem bei der Beleuchtung und bei der Steuerung zur Anwendung.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beeinflussten die
Hersteller so, dass hier eine bei allen Baureihen einheitliche
Batterien
von 36
Volt verwendet wurde.
Auch wenn es sich hier um ein
Bordnetz handelt, damals kannte man den Begriff noch nicht. Daher wurde es
als
Steuerstromnetz bezeichnet. Auch wenn sie nicht enthalten war, die
Beleuchtung gehörte in diesem Bereich dazu und es lohnt sich, wenn wir
dieses
Stromnetz bei der Versorgung ab dem Speichermedium etwas genauer
ansehen werden. Dabei kann ich jedoch versichern, die grossen Wunder
werden nicht zu erwarten sein.
Beim Speichermedium gab es
damals für Fahrzeuge nur eine brauchbare Lösung. Das waren die
Bleibatterien. Diese konnten in einer Zelle mit zwei Platten aus Blei und
einem Elektrolyt aus einer verdünnten Säure eine
Spannung von zwei
Volt
abgegeben. Bei den Bahnen verwendete man dazu genormte Behälter, die neun
solcher Zellen enthielten. Daher entstanden
Batterien, die über eine
Spannung von 18 Volt verfügten.
Trotzdem reichte die
Leistung der
Batterien nur für
den Betrieb der ausgeschalteten
Lokomotive währ-end rund 60 Minuten. Das
reichte durchaus um die Maschine einzuschalten. Um die Batterien wieder zu laden, musste an den Anschlüssen einfach eine höhere Spannung angelegt werden. Diese stammte bei der Lokomotive Ae 3/5 von einem Umformer. Dieser wurde von den Hilfsbetrieben versorgt und der Generator erzeugte eine Spannung, die bei einem Wert von 38 bis 40 Volt lag.
Da die
Leistung der
Umformergruppe für die Ver-sorgung ausreichte, wurden die
Batterien
automa-tisch geladen. Einen Nachteil hatten diese Bleibatterien jedoch. Sie benötigten einen gewissen Unterhalt und währ-end der Batterieladung entwich Wasserstoff.
Dieses
Gas vermischte sich mit der Luft
und es entstand Knallgas. Ein Funke reichte in dem Fall aus, dass die
Batterie explodierte. Ein Umstand der beim Einbau dieser Batterien
beachtet werden musste, denn geschlossene Räume waren besonders gefährdet.
Bei der
Lokomotive musste zudem der Wechsel berücksichtigt werden.
Der Hersteller hatte aus seiner
ersten
Lokomotive gelernt. Da bei der Reihe Ae 3/5 auch der Platz fehlte,
wurden die
Bleibatterien wieder ausserhalb der Maschine montiert. Um dabei
die
Achslasten zu berücksichtigen, wurden jedoch die beiden
Batterien an
unterschiedlicher Stelle eingebaut. So wurde bei jedem
Führerstand auf der
rechten Seite unter dem Kasten ein kleiner
Batteriekasten für eine
Bleibatterie angeordnet.
Diese
erlaubten, dass die schweren
Batterien von Hand auf den Deckel gezogen
werden konnten. Damit dieser die schwere Last jedoch tragen konnte, wurden
seitlich Ver-strebungen und Verstärkungen verwendet. Eine Lösung, die einen einfachen Wechsel der Behälter er-laubte. In diesem Punkt entsprach die Lokomotive den ander-en Baureihen und die Lösung bei der Reihe Be 4/7 wurde nicht mehr verwendet.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB führten
daraufhin spezielle Hebegeräte ein. Diese waren in den
Depots und bei
grösseren
Bahnhöfen vorhanden. So konnte auch in einem Bahnhof eine
defekte
Batterie leicht gewechselt werden.
Kommen wir zu den
angeschlossenen Verbrauchern. Dabei wurde die
Beleuchtung direkt an der
Batterie angeschlossen. Die einzelnen Lampen konnten mit Schaltern
beleuchtet, oder gelöscht werden. Wurde jedoch bei der abgestellten
Lokomotive eine Lampe vergessen, konnte diese die Batterien entladen.
Dazu reichten wenige
Ampère.
Damit konnte jedoch die Maschine nicht mehr in Betrieb genommen werden.
Die Batterien mussten ersetzt, oder mit dem
Depotstrom geladen werden.
Wurde dieser geschlossen, wurde nur noch
ein Lichtstrahl erzeugt, der den Bereich mit den Bedienelementen
ausleuchtete. Eine Lösung für die
Beleuchtung der
Instru-mente, die damals
bei allen Baureihen verwendet wurde. Auch die Dienstbeleuchtung, also die Lampen an den beiden Fronten, wurde über die Batterien versorgt. Es wurden dafür Laternen verwendet. Dabei wurden zwei auf gleicher Höhe über den Puffern an der Front montiert.
Die dritte Lampe befand sich an
der Türe und fand ihren Platz unter dem Fenster. Damit entstand ein
Signalbild, das die Form eines A hatte. Im jeweiligen
Führerstand waren
die drei erforderlichen Schalter vorhanden. So konnten die Lampen der Stirnbeleuchtung nur weiss leuchten. Um die in der Schweiz erforderlichen Signalbilder mit farbigen Lichtern und Signaltafeln zu signali-sieren, konnten Vorsteckgläser verwendet werden.
Diese waren bei den Lampen in
einem Fach vorhanden. Dabei wurden diese bei den unteren beiden Laternen
vom Boden aus eingesteckt. Bei der oberen Lampe, musste jedoch die
Fronttüre geöffnet werden. Damit können wir die Beleuchtung abschliessen und uns dem zweiten Teil der an den Batterien angeschlossenen Teil zuwenden. Dabei wurde die Steuerung jedoch mit ein-em Hauptschalter versehen.
Dieser war erforderlich, damit die
Lokomotive bei
geschleppter Überführung be-leuchtet werden konnte und die Steuerung dabei
nicht aktiv war. So war gesichert, dass in diesem Fall nicht ungewollt ein
Bereich aktiviert wurde. Die grundlegenden Aufgaben der Steuerung wurden auch hier nicht verändert. So wurden die im Führerstand erteilten Befehle mit der Hilfe von elektrischen Signalen übermittelt.
Dabei waren jedoch die Schaltungen
mit einem
Damit wurde ein Signal zum
Hauptschalter
übertragen. Dieses wurde jedoch nur weitergeleitet, wenn auch die
Stromabnehmer gehoben waren. Sofern dies nicht der Fall war, passierte
somit beim Hauptschalter nichts. Trat jedoch die Situation ein, dass zwar der Befehl zum Heben der Stromabnehmer erteilt wurde und diese den Fahrdraht noch nicht erreicht hatten, reagierte die Steuerung.
Es
konnte aber auch sein, dass die
Fahrleitung keine
Spannung führte. Der
Hauptschalter wurde nun einge-schaltet und gleichzeitig ein
Relais
aktiviert. Dieses prüfte nun, ob die Spannung vorhanden ist und ob deren
Wert mit den eingestellten übereinstimmt. War die Spannung auch nach der eingestellten Wartezeit nicht vorhanden, wurde der Hauptschalter wieder ge-öffnet. Die Wartezeit war nötig, damit ein kurzer Unterbruch nicht dazu führte, dass der Hauptschalter geöffnet wurde.
Solche Ausfälle gab es,
wenn die
Stromabnehmer den Kontakt mit der
Fahrleitung für kurze Zeit
verloren. Ein Phänomen, dass Sie anhand der entstehenden Funken leicht
erkennen können.
Weitere
Relais überwachten
andere Bereiche, wie die erlaubten
Ströme. Wurden die eingestellten Werte
überschritten, schaltete der
Hauptschalter aus. Das Relais stellte sich
dadurch jedoch wieder zurück, da ja nun der Strom unter dem Wert lag.
Damit das Fahrpersonal erkennen konnte, welches Relais angesprochen hatte,
war eine Meldeklappe vorhanden. Diese konnte nur manuell in die
ursprüngliche Position verbracht werden.
Dadurch wurde der
Hauptschalter jedoch durch das
Relais für die minimale
Spannung
ausge-schaltet. Ein erneutes Einschalten war jedoch nicht mehr möglich, da
das
Blockierrelais manuell zurückgestellt werden musste. Sie sehen, es gab eine Vielzahl von Überwachungen, die den Hauptschalter beeinflussten. Jedoch führte die Steuerung auch Aufgaben aus, die diesen nicht betrafen. So etwa die automatische Druckregelung für den Kompressor.
Diese regelte den
Luftdruck
automatisch zwischen sechs und acht bar. Eine Erleichterung für das
Bedienpersonal. Jedoch konnte dieses den Druck auch manuell regeln und so
die Steuerung umgehen. Nicht umgangen werden konnte jedoch die Steuerung der Fahrstufen. Welche davon eingestellt wurde, gab der Lokführer vor. Welche Hüpfer in diesem Fall geschlossen sein mussten, regelte die Steuerung.
Diese
Hüpfersteuerung war in einer Matrix
festgelegt worden. Anhand dieser konnte bei einem Problem der von einem
Defekt betroffene
Hüpfer gefunden werden. Die Behebung der Störung war
jedoch Aufgabe des Personals. Die Baureihe Ae 3/5 wurde im Vergleich zu anderen Lokomotiven, welche über Stufenschalter verfügten, mit einer flinken und schnell regulierbaren Hüpfersteuerung versehen, die über sehr wenige Bauteile verfügte.
Dadurch neigte diese zwar zu weniger Störungen, es konnte jedoch
bei einem Defekt nur noch eine bestimmte Zeit gefahren werden, da in dem
Fall die
Überschaltdrosselspulen längere Zeit einseitig belastet wurden.
Das war jedoch ein Notbetrieb.
Andere Notsituationen, wie die
Kontrolle eines Ausfalls des Bedienpersonals, waren hier nicht mehr
vorhanden. Damals wurden zwar erste
Triebwagen mit einem
Totmannpedal an
die Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgeliefert. Auf den im gleichen
Zeitraum ausgelieferten
Lokomotiven wurde jedoch auf diese Einrichtung
verzichtet. Hier sollte weiterhin mit zwei Mann
Lokomotivpersonal gearbeitet
werden. Ein Punkt, der uns aber zur Bedienung bringt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
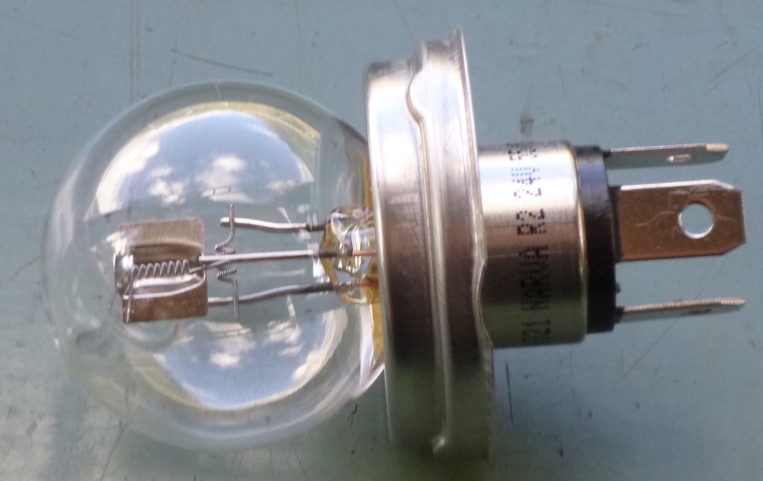 Während man bei den
Dampflokomotiven die
Während man bei den
Dampflokomotiven die
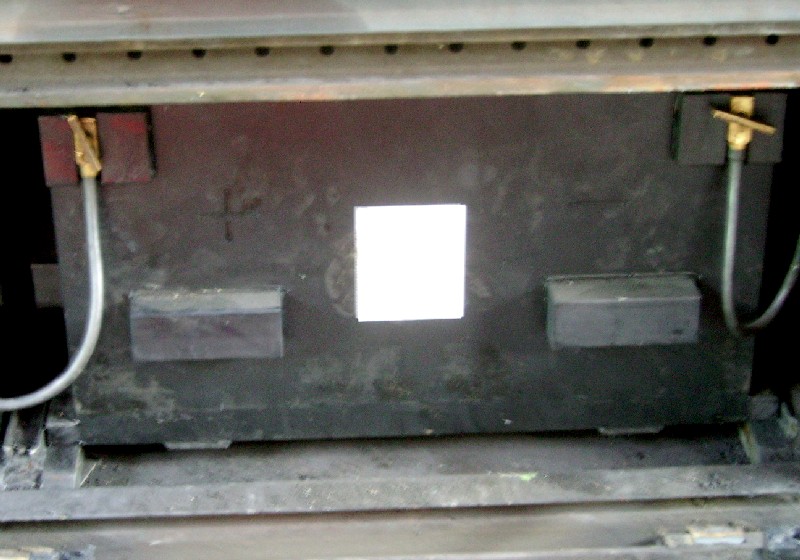 Wurden zwei solche Behälter in
Reihe geschaltet, entstand die erforderliche
Wurden zwei solche Behälter in
Reihe geschaltet, entstand die erforderliche  Verschlossen wurde dieser
Verschlossen wurde dieser

 Sehen wir uns diese Überwachung
an. Als Beispiel soll der
Sehen wir uns diese Überwachung
an. Als Beispiel soll der
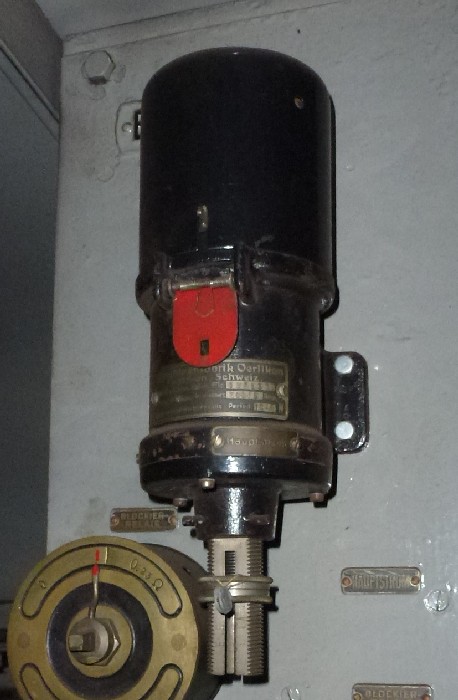 Einzig das
Einzig das