|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie seit der Einführung der
Druckluftbremsen
bei allen
Lokomotiven,
musste auch diese hier auf der Lokomotive hergestellt werden. Wegen den
bei den
Hilfsbetrieben
vorgenommen Änderungen konnten nicht mehr die Modelle, die bisher bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet wurden, benutzt werden. Das war
zwar wegen der Vorhaltung von Ersatzteilen ein Problem, konnte jedoch
nicht anders gelöst werden.
Mit Hilfe der von einem
Drehstrommotor
angetriebenen Schnek-ke wurde die Luft in die Leitungen geführt und dabei
auch ver-dichtet. Nach dem
Kompressor
kam es jedoch wieder zu einer Entspannung. Diese Entspannung der Luft führte nun dazu, dass diese Wasser ausschied. Dieses wurde hier mit einem Lufttrockner entnom-men und konnte anschliessend in einem Depot entsorgt werden.
Dabei war der verwendete Trockner jedoch so gut, dass er der Luft
zu viel Feuchtigkeit entnahm. Das war für die Dichtungen der Bauteile
jedoch nicht so gut. Daher wurde mit einem
Luft-öler
in geringen Mengen ein
Öl
der Luft beigemischt. Sowohl der Kompressor, als auch der Lufttrockner und der Luft-öler bildeten eine Einheit. Diese im Maschinenraum eingebaute Baugruppe zur Luftaufbereitung konnte daher nur als komplettes Bauteil entnommen werden.
Wegen dem Gewicht und den Abmessungen musste dazu jedoch das Dach
der
Lokomotive
entfernt werden. Sie sehen, es machte durchaus Sinn, dass dieses im
Bereich des
Maschinenraumes
leicht entfernt werden konnte.
Die so aufbereitete Luft wurde durch eine Leitung zu den
Hauptluftbehältern
geführt. In diesen Behältern war ein grosses Volumen vorhanden, das es
ermöglichte den
Kompressor
auch einmal nicht zu betreiben. Jedoch führte ein geringer Verbrauch bei
laufendem Kompressor dazu, dass der Druck im System auf einen zu hohen
Wert verdichtet werden konnte. Daher war zum Schutz ein
Überdruckventil
eingebaut worden.
Das
Ventil
schloss wieder und der Luftvorrat konnte so auf dem maximalen Wert
gehalten werden. Ein Prinzip, das ebenfalls schon so alt war, wie die
Erzeugung der
Druckluft
durch einen
Kompressor. Jedoch gab es auf dieser Lokomotive auch das übliche Problem bei einem zu geringen Vorrat. War dieser zu gering, konnte der Stromabnehmer nicht gehoben und der Hauptschalter nicht eingeschaltet werden.
Daher wurde ein
Hilfsluftkompressor
für diese bei-den Baugruppen eingebaut. Dieser musste bei einem Vorrat
unter sechs
bar
manuell durch den Lokführer aktiviert werden. So stand ab der
Batterie
genug
Druckluft
bereit. Sobald der normale Schraubenkompressor seine Ar-beit aufnahm, konnte der Hilfsluftkompressor wie-der abgestellt werden. Die Erzeugung der Druckluft war daher in jedem Fall über ein Gerät möglich.
Die bei älteren Modellen noch vom Personal gehasste
Handluftpumpe
war daher nicht mehr vorhanden. Ein System, das in Zukunft wieder
angewendet wurde und das später sogar den
Hilfsluftkompressor
automatisch aktivierte.
Es gab noch eine Möglichkeit auf der
Lokomotive
die
Druckluft
ohne den
Kompressor
zu ergänzen. Diese lernen wir kennen, wenn wir uns die an den
Hauptluftbehältern
angeschlossenen Leitungen ansehen. Bevor es jedoch so weit ist, muss noch
erwähnt werden, dass auch hier
Hauptluftbehälterhähne
vorhanden waren, die es erlaubte den Luftvorrat in den Luftbehältern auch
über eine längere Zeit zu speichern. Doch nun zu den Leitungen.
Sowohl die
Kupplung,
als auch die Hähne waren weiss gefärbt worden. Sie passten zu den anderen
Baureihen und so konnte der Luftvorrat über diese Leitung von einem
anderen
Triebfahrzeug
ergänzt werden. Auch bei der automatischen Kupplung war eine Verbindung für die Speiseleitung vorhanden. Diese wurde benötigt, da die Systeme für Druckluft in der Schweiz traditionell bei einer Vielfachsteuerung verbunden wurden.
Daher war es sogar möglich, ab dem zweiten
Pendelzug
die
Druckluft
zu ergänzen, jedoch musste dazu die
Vielfachsteuerung
ausgeschaltet werden, was einen grösseren Aufwand mit sich zog. Die zweite vorhandene Luftleitung war die Apparateleitung. Sie war nur auf dem Fahrzeug vorhanden und hatte keine anderen Anschlüsse bekommen. Auch der Anschluss erfolgte nicht direkt, sondern über ein Druckreduzierventil.
Das sorgte dafür, dass der
Luftdruck
in der
Apparateleitung
auf einen Wert von sechs
bar
begrenzt wurde. Hier wurden daher Baugruppen angeschlossen, die einen
genauen Luftdruck verlangten. Wie bei den Lokomotiven aus Schweizer Produktion schon lange vorhanden, wurden auch hier alle nicht an einen Ort gebundenen Ventile und Absperrhähne an einem zentralen Luftgerüst montiert.
Damit diese Einrichtung etwas moderner klang, wurde sie auf dieser
Lokomotive
als Pneumatiktafel bezeichnet. An der Funktion und der damit verbundenen
einfachen Bedienung bei der Inbetriebnahme und bei Störungen änderte sich
nichts.
Bevor wir uns dem wichtigsten Verbraucher, der
Bremsen
zuwenden, sehen wir ein paar andere Verbraucher an. Dabei galt auch hier,
dass viele Funktionen mit Hilfe der
Druckluft
betrieben wurde. Diese fanden sich sowohl bei der elektrischen Ausrüstung,
als auch im Bereich des
Führerstandes
mit den
Rückspiegel
und den
Scheibenwischern.
Andere Baugruppen, die schon angesprochen wurden, müssen aber noch erwähnt
werden.
Zum Schutz der
Spurkränze
und um deren Abnützung zu minimieren, wurde eine
Spurkranzschmierung
verbaut. Diese drückte mit Hilfe von
Druckluft
das in Behältern gelagerte
Schmiermittel
mit hohem Druck auf den gewünschten Bereich der Spurkränze. Wann diese
Schmierung
erfolgte, war in der Steuerung der
Lokomotive
geregelt worden, denn die Spurkranzschmierung wurde automatisch aktiviert
und konnte nur in der Werkstatt verstellt werden.
Auch die
Sandstreueinrichtung
wurde bereits beim
Fahrwerk
erwähnt. Diese war an jedem Ende der
Lokomotive
vorhanden. Dabei wurde der für diese Anlage benötigte
Quarzsand
in speziellen Behältern mitgeführt. Diese konnten in einem
Depot
von aussen befüllt werden. Dabei hatte der mitgeführte Sand wegen der
grossen Menge ein stattliches Gewicht erhalten. Doch uns fehlt noch die
Lösung, die den Sand vor die
Räder
brachte.
Der trockene Sand rieselte durch die Schwerkraft in ein
Ventil.
Dort wurde der Sand mit
Druckluft
durchmengt und das Ventil geöffnet. Dadurch wurde der
Quarzsand
durch die Leitung unmittelbar vor dem
Rad
auf die
Schienen
geblasen. So wirkte die Anlage deutlich besser, als wenn nur mit der
Schwerkraft gearbeitet werden musste. Der Grund war simpel, denn nun lag
der Sand unmittelbar von dem Rad und konnte so genutzt werden.
Diese werden wir später noch ansehen. Hier sollten wir uns aber
nun dem Bereich zuwenden, der die
Druckluft
erst auf die
Lokomotive
brachte. Das waren die pneumatischen
Bremsen
und davon gab hier einige. Wie bei allen mit einer Vielfachsteuerung versehenen Triebfahrzeugen der Schweiz, war auch hier eine Schleuderbremse eingebaut worden. Sie konnte entweder durch den Lokführer, oder durch den Schleuderschutz aktiviert werden.
Der Unterschied dabei bestand nur in der Tatsache, dass bei der
technischen Auslösung durch den
Schleuderschutz,
jede
Triebachse
einzeln mit der
Schleu-derbremse
eingebremst werden konnte. Die Funktion war jedoch sehr einfach. Entweder war diese Bremse gelöst, oder aber sie wurde mit einem Luftdruck von 0.9 bar angezogen. Andere Werte gab es nicht mehr und auch die erzeugte Bremskraft war eher be-scheiden.
Jedoch konnte so eine durchdrehende
Achse
abgefangen werden. Mit dieser
Schleuderbremse
war es jedoch auch möglich, die
Laufflächen
von Ver-schmutzungen, wie zum Beispiel nassem Laub, zu befreien.
Keinen Unterschied bei der Wirkweise gab es bei der neuen
Festhaltebremse. Diese wurde durch die Steuerung der
Lokomotive
aktiviert. Dazu mussten aber einige Bedingungen erfüllt sein. Die
gefahrene Geschwindigkeit lag unter 1 km/h und sowohl der V-Regler, als
auch der
Fahrschalter
befanden sich auf der Stellung 0. So war der
Triebzug
automatisch beim Stillstand ausreichend gesichert und konnte nicht
ungewollt losrollen.
Einen Einfluss auf diese Festhaltebremse, die bei späteren Baureihen auch vorhanden war, hatte der Lokführer jedoch nicht mehr.
Es handelte sich um eine technische
Bremse,
die auf ähnliche Weise funktionierte, wie das bei der
Schleu-derbremse
der Fall war. Mit den beiden direkten Bremsen, kommen wir zu den regulierbaren Lösungen. Dabei war auch hier eine nur auf die Lokomotive wirkende Rangierbremse vorhan-den. Sie wirkte auch auf die übliche Art und im Bremszylinder war ein maximaler Luftdruck von 3.2 bar möglich.
Das lag etwas unter den üblichen Werten, musste jedoch wegen den
mechanischen
Bremsen
so gewählt werden. Die
Rangierbremse
war daher im üblichen Stil aufgebaut.
Neu war hingegen die
EP-Bremse.
Diese
Bremse
wirk-te mit elektrischen Signalen und sie wurde durch den
Fahrschalter
und die V-Regelung aktiviert. Speziell war, dass diese Bremse auch auf die
Wagen wirkte. Dabei wurden die
Bremszylinder
mit den Signalen aktiviert. Die dazu benötigte
Druckluft
wurde auch bei den Wagen ab der
Speiseleitung
bezogen. Daher handelte es sich hier um eine direkte EP-Bremse, wie sie
bei
Triebzügen
üblich war.
Damit kommen wir zur aufwendigsten
Bremse.
Es handelte sich dabei um eine
automatische Bremse
der
Bauart
Oerlikon. Diese war mit der am Fahrzeug erfolgten Anschrift O-R-E leicht
zu erkennen. Die Wirkweise dieser Bremse entsprach der
Westinghousebremse.
Speziell war dabei nur, dass es sich hier nur noch um eine Bremse für den
Notfall handelte und sie eigentlich nur vorhanden war, um den Zug
abschleppen zu können.
Der dazu benötigte BV-Hahn war nicht mehr durch das Personal bedienbar. Sie sehen, dass hier eine deutliche Vereinfachung vorhanden war.
Das war auch zu erkennen, dass we-der der
Hochdruckfüllstoss
noch eine übliche
Niederdrucküberladung
mög-lich war. Die Hauptleitung wurde aber, wie das üblich war, durch den Zug geführt und stand daher am hinteren Ende in zwei identischen Luftschläuchen zur Ver-fügung.
Hier wurde für die
Kupplung
und die
Absperrhähne
jedoch eine rote Farbe verwendet. Auch in der
automatischen Kupplung
war der entsprechendes Anschluss vorhanden. So konnte die
Hauptleitung
auch bei in
Vielfachsteuerung
verkehren
Pendelzügen
genutzt werden.
Abgesenkt werden konnte der
Luftdruck
in der
Hauptleitung
durch ein einfaches
Bremsventil,
aber auch durch die
Notbremsen
auf der
Lokomotive
um im Zug. Zudem bewirkten auch die
Zugsicherung
und die
Sicherheitssteuerung
eine Entleerung der Hauptleitung. Die Funktion der Sicherheitsbremse war
daher weiterhin vorhanden, aber sonst wurde die
automatische Bremse
eigentlich nur benutzt, wenn es um die Berechnungen ging.
Der Hauptgrund für das neue
Steuerventil
war jedoch das geänderte Verhalten. Bei Aktivierung der
R-Bremse
wurde der
Luftdruck
nicht mehr erhöht, sondern verringert. Das mag Sie vielleicht überraschen,
war jedoch eine direkte Folge der hier verbauten
Bremsbeläge.
Diese werden wir später noch ansehen, denn zuerst befassen wir uns mit den
vom Steuerventil erzeugten Luftdrücken und den damit entstehenden
Bremsgewichte.
War die
Personenzugsbremse
bei einer Geschwindigkeit von weniger als 60 km/h aktiviert, war ein
maxi-maler
Luftdruck
in den
Bremszylindern
von 3.4
bar
möglich. Das nun für die Berechnung der
Bremsen
erforderliche
Bremsgewicht
wurde mit 58 Tonnen angegeben. Wenn wir nun die
Bremsrechnung
mit der
P-Bremse
ausführen, bekommen wir ein
Bremsverhältnis
von 74%. Ein eher geringer Wert, der aber bei
Lokomotiven
nicht selten war.
Das
Steuerventil
aktivierte die
R-Bremse,
wenn schneller als 60 km/h gefahren wurde. Ausgeschaltet wurde sie bei
einem Wert von 45 km/h. Durch die Umschaltung wurde nun der
Bremszylinder
nur noch mit einem
Luftdruck
von 2.2
bar
versorgt. Wegen den
Bremsbelägen
und deren Eigenschaften war aber ein
Bremsgewicht
von 78 Tonnen vorhanden. Das berechnete
Bremsverhältnis
für die
Lokomotive
bei vollem Gewicht betrug nun 100%.
Wir haben erkannt, dass die
Druckluftbremse
der
Lokomotive
eher bescheiden war. Aber vorher haben wir auch erfahren, dass die
automatische Bremse
nur im Notfall angewendet wurde. Dieser war auch vorhanden, wenn der
Pendelzug
abgeschleppt werden musste. Zum Schutz der
Bremsbeläge
war das
Steuerventil
so geregelt, dass nur der geringere
Luftdruck
vorhanden war. Das war jetzt aber auch bei tiefen Geschwindigkeiten der
Fall.
Schon zweimal wurden die speziellen
Bremsbeläge
erwähnt. Daher wird es Zeit, dass wir uns den mechanischen
Bremsen
zuwenden. Auch diese war gegenüber den anderen Baureihen verändert worden.
Der Grund kennen wir, denn wegen der hier vorhandenen radialen Einstellung
der
Radsätze
konnte kein
Bremsgestänge
mehr verbaut werden. Zudem bedeutet dieses auch ein stattliches Gewicht,
das eingespart wurde.
Um die vorher erwähnten
Luftdrücke
in eine mechanische Bewegung umzusetzen wurden
Bremszylinder
benötigt. Da hier auf ein
Bremsgestänge
verzichtet wurde, war bei jedem
Rad
ein
Zylinder
montiert worden. Dieser wurde durch die
Druckluft
ausgestossen und bewegt die angeschlossene und sehr gut zu erkennende
Bremszange
so, dass die
Bremsen
angezogen wurden. Eine einfache Rückholfeder sorgte dafür, dass sie auch
wieder gelöst wurden.
In diesen wurden die Bremssohlen gehalten und durch die Bewegung des Bremszylinders gegen die Lauffläche gepresst.
Das
Rad
wurde daher regelrecht zwischen den
Brems-belägen
eingeklemmt und so an der freien Drehung gehindert. Die gewünschte
Bremsung
setzte ein. Bisher entsprach die Lokomotive vom Aufbau der mech-anischen Bremsen eigentlich den anderen Baureihen. Jedoch wurden hier nicht mehr die bisher benutzten Bremssohlen aus Grauguss verwendet.
An deren Stelle traten hier neue Sohlen aus Sintermetall, die als
Kunststoffbremssohlen
bezeichnet wurden. Sie sollten verhindern, dass durch die Bremswirkung die
Laufflächen
der
Lokomotive
aufgeraut wurden. So konnte der Lärm gemildert werden.
Diese neuen
Kunststoffbremssohlen
hatten jedoch gegenüber den alten
Bremssohlen ein geändertes Verhalten. Drehte sich das
Rad
schneller, erhöhte sich die
Bremskraft.
Das hätte bei hohen Geschwindigkeiten zu unzulässigen Werten geführt. Hier
lag der Grund, warum bei der
R-Bremse
der
Luftdruck
verringert wurde, das
Bremsgewicht
jedoch höher war. Sie sehen, dass neue Bremssohlen durchaus Auswirkungen
auf die
Druckluftbremsen
hatten.
Ein Problem ergab sich jedoch mit den neuen
Bremssohlen. Sie waren thermisch nicht so stark belastbar, wie die
Modelle aus Grauguss. Daher wurde bei dieser Maschine bevorzugt die
elektrische
Bremse verwendet. Stand diese jedoch nicht zur Verfügung
und musste so ein
starkes Gefälle
befahren werden, durfte zur Schonung der Klötze nur noch mit 40 km/h
gefahren werden. Wie die elektrische Bremse geregelt wurde, erfahren wir
später.
Noch fehlt uns ein Punkt. Die mechanischen
Bremsen
wurden gelöst, wenn die
Druckluft
verloren ging. Um die
Lokomotive
in diesem Fall unabhängig von der Druckluft zu bremsen, wurden
Federspeicherbremsen
eingebaut. In diesem Punkt waren die Konstrukteure jedoch ausgesprochen
grosszügig. So konnte mit dieser
Feststellbremse
eine
Bremskraft
von 76 kN erzeugt werden. Das reichte auf dem ganzen Netz.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
Die 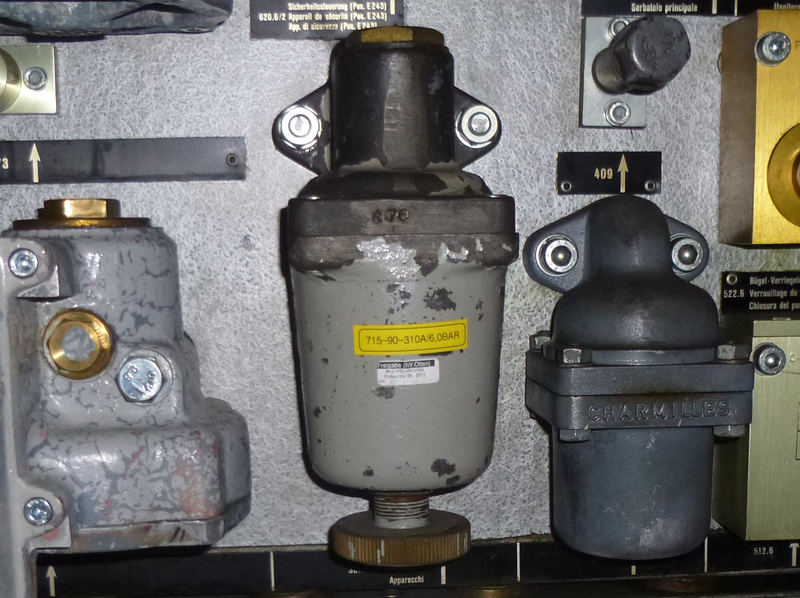 Dieses
Dieses
 Angeschlossen
war eine
Angeschlossen
war eine  Damit
können wie die anderen Baugruppen, die mit
Damit
können wie die anderen Baugruppen, die mit  Um
die Festhaltebremse wieder zu lösen, musste mit dem Fahrzeug einfach
wieder
Um
die Festhaltebremse wieder zu lösen, musste mit dem Fahrzeug einfach
wieder 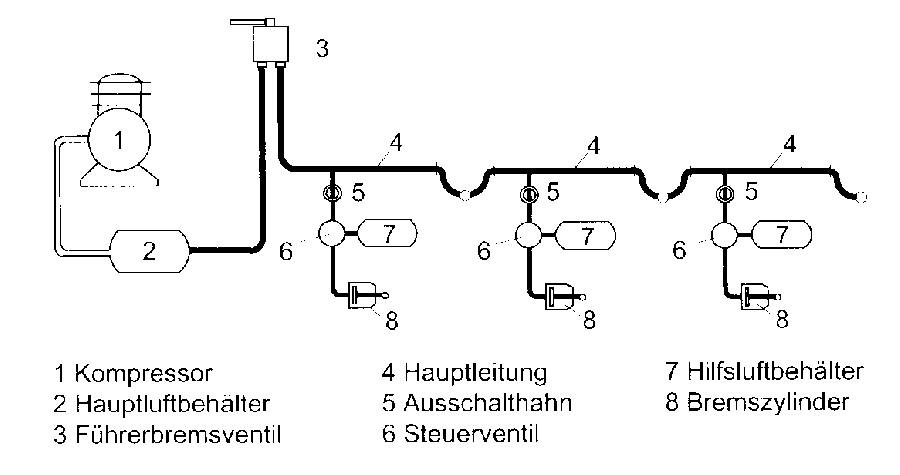 Wie
bei anderen Baureihen, arbeitete die
Wie
bei anderen Baureihen, arbeitete die
 Wie
bei indirekten
Wie
bei indirekten  Verbaut
wurde hier eine klassische
Verbaut
wurde hier eine klassische