|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Seit der Einführung der
mit
Druckluft
betriebenen
Bremsen
gehörte komprimierte Luft auf eine
Lokomotive. Als dieses
Triebfahrzeug
in den Betrieb kam, verkehrten nahezu alle
Schnellzüge
mit diesen Bremsen. Daher war klar, dass auch das für diese Züge gedachte
Traktionsmittel mit einer solchen Anlage versehen werden muss. Das
erlaubte jedoch auch, andere Funktionen des Fahrzeuges mit diesem Medium
zu betreiben.
Über
Ventile
wurde die Luft angezogen und dann über andere Ven-tile in eine
geschlossene Leitung entlassen. Diese Anlage wurde daher auch
Kolbenkompressor
genannt und sie schöpfte wie die
Luftpumpe
nur Luft. Jede Hälfte hatte einen eigenen Kompressor erhalten. Dieser reich-te jedoch nur aus, um kurze Züge mit ausreichend Luft zu versor-gen. Um einen langen Schnellzug mit Druckluft zu speisen, wurden daher beide Kompressoren benötigt.
Da aber auch die
weitere Anlage getrennt war, galt auch hier, dass wir nur eine Seite der
Maschine ansehen müssen. Auch wenn eine Hälfte ausfiel, mit der anderen
konnte noch ein
Bahnhof
erreicht werden. Die vom Kolbenkompressor in die Leitung geschöpfte Luft gelangte danach in einen Luftbehälter. So lange die Verbraucher nicht mehr Luft bezogen, als geschöpft wurde, stieg der Druck im System weiter an.
Das bei den
Luftbehältern vorhandene Volumen diente als
Puffer,
wenn kurzfristig viel Luft benötigt wurde. War dieses erschöpft musste
zugewartet werden, bis der
Kompressor
den
Luftdruck
wieder erhöht hatte. Das Druckluftsystem war für einen maximalen Druck von acht bar ausgelegt worden. Dieser Wert war von den Dampflokomotiven übernommen worden.
Da hier jedoch die
Kompressoren
nicht bei einem bestimmten Druck in der Leitung stehen blieben, musste das
System ent-sprechend geschützt werden. Diese Aufgabe übernahm nun ein
Überdruckventil,
das dafür sorgte, dass bei einem maximalen
Luftdruck
von neun
bar,
die Luft in die Umwelt entlassen wurde.
Im Gegensatz zu den
Dampflokomotiven wurde bei den elektrischen Maschinen die
Druckluft
auch zur Inbetriebnahme benötigt. Daher konnten die Luftbehälter mit
Absperrhähnen
abgetrennt werden. Der Druck blieb deshalb gespeichert und konnte später
genutzt werden. Damit können wir jedoch zu den Verbrauchern wechseln und
dabei lasse ich die elektrischen Bauteile vorerst weg, da diese später
noch genauer angesehen werden.
Für die Verbraucher war
eine Leitung an den Luftbehältern angeschlossen worden. Diese wurde für
die Apparate und alle anderen Verbraucher genutzt. Dabei arbeitete sie mit
einem Druck von sechs bis acht
bar,
wobei Baugruppen mit einem bestimmten
Luftdruck
nicht vorhanden waren. Wenn man von den
Bremsen
und der elektrischen Teilen absieht, waren nicht mehr so viele Verbraucher
vorhanden. Dabei haben wir einen davon bereits kennen gelernt.
Die beim
Laufwerk
schon erwähnte
Sandstreueinrichtung
der
Lokomotive wurde mit
Druckluft
betrieben. Dabei wurde diese mit einem
Ventil
aktiviert. Die Luft strömte nun in die Leitung und zog den Sand aus den
Behältern mit. Durch die dazu benötigte Kraft sank der
Luftdruck
und der
Quarzsand
wurde mit wenig Schwung auf die
Schienen
geblasen. Durch die Ausrichtung der Auslassöffnung erfolgte das
unmittelbar vor dem
Rad.
Bei der zweiten Funktion, die
angeschlossen wurde, spielte der
Luftdruck
nur eine untergeordnete Rolle. Da hier der beim den Dampflokomotiven
benutzt Dampf für die akustischen Signale fehlte, musste für die
Pfeife
Druckluft benutzt werden. Das hatte
zur Folge, dass diese eine andere Tonlage hatte und dass der Schall nicht
mehr ganz so laut war. Je nach der Menge Druckluft konnten
unterschiedliche Töne erzeugt werden.
Daher wenden wir uns nun den pneu-matischen Bremsen zu und dort gab es eigentlich keine grossen Überrasch-ungen.
Der Grund war simpel, es galten
Nor-men, die eingehalten werden mussten. Nur so konnten die Wagen richtig
ge-bremst werden. Als diese Lokomotive in Betrieb kam, waren die Reisezugwagen und bereits erste Güterwagen mit Druckluftbrems-en versehen worden.
Diese mussten daher von der Maschine
auch bedient werden können. Aus diesem Grund wurden auch diese mit der
Doppelbremse von
Westinghouse versehen. Dabei umfasste diese Einrichtung
zwei unabhängige
Bremssysteme, die sowohl auf dem
Triebfahrzeug, als auch
bei der
Anhängelast benutzt wurde.
Einfach aufgebaut war dabei die
direkt wirkende
Regulierbremse. Bei dieser wurde von einem
Ventil
Druckluft in eine Leitung geleitet. Diese wiederum drückte im
Bremszylinder
den
Kolben nach aussen. Je höher der Druck war, desto besser
war die
Bremsung. Mit diesem
Bremssystem
konnte im Bremszylinder ein
maximaler
Luftdruck von 3.5
bar erzeugt werden. Da dieser jedoch stufenlos
reguliert werden konnte, wurde die
Bremse so bezeichnet.
Die
Regulierleitung war nicht
nur auf das Fahrzeug beschränkt worden. Sie wurde zu den beiden
Stossbalken geführt und dort geteilt. So standen auf jeder Seite zwei
Luftschläuche und die passenden
Absperrhähne bereit. Die
Verbindung zur
Anhängelast wurde jedoch nur bei
Reisezügen genutzt, da es die
entsprechende
Bremse bei den
Güterwagen oft gar nicht gab. Ein Punkt, der
jedoch nicht so wichtig war, da ja diese
Lokomotive keine
Güterzüge
bespannen sollte.
Daher musste eine
zweite
Bremse verbaut werden, die auch bei diesen Situationen über eine
ausreichende Sicherheit verfügte. Damit kommen wir bereits zum zweiten
Teil der Doppelbremse nach
Westinghouse. Das zweite pneumatische Bremssystem der Lokomotive arbeitete mit einer Leitung, die auf einen Druck von fünf bar gefüllt wurde. Diese Hauptleitung wurde zu den Stossbalken geführt und dort ebenfalls geteilt.
Auch jetzt gab es wieder
zwei
Luftschläuche mit
Ab-sperrhahn. Lediglich die Anordnung und die
Kupplungen waren anders. So konnten die Leitungen der beiden
Bremsen nicht
vertauscht werden, was sehr wichtig war. Um eine Bremsung einzuleiten, musste bei diesem Bremssystem der Luftdruck in der Leitung um mindes-tens 0.4 bar abgesenkt werden. So wurden auch bei einer Zugstrennung die verlorenen Wagen sicher ge-bremst.
Wir haben die Sicherheit bei dieser
Einrichtung er-halten. Jedoch konnte so der
Bremszylinder nicht an-gesteuert
werden, denn dieser benötigte einen steigen-den Druck. Daher war ein
Ventil
eingebaut worden.
Dieses
Steuerventil war von der
Marke
Westinghouse. Es wurde ein einlösiges
Ventil
verwendet. Wegen diesem
Bauteil, das den Druck veränderte, wurde hier von einer indirekten Bremse
gesprochen. Wegen dem Lieferant der Bauteile benannte man diese
Einrichtung auch als
Westinghousebremse. Später wurde in diesem
Zusammenhang der Begriff
automatische Bremse geläufig. Wichtig dabei war
nur der Lieferant des Steuerventils.
Der maximale
Luftdruck im
Brems-zylinder wurde mit 3.9
bar
angegeben. Erreicht wurde dieser jedoch bereits, wenn die
Hauptleitung auf
einen Wert von 3.5 bar abgesenkt wurde. So war sicher genug Luftvorrat für
die
Brems-ung vorhanden. Die Dauer, bis der Bremszylinder die grösste Kraft erzeugte, konnte jedoch nicht verstellt werden. Daher war die Lokomotive lediglich mit der P-Bremse versehen worden.
Eine
Schnellzugslokomotive stellt schon beim Begriff
klar, dass sie nicht für
Güterzüge gebaut wurde. Daher macht es keinen
Sinn, wenn die
G-Bremse angeboten würde. Wobei damals bereits auch erste
Güterzüge mit der
P-Bremse gefahren wurden.
Wir haben damit zwei
unabhängige
Bremssysteme erhalten, die auf den gleichen
Bremszylinder
arbeiteten. Ein Wechselventil in der Zuleitung sorgte dafür, dass immer
der grössere
Luftdruck in den
Zylinder geleitet wurde. Daher konnte das
einlösige
Steuerventil mit der
Regulierbremse kompensiert werden. Wobei
jetzt natürlich eine etwas geringere
Bremskraft verfügbar war. Doch damit
sind wir beim mechanischen Teil der
Bremsen angelangt.
Jedoch blieben die Beläge auf dem Gegenstück liegen. Damit die
Bremsen
jedoch sauber gelöst wurden, war beim
Bremszylinder eine Rückholfeder
vorhanden. Diese brachte den
Kolben in die Endlage. Nicht nur mit dem Bremszylinder konnte das Bremsge-stänge bewegt werden. Im Führerstand war eine Kurbel vorhanden. Mit dieser konnte über eine Spindel das Gestänge so bewegt werden, dass die Bremsen auch ohne die Hilfe von Druckluft angezogen wurden.
Daher war auch eine rein mechanisch arbeitende
Brem-se vorhanden,
die hier jedoch nur noch bei Störungen an den Bremsen, oder zum Sichern
der abgestellten
Lokomotive genutzt wurde.
Am anderen Ende des
Bremsgestänges waren schliess-lich die Bremselemente vorhanden. Es kam eine
damals übliche
Klotzbremse zur Anwendung. Bei dieser Lösung wurden die
Bremsklötze vom Bremsgestänge so gegen die
Lauffläche des
Rades gepresst,
dass dieses an der freien Drehung gehindert wurde. In der Folge verzögerte
das Fahrzeug so lange, wie die Klötze das Rad behinderten und so Reibung
erzeugten.
Reibung führt zu einem Anstieg
bei der Wärme. Das kennen Sie, wenn Sie im Winter die Hände reiben, um sie
zu wärmen. Bei der
Bremse war diese Hitze jedoch ein Problem, denn sie
durfte nicht in die
Bandage abgeführt werden. Zudem wollte man den
Radreifen durch die
Bremsungen nicht zusätzlich abnutzen und so seine
Lebensdauer verlängern. Daher mussten die Klötze sowohl die Wärme, als
auch den Abrieb aufnehmen.
Die Lösung für dieses Problem
war einfach, denn für die
Bremsklötze wurde ein Metall verwendet, das
deutlich weicher war. Dabei wurde der Klotz aus Grauguss bei der
Bremsung
so stark belastet, dass Material abgetragen wurde. Dank dieser Abnutzung
wurde auch Wärme abgeführt und so der Bereich gekühlt. Als Nachteil kann
jedoch der
Bremsstaub angesehen werden, denn dieser oxidierte sofort und
er konnte sich fest mit Metall verbinden.
Nötig war dies, damit sich die auf die
Lauffläche
ausgeübte Kraft nicht verminderte. Ein längerer Weg hätte im schlimmsten
Fall zum Ausfall der
Bremsen führen können. Auch die
Handbremse hätte
nicht mehr mit genug Kraft gewirkt. Eine zu grosse Belastung hätte jedoch auch zu Schäden am Klotz geführt. Daher musste die vom Bremszylinder erzeugte Kraft optimaler auf die Lauffläche übertragen werden.
Das löste der
Hersteller damit, dass jede
Triebachse über
vier
Bremsklötze verfügte. Die
Lokomotive hatte daher 16
Bremsbeläge erhalten
und verfügte so über eine gute
Bremse. Bei einer
Schnellzugs-lokomotive war
das jedoch zu erwarten. Die beiden Laufachsen der Lokomotive waren nicht gebremst. Diese wäre wegen dem Krauss-Helmholtz-Drehgestell ohne grossen Aufwand möglich gewesen. Jedoch hätte die vom Bremsklotz auf die Räder übertragene Kraft dazu geführt, dass die Laufachse blockiert wäre.
Der Grund lag bei der geringeren
Achslast dieser
Achse. Zudem waren in der Schweiz gebremste
Laufachsen bei
Lokomotiven sehr selten angewendet worden.
Mit den
Bremsen haben wir den
mechanischen Auf-bau abgeschlossen. Speziell war die Baureihe Fb 2 x 2/3
bisher nur in dem Punkt, dass die beiden Hälften ohne Probleme auch
alleine eingesetzt werden konnten. Genutzt werden konnte das zum Beispiel
bei Störungen, die noch mit der «halben»
Lokomotive die Fahrt in die
Werkstatt erlaubte. Es lohnt sich, wenn wir nun nachsehen, ob das auch im
elektrischen Teil so war.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
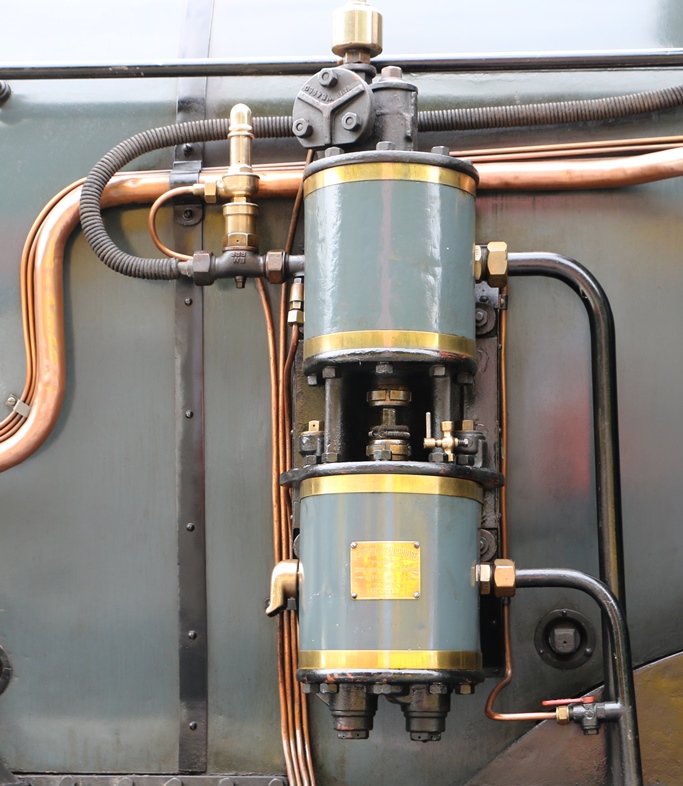 Zur
Erzeugung der
Zur
Erzeugung der
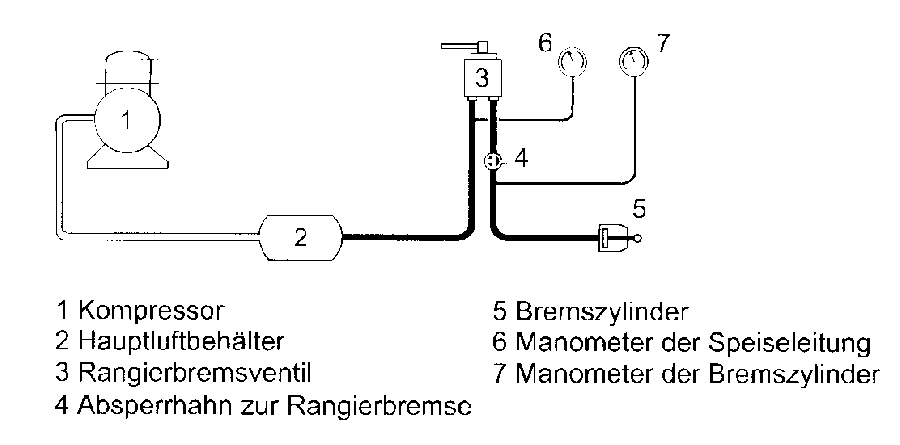 Damit haben wir bis auf die
Damit haben wir bis auf die
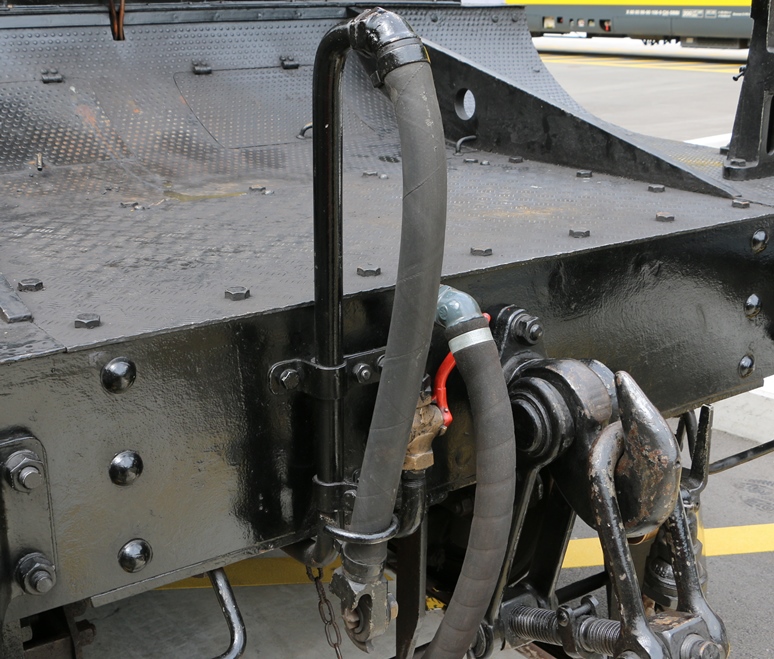 Bei der
Bei der
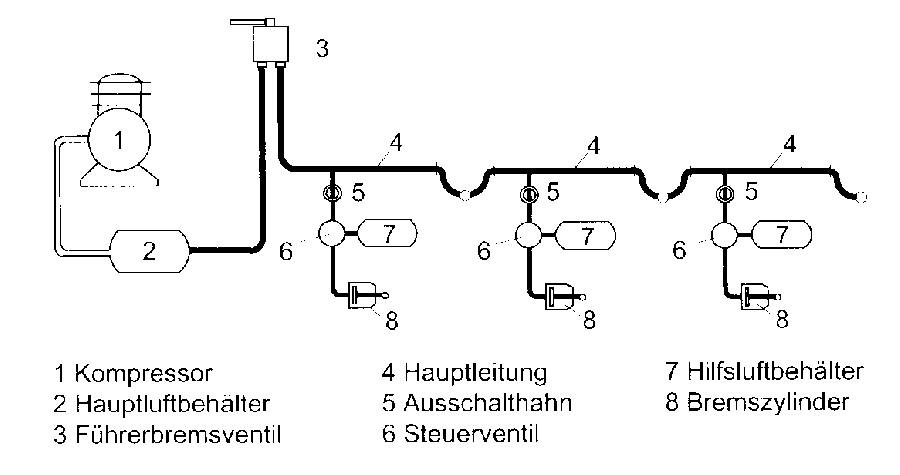 Wurde der
Wurde der
 Das am
Das am
 Um die Abnützung der
Um die Abnützung der