|
Betriebseinsatz 1933 - 1945 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
1933 kam nach 20 Jahren das endgültige Ende für die beiden
Prototypen.
Die beiden
Lokomotiven mit den Nummern 2901 und 2902 wurden
ausrangiert und abgebrochen. Auch nach dem Umbau waren diese beiden
Maschinen nicht auf der Höhe der in Reihe gebauten Lokomotiven. Der
geringere Druck im
Kessel
konnte einfach nicht umgesetzt werden. So beschäftigte man die beiden
Maschinen schon länger in einfacheren Diensten.
Die Arbeit für grosse Dampflokomotiven wurden immer seltener. Selbst auf Nebenstrecken begannen die elektrischen Triebwagen mit dem Verkehr.
Cholis fanden dort keinen Platz mehr. Besonders dann nicht, wenn
es die grösste Dampflokomotive ist.
Der Schneidbrenner des Schrottplatzes nahm sich den beiden
Lokomotiven an. Das beste Programm für die
Prototypen
war der Fluss von Geld und letztlich das Feuer des Schrotthändlers. Die
Zeit für Exoten wurde in der Schweiz schwer, denn auch andere misslungene
Modelle bekamen es mit dem Schneidbrenner zu tun. Es fand eine Bereinigung
des Bestandes statt. Auch für neuere Exoten gab es keine Gnade mehr aus
Bern.
Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatte nun genug
Dampflokomotiven, so dass man auf solche Exoten verzichten konnte. Man
spürte die grosse Anzahl elektrischer
Lokomotiven deutlich. Gerade die grossen Serien der
Baureihe Ae 3/6 I und Ae 4/7
wirkten sich schlecht auf die Dampflokomotiven aus. Den in Serie gebauten
C 5/6 half eigentlich nur noch der
Hilfswagen
in irgendeinem
Depot
in der Schweiz. Dort benötigte man diese Baureihe.
Ab 1934 reduzierten sich die Kilometerleistungen der C 5/6
drastisch, und der Überbestand an thermischen
Triebfahrzeugen
führte zusammen mit dem rückläufigen
Güterverkehr
zur langjährigen Remisierung einiger
Lokomotiven. Man wollte sich noch nicht von den
Maschinen verabschieden, denn wenn es erneut zum Krieg kommen sollte,
hätte man so auch die Möglichkeit bei defekter
Fahrleitung
zu fahren.
Die elektrischen
Lokomotiven hatten nun Vorrang und die Dampflokomotiven
mussten weichen. Normalerweise würde das zu einer grossen Aktion mit
Ausrangierungen
führen. Daher hatten es die C 5/6 noch gut erwischt. Bei anderen Baureihen
sah es gar nicht so gut aus und viele Dampflokomotiven wurden aus den
Listen gestrichen. Es gab schlicht keine Arbeit mehr und das merkten
meisten die Schwächsten.
Der Einsatz auf nicht elektrifizierten
Nebenstrecken
konnte nicht in Erwägung gezogen werden, da in entsprechend leichten
Diensten derart schwere
Lokomotiven kaum wirtschaftlich verwendet werden
konnten. Die C 5/6 war für
Hauptstrecken
und dort für schwere
Güterzüge
gebaut worden und nicht für den Stücker auf Nebenstrecken. Eine solche
Lokomotive mit zwei oder drei Wagen zu verwenden war nicht sinnvoll.
Die grossen und schweren Maschinen vom Gotthard wollte niemand. So
blieben nur noch die
Hauptstrecken
ohne
Fahrdraht.
Nur, die gab es in der Schweiz kaum noch. Es musste wegen der Krise etwas
passieren, denn selbst elektrische Maschinen standen herum.
Noch konnte oder wollte man sich nicht von den
Lokomotiven trennen. Die C 5/6 mit den Nummern 2953 bis
2956, 2968, 2971 und 2975 wurden deshalb in den Winterschlaf geschickt. Im
Kessel
war kein Wasser und
Kohlen
lagen nicht auf dem
Tender.
Abgestellt in einem dunklen
Schuppen
in der hintersten Ecke des
Depots,
warteten die Maschinen auf die Zukunft. Die Zeit arbeitete jedoch gegen
die alten Dampflokomotiven.
So verbrachten die C 5/6 mit Ausnahme der Basler
Lokomotiven vorerst geruhsame Jahre. Die kalten
Lokomotiven wurden gesammelt auf
Geleisen,
wo sie nicht störten abgestellt und warteten dort auf bessere Zeiten. Oft
war das eine aufgeschobene
Ausrangierung.
Lediglich die Maschinen vor dem
Hilfswagen
hatten etwas mehr Glück, die waren bereit für grosse Taten. So lange der
Verkehr aber reibungslos lief, gab es nichts zu tun.
Es ist dem weitsichtigen Denken, der damaligen Verantwortlichen zu
verdanken, dass die neueren Maschinen nicht einfach abgebrochen wurden.
Doch 1934 merkten das die betroffenen
Lokomotiven kaum. Die eingemotteten C 5/6 begannen
zusehend zu verstauben und die im freien abgestellten Lokomotiven litten
unter der Witterung. Die Lokomotiven wirkten, als warteten sie nur noch
auf den Schneidbrenner, doch der wartete vorerst vergebens.
Die Rede ist von den ersten
Triebwagen,
die mit einem
Dieselmotor
ausgerüstet wurden. Diese sollten auf den
Nebenstrecken
ohne
Fahrleitung
die Dampflokomotiven ablösen. Jedoch funktionierten diese Triebwagen
schlecht und zuverlässig war die neue Technik auch nicht.
Ab 1939 erlangte der Transitverkehr auf der Nord-Süd-Achse
eine enorme Bedeutung. Die elektrischen
Lokomotiven wurden zusehends knapp und man hatte kaum
neue Maschinen im Bau. Eine schnelle Entlastung war nur mit den
abgestellten Dampfmaschinen der Reihe C 5/6 möglich. Die Dampflokomotiven
mussten aushelfen und das, obwohl Deutschland mit Polen einen Krieg
begonnen hatte. Wie gut das war, zeigte sich kurze Zeit später.
In der Folge kamen die C 5/6 nach einer
Hauptrevision
um 1940 wieder vollzählig in Betrieb.
Leistungen unter
Fahrdraht
gehörten nun zur Tagesordnung der C 5/6. Die Strecken waren elektrifiziert
und die C 5/6 wurden nun eingesetzt, weil man
Lokomotiven benötigte und nicht, weil es keine
Fahrleitung
gab. Die C 5/6 waren also nur die Retter in der Not. Langfristig rechnete
niemand mehr mit einem Einsatz dieser Lokomotiven.
Vor allem weil eine Dampflokomotive unter
Fahrdraht
nicht sinnvoll war, kann das als bedenklich angesehen werden. Der
ausgestossene Russ machte den
Isolatoren
zu schaffen und für das Personal auf den Dampflokomotiven konnte die
Fahrleitung
gefährlich werden. Spezielle Schutzbogen sollten diese Gefahr mildern.
Keine optimale Lösung für das Problem, weil man aber keine anderen
Lösungen hatte, blieb schlicht keine
Option
für diesen Einsatz.
Für den
Rangierdienst
und die Übergabezüge kamen weitere vier Maschinen dazu. Der Höhepunkt der
Basler Einsätze war nun erreicht. Am 1. Juli 1940 waren in Basel mit 16
Lokomotiven die Mehrzahl der C 5/6 stationiert worden und sie waren im
Einsatz. Doch schon bald liess der ausufernde Krieg die Materialversorgung in der Schweiz kritisch werden. Die Kohlen für den Dampfbetrieb wurden knapp, genauso wie andere lebenswichtige Güter.
Lediglich die elektrische Energie stand unangefochten bereit und
konnte für die Züge genutzt werden. Daher waren die Probleme nicht mehr so
gross, wie während dem ersten Weltkrieg. Noch hatte man ein paar
Kohlen
übrig, die in die
Feuerbüchsen
gelangten. Die Pflichtlager wurden nun gebraucht und so fütterte man die C 5/6 immer öfters mit Briketts, statt mit gebrochener Steinkohle.
Ganz so schlimm war die Not aber nicht mehr, denn ein grosser Teil
der Strecken war mit
Fahrleitung
versehen. Letztlich gab es auch mit
Holz
beladene
Lokomotiven. Die Baureihe C 5/6 wurde jedoch mit
Kohlen
befeuert und die
Briketts
aus Ruhrkohle waren gar nicht so schlecht für die Decke der
Feuerbüchse.
Mit einer Anbauschlacht, bei der selbst städtische Parks gepflügt
wurden, wollte man der grössten Not begegnen, doch
Kohlen
und
Öl
mussten eingeführt werden und da war nur noch das Rheintal offen. Die
Reichsbahn hatte aber kaum
Lokomotiven für diese Einsätze, denn die
Maschinen wurden für Waffentransporte innerhalb von Europa benötigt. Für
die Züge mussten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB also wiederum die
Lokomotiven stellen.
Um die Versorgung durch das Rheintal Richtung Basel
sicherzustellen, mussten der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft DRG
leistungsfähige Güterzugslokomotiven ausgeliehen werden. Freiwillig taten
das die Schweizerischen Bundesbahnen SBB nicht, denn es waren politische
Forderungen, denen Folge geleistet werden musste. Die Not im Land war so
gross, dass man klar riskierte, die abgetretenen
Lokomotiven zu verlieren.
Als erste wurde die C 5/6 Nummer 2955 am 18. März 1942 in Basel an
die DRG übergeben. Wie viele der beteiligen Leute der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB davon ausgingen, dass sie die
Lokomotive wohl nie mehr sehen würden, wurde
nicht überliefert. Es war nicht vereinbart worden, wie die Lokomotiven
eingesetzt werden. Einzig Kriegstransporte wollte man verbieten. Ob dieses
Verbot eingehalten wurde, weiss niemand.
Selbst der Unterhalt der nicht ganz zum Bestand passenden
Maschinen aus der Schweiz machte man in Deutschland, beziehungsweise in
den besetzten Gebieten im Raum Basel und Frankreich. In der Schweiz wurden
die
Lokomotiven abgeschrieben. Hauptsächlich verrichteten die Maschinen bei den Bahnbetriebswerken Haltingen, Waldshut und Mülhausen ihren Dienst vor Güterzügen von und nach der Schweiz. Wobei vermutlich auch andere Güterzüge geführt wurden.
Schliesslich hatten diese
Lokomotiven keinen bestimmten Verwendungszweck
erhalten. Das deutsche Personal schien mit den Verbundlokomotiven gut zu
Recht zu kommen, denn über besondere Schäden ist aus diesen Jahren nichts
bekannt geworden.
Die
Lokomotiven wurden in Mülhausen und somit im
besetzten Elsass unterhalten. Sie haben richtig gelesen, die Lokomotiven
kamen nicht einmal für den Unterhalt in die Schweiz zurück. Die Maschinen
waren vollwertige Leihgaben an die DRG und nicht mit
Versorgungszügen
beschäftigt. Daher überrascht es schon, dass diese Lokomotiven kaum je
weit von der Grenze zur Schweiz operierten und so immer etwas in der Nähe
waren.
Die Laufleistungen waren mit 4 300 Kilometer beachtlich. In der
Schweiz erreichten die Maschinen kaum je solche
Leistungen und nur ganz zu Beginn, waren sie ähnlich
stark ausgelastet. Die DRG setzte die
Lokomotiven somit regelmässig ein. Weil die
Maschinen dabei oft in den
Grenzbahnhöfen
Basel, Waldshut und Schaffhausen auftauchten, hatte man die Gewissheit,
dass die Maschinen sorgfältig verwendet und gepflegt wurden.
Die Züge konnten einfach nicht mehr in den noch verschonten Raum Offenburg – Freiburg gelangen, da die Strecken im Zulauf vermint oder ausgebombt waren.
So konnten zwischen September 1944 und Januar 1945 sämtliche C 5/6
bis auf die Nummer 2978 wieder in die Schweiz und somit in die sichere
Heimat zurückkehren. Die 2978 blieb in Mülhausen schadhaft stehen und konnte nicht in die Schweiz überführt werden. Sie wurde hier vom Truppenvormarsch der alliierten Truppen überrollt und dabei interniert. Sie wurde erst nach langwierigen Verhandlungen am 25. März 1945 kalt nach Basel überführt und war somit die letzte C 5/6 auf ehemals deutschem Gebiet.
Es grenzt an ein Wunder, dass in dieser Zeit keine C 5/6 verloren
ging und auch der letzten Maschine der Heimweg gelungen war.
Parallel zur Rückführung der C 5/6 aus dem nördlichen Deutschland
und der damit unterbrochenen Rheintalbahn und vor allem wegen den
ausgefallenen Rheinschiffen wurden zusammen mit der Französischen
Staatsbahn SNCF wieder die
Versorgungszüge
im Rhonetal aufgenommen. Das führte oft dazu, dass eine zurückgekehrte
Lokomotive gleich wieder verschoben wurde und
wieder im Ausland verkehrte.
Im Unterschied zum Einsatz im ersten Weltkrieg wurden nun die
Lokomotiven französischen
Depots
zugeteilt und auch vom dortigen Personal gefahren und betreut. Dazu
mussten Anpassungen beim
Kamin
und am Sanddom vorgenommen werden, damit die Maschinen ins französische
Lichtraumprofil
passten. Erneut waren also C 5/6 wieder im Ausland tätig und wurden der
Obhut fremden Personals überlassen.
Ab Ende 1944 standen dann auf französischem Gebiet 23
Lokomotiven der Reihe C 5/6 im Dienst. Die
Lokomotive 2978 war in Mulhouse, das nun wieder zu Frankreich gehörte,
blockiert. Heimatdepots für die Lokomotiven aus der Schweiz waren die
Depots
Chambèry, Bellegarde, Annemasse und Ambérieu. Gefahren wurden die Züge mit
den C 5/6 von französischem Personal. Somit war hier die Situation
ziemlich ähnlich, wie in Deutschland.
Diese hatten sich mit Hilfseinsätzen in der Hei-mat halten können. Es wa-ren die Lokomotiven 2962, 2963, 2964 und 2974.
Alle anderen Maschinen waren zum Einsatz für die Versorgung des
Landes abkommandiert worden und befanden sich daher in Frankreich. Ein
besonderer Einsatz, den man nicht erwarten durfte.
Die Laufleistungen in Frankreich lagen im Rahmen dessen, was die
Lokomotiven zuvor bei der DRG geleistet hatten.
Auch das Personal in Frankreich schien mit den Lokomotiven gut zu Recht zu
kommen, denn auch hier wurde nichts von grossen Schäden übermittelt. Die C
5/6 halfen im Ausland aus, und der Heimat wichtige Güter zukommen zu
lassen. Diese Züge sollten zumindest so lange laufen, bis der Krieg
beendet war.
So kam die C 5/6 von Frankreich her nach Genève, wurde dort
abgehängt und kehrte wieder zurück. In der Schweiz übernahmen dann die
elektrischen
Lokomotiven die Züge und führten die an die
vorgesehenen Punkte. Es soll dabei sogar vorgekommen sein, dass die
Dampflokomotive aus der Schweiz am Mittelmeer den Zug übernommen hatte. So
weit von der Schweiz entfernt waren die Maschinen dieser Baureihe jedoch
noch nie.
Mit der Kapitulation von Deutschland, begann sich die Situation in
der Schweiz wieder zu verbessern. Die ersten Dampflokomotiven konnten
wieder in die Schweiz geholt werden. Mit der Freigabe des Rheins für die
zivile Schifffahrt, endeten die
Versorgungszüge
und mit der C 5/6 Nummer 2953 kehrte die letzte
Lokomotive wieder in die Schweiz zurück. Ab dem
16. Juni 1946 waren alle C 5/6 wieder zu Hause.
Gerade der zweite Weltkrieg zeigte erstmals, dass die Beschaffung
der C 5/6, die von einigen als wenig weitsichtig betitelt wurde, ganz gut
war. Die C 5/6 waren die einzigen
Lokomotiven, die den schweren
Versorgungszügen
gewachsen waren. Die schwächeren C 4/5
hatten hier weniger Erfolg.
Dank den C 5/6 hatte die Schweiz die Lokomotiven
um die Bevölkerung trotz aller Not über Wasser zu halten. Das erfolgte
einfach nicht im eigenen Land.
Die C 5/6 retteten so das Volk, nur machten sie das im Ausland, so
dass das nicht bemerkt wurde. Das Überleben eines Volkes hing an den alten
Maschinen aus einer Zeit, wo man elektrische
Lokomotiven als Exoten angesehen hatte. Nur 30
Jahre später waren sie die Exoten, denn in der Schweiz hatte man damit
begonnen auch
Nebenstrecken
mit einer
Fahrleitung
zu versehen. Die Zukunft für Dampflokomotiven sah schlecht aus.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2017 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
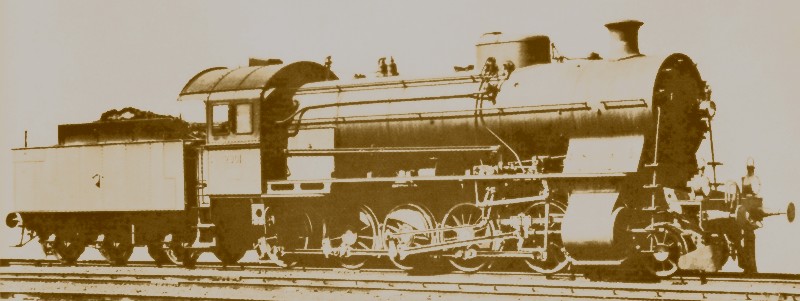 Nach
nur 20 Jahren Einsatz wurde damit die
Nach
nur 20 Jahren Einsatz wurde damit die
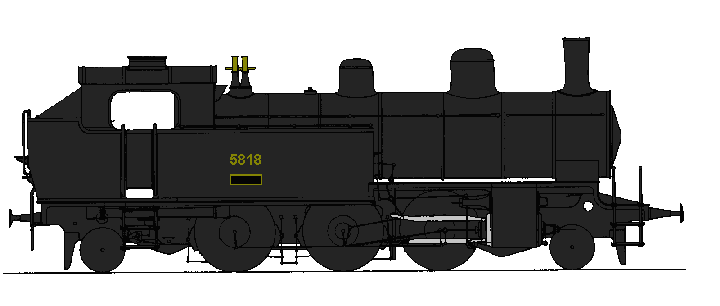 Dort
hatte man mit den
Dort
hatte man mit den 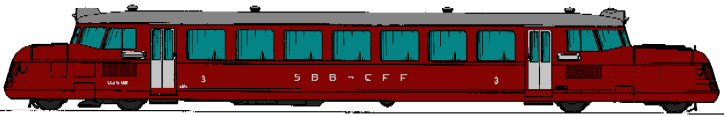 Da
war noch ein Fahrzeug in der Schweiz unterwegs, dass besonders war. So
fuhr es auf Strecken ohne
Da
war noch ein Fahrzeug in der Schweiz unterwegs, dass besonders war. So
fuhr es auf Strecken ohne
 Die
Basler
Die
Basler
 In
der Folgezeit waren insgesamt mindestens 16, möglicherweise sogar 18
In
der Folgezeit waren insgesamt mindestens 16, möglicherweise sogar 18
 Mit
dem Vormarsch der alliierten Truppen kam der Nachschub über deutsches
Gebiet je länger je mehr zum Erliegen.
Mit
dem Vormarsch der alliierten Truppen kam der Nachschub über deutsches
Gebiet je länger je mehr zum Erliegen.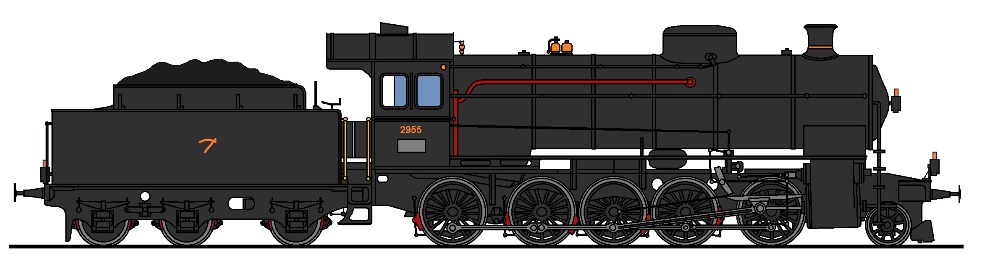 Zieht
man die ausran-gierten
Zieht
man die ausran-gierten