|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wir beginnen auch hier mit der Betrachtung der Nebenbetriebe. Diese
waren auch bei diesem
Triebwagen
etwas umfangreicher ausgefallen, wie das bei
Lokomotiven
der Fall gewesen wäre. Wobei es gab gegenüber älteren Baureihen bereits
erste Vereinfachungen. Das lag damit zusammen, dass diese Triebwagen
unmittelbar nach Abschluss einer jahrelangen Umstellung angeschafft wurden
und daher auch vereinfacht werden konnten.
Beginnen wir mit den Funktionen, die hier angeschlossen wurden und diese
sind schnell vorgestellt, denn zu den Nebenbetrieben gehörte einzig und
allein die
Zugsheizung.
Das war aber nicht sonderlich überraschend, denn eigentlich wurden nur
diese als Nebenbetriebe angesehen, da sie in der Regel nicht dem Fahrzeug
selber zur Verfügung standen. Das war hier jedoch etwas anders, doch war
dies eine Folge der besonderen Bauweise.
Auf eine zweite
Spannung,
wie das bei den
Lokomotiven
Ae 4/6 noch der Fall war,
verzichtete man hingegen. Es sollten schliesslich nur
Leichtstahlwagen
eingereiht werden und diese waren nur noch mit dieser Spannung versehen
worden. Um die Leitung zu schalten, war ein einfacher Hüpfer vorhanden. Dieser Heizhüpfer wurde mit einem Stromwandler kombiniert. Überstieg der Strom in dieser Leitung einen Wert von 300 Ampère, sorgte ein Relais dafür, dass der Hauptschalter und somit der Triebwagen ausgeschaltet wurden.
Einen direkten Einfluss auf den Heizhüpfer gab es vom Stromwandler
jedoch nicht. Es lag beim Personal die Ursache zu finden. Nach dem Stromwandler wurde die Leitung geteilt. Ein Teil davon wurde zu den beiden Stossbalken geführt und stand dort unterhalb des rechten Puffers in einer Steckdose zur Verfügung.
Man verzichtete hier auf das Anbringen eines
Heizkabel
beim linken
Puffer.
Somit musste immer das Kabel der Wagen benutzt werden. Da diese jedoch
auch bei den
Steuerwagen
fehlte, führten diese, jedoch nicht der
Triebwagen,
ein
Hilfsheizkabel
mit. Die zweite Leitung führte zu den im Fahrgastraum montierten Widerständen. Diese wurden zusätzlich noch mit einer Sicherung abgesichert und waren über die Erdungsbürsten mit den Rädern und dem Kraftwerk verbunden wor-den.
Die Rückleitung erfolgte bei den Nebenbetrieben daher
ausschliesslich über die
Schienen
und nicht über den
Triebwagen.
Daher musste die
Spannung
auch von der
Primärwicklung
abgenommen werden.
Speziell war, wenn das Abteil ab einer anderen Quelle, als dem
Triebwagen
geheizt werden sollte. War nun der Heizhüpfer geschlossen, wurde die
Spann-ung
zum
Transformator
geführt, der letztlich eine Hochspannung erzeugen und so die
Fahrmotoren
mit Energie versorgen konnte. Dabei stieg jedoch die
Leistung
in der Leitung sehr stark an. Das führte dazu, dass der Stromwandler den
Hauptschalter
ausschalten wollte.
Dies war jedoch gar nicht möglich, da der
Triebwagen
ja gar nicht eingeschaltet war. Es konnten so schwere Schäden entstehen
und theoretisch wäre sogar ein Brand mit Verlust des Fahrzeuges möglich
gewesen. Daher musste vor dem Anschluss an eine
Vorheizanlage
kontrolliert werden, ob der Heizhüpfer geöffnet war. War dies nicht der
Fall, durfte der Triebwagen nicht an die Anlage angeschlossen werden. In
der Regel wurde jedoch ab dem
Triebfahrzeug
geheizt.
Damit
war sie aber auch mit der
Primärwicklung
verbunden. Dank der eigenen
Spule,
konnte jedoch die
Spannung
besser eingestellt werden, als das bei einer
Anzapfung
in der Primärwicklung der Fall ge-wesen wäre. So stand den Hilfsbetrieben eine Spannung von 220 Volt zur Verfügung. Diese war von den vorhandenen Lokomotiven übernommen worden und war eine Forderung der Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Obwohl diese
Spannung
exakt dem damaligen Landes-netz entsprach, konnte wegen der
unterschiedlichen
Frequenz
nur ohmsche Verbraucher aus dem Landes-netz verwendet werden. Auf dem
Triebwagen
war das jedoch nicht der Fall. Mit einer einfachen Schmelzsicherung waren die Hilfsbetriebe vor Kurzschlüssen geschützt worden. Sprach diese Sicherung an, konnte sie ersetzt wer-den.
Ein erneutes Ansprechen dieser
Sicherung
führte jedoch dazu, dass der
Triebwagen
abgeschleppt werden musste. Das war eine der wenigen Situationen, bei
denen eventuell der Heizhüpfer kontrolliert werden musste, denn der
Kurzschluss
hätte tragische Folgen.
Um die
Hilfsbetriebe
ohne die Hochspannung zu prüfen, war ein Depotumschalter und auf beiden
Seiten des
Triebwagens
die entsprechenden Steckdosen vorhanden. Gerade dieser
Depotstrom
war der Grund für die Forderungen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,
denn nur so konnte man diese Einrichtung auf dem Triebwagen im Unterhalt
nutzen. Jedoch standen sämtlich nun vorgestellten Verbraucher auch beim
Depotstrom zur Verfügung.
Damit wurde die
Druckluft
auf dem regulären Weg er-zeugt, was auch ermöglichte, dass der maximale
Druck zur Verfügung stand. Sie sehen, Druckluft war auch hier sehr
wichtig. Damit im Betrieb nicht plötzlich zu wenig Druckluft vorhanden war, wurde der Motor zusätzlich noch über einen Druckschwankungsschalter angeschlossen. Sank der Druck in den Leitungen auf einen Wert von 6.5 bar, schaltete der Kompressor ein.
Bei einem Druck von acht
bar
wurde er jedoch wieder automatisch ausgeschaltet. So war gesichert, dass
immer genug
Druckluft
auf dem Fahrzeug vorhanden war und so der Betrieb gesichert wurde. Die wichtigsten Verbraucher der Hilfsbetriebe waren je-doch die Ventilatoren zur Kühlung der elektrischen Ausrüstung. Lediglich die Bremswiderstände auf dem Dach wurden nicht über die Hilfsbetriebe, sondern mit Hilfe des Fahrtwindes gekühlt.
Alle anderen
Kühlungen
waren jedoch hier angeschlossen worden. Daher lohnt es sich einen
genaueren Blick darauf zu werfen. Beginnen werden wird dabei mit dem
Transformator.
Im
Transformator
entstand die Wärme in den
Wicklungen.
Da diese kompakt aufgebaut wurden, war es nicht möglich, diese mit Luft
ausreichend zu kühlen. Daher wurde der Transformator mit speziellem
Öl
gefüllt. Dieses
Transformatoröl
zeichnete sich durch eine gute
Isolation
und eine gute Wärmeaufnahme aus. So konnte die Wärme leicht von den
Wicklungen abgeführt und es musste auch weniger Isolation verbaut werden.
Um eine optimale
Kühlung
zu erhalten, musste das
Öl
ebenfalls gekühlt werden. Das erfolgte einerseits über das Gehäuse und den
Fahrtwind, anderseits über eine künstliche
Ventilation.
Der Fahrtwind reichte bei der installierten
Leistung
nicht aus. Deshalb wurde das
Transformatoröl
mit einer an den
Hilfsbetrieben
angeschlossenen
Ölpumpe
künstlich in Bewegung versetzt und über eine kurze Leitung einem separaten
Ölkühler zugeführt.
Ein
Ventilator,
der unter dem
Triebwagen
im Bereich des
Transformators
eingebaut wurde, sorgte für einen künstlichen Luftstrom im Ölkühler. So
wurde dieser und das
Öl
optimal gekühlt, was letztlich dem Transformator zu Gute kam. Speziell
war, dass man hier nicht eine Kombination mit den
Fahrmotoren
suchte. Man konnte so jedoch lange Leitungen für das
Transformatoröl
einsparen und erreichte trotzdem eine gute
Kühlung.
Eine reine
Kühlung
mit Luft wählten die Konstrukteure für die
Fahrmotoren.
Für jedes
Drehgestell
stand ein eigener unter dem Dach montierter
Ventilator
zur Verfügung. Dieser bezog die benötigte Luft am seitlichen Rand des
Daches. Dort waren
Lüftungsgitter
vorhanden, die so die Zuführung der Luft mit Hilfe eines Unterdruckes
besorgten. Aus Erfahrungen mit anderen Baureihen, wurden hier Gitter mit
eingelegten
Filtermatten
verwendet.
Ein Umstand, dem man erst viele Jahre später eine grössere
Bedeutung zusprach. Hier jedoch nicht berücksichtigt wurde. Dabei war aber
wichtig, dass die
Venti-lation
immer lief und nicht abgestellt werden konnte. Wurde der Triebwagen im Winter im Freien abgestellt und musste der angehängte Zug geheizt werden, war die Ventilation jedoch hinderlich. Sie erzeugte im Bahnhof oder im Depot Lärm und sorgte dafür, dass die Bauteile unnötig gekühlt wurden.
In diesem Fall mussten die
Schaltautomaten
zu den drei
Ventilatoren
manuell ausgeschaltet werden. Nun stand die
Ventilation
aber auch nicht mehr zur Verfüg-ung, wenn gefahren wurde. Bei den Fahrmotoren angekommen wurde die Luft schliesslich durch die Motoren gepresst. Dabei kühlte sie die Wicklungen, schleppte den Abrieb und Staub mit und sorgte dafür, dass die Motoren trocken blieben.
Somit gab es bei der
Ventilation
zu den
Fahrmotoren
im Vergleich zu den anderen Baureihen keine grossen Unterschiede. Wenn man
diesen suchen wollte, lag das ganz klar bei der Tatsache, dass diese
Ventilation immer lief. Neben diesen grossen Verbrauchern waren auch viele kleinere Baugruppen vor-handen. Diese wurden von den Hilfsbetrieben auf unterschiedliche Weise versorgt. So war zum Beispiel die Anzeige der Spannung in der Fahrleitung direkt an den Hilfsbetrieben angeschlossen worden.
Diese funktionierte daher auch, wenn der
Depotstrom
angeschlossen wurde. Je-doch war die
Fahrleitungsspannung
erst nach dem Einschalten erkennbar.
Auch die
Heizung
mit
Widerständen
in den
Führerständen,
als auch die Heizung der
Frontscheibe
war an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen worden. Dadurch konnte der Lokführer seinen Arbeitsplatz von
der
Zugsheizung
und somit vom
Fahrgast-raum
unabhängig einstellen. Ein Umstand, der von den
Lokomotiven
übernommen wurde und hier deutlich zeigte, wie der
Triebwagen
eine Kombination zwischen
Personenwagen
und Lokomotive war.
Für die Ladung der für die
Beleuchtung
und der Steuerung wichtigen
Batterien,
war unter dem
Triebwagen
eine
Umformergruppe
eingebaut worden. Diese wurde mit einem
Schaltautomaten
an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen und wandelte den
Wechselstrom
in einem
Gleichstrom
für die Batterien um. Die
Leistung
war dabei so ausgelegt worden, dass die Umformergruppe zusätzlich auch die
Versorgung sicherstellen konnte.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||

 Kommen
wir nun zu den
Kommen
wir nun zu den
 Mit
einer
Mit
einer
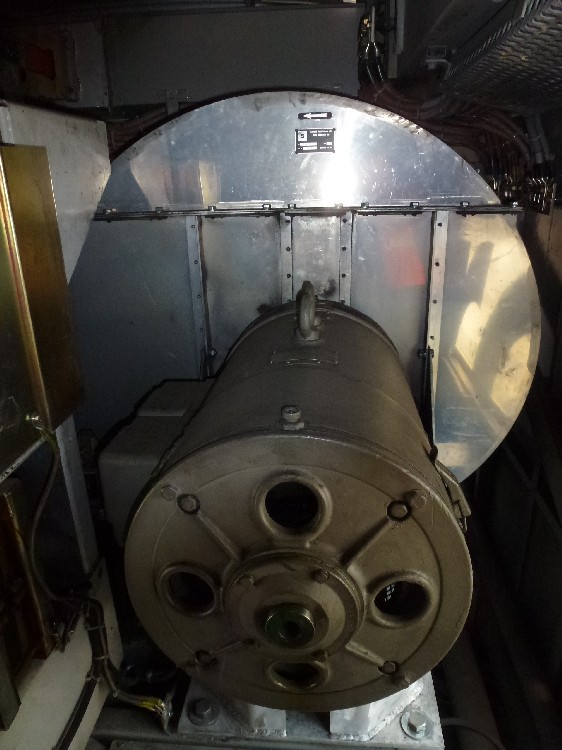 Die
angezogene Luft wurde im
Die
angezogene Luft wurde im