|
Steuerung mit Beleuchtung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Für die Steuerung, aber auch für die
Beleuchtung
musste ein von der
Fahrleitung
unabhängiges System eingebaut werden. Nur so konnten gewisse Funktion auch
dann bereitgestellt werden, wenn der
Triebwagen
gar noch nicht eingeschaltet war. Es lohnt sich daher, wenn wir uns diesen
Teil des Triebwagens etwas genauer ansehen und dabei beginnen wir, wie es
immer der Fall ist, mit der richtigen Wahl des
Stromsystems.
Speicherbar war damals nur der Gleichstrom. Dieser konnte in
Batterien optimal vorgehalten werden. Daher war auch hier klar, dass ein
Bordnetz mit
Gleichstrom
aufgebaut werden musste. Damit die neuen
Triebwagen
in diesem Bereich zu den älteren Fahrzeugen kompatibel blieben und weil
man auch auf genormte Teile zurückgreifen wollte, war klar, dass nur eine
Spannung
von 36
Volt
verwendet werden konnte.
Um auf die
Spannung
für das
Bordnetz
zu kommen, mussten zwei solcher Baugruppen in Reihe geschaltet werden. Das
hatte jedoch zur Folge, dass die Kapazität nicht gesteigert werden konnte. Gerade diese Erweiterung der Kapazität war wegen dem Aufbau nötig. Ein Triebwagen benötigt mehr Energie, als eine Lokomotive, weil hier auch die Abteile und deren Beleucht-ung hinzukamen.
Aus diesem Grund wurden insgesamt vier
Batterien
eingebaut worden, die zusätzlich auch parallelgeschaltet wurden und so die
doppelte Kapazität bereitstellen konnten. Eine Lösung, die bei grossem
Verbrauch immer wieder angewendet wurde. Eingebaut wurden die Batterien in zwei unter dem Boden angebrachten Behältern. Die zwei Batteriekästen waren identisch aufgebaut worden und sie besassen einen nach unten öffnenden Deckel.
Durch diese Ausführung wurden Gleitbahnen frei. So konnten die
schweren
Bleibatterien
leichter herausgezogen werden. Dort konnten sie schliesslich mit
speziellen Hebegeräten abgehoben und ausgewechselt werden. Ein Aufwand von
wenigen Minuten.
Ersatzbatterien in dieser Baugrösse, waren in den grösseren
Bahnhöfen
sogar am
Bahn-steig
vorrätig. So konnte an den Wagen eine defekte
Batterie
sehr schnell ausgewechselt werden. Im Notfall konnte das auch beim
Triebwagen
erfolgen, da hier die Position der Batterien auf genau der gleichen Höhe,
wie bei den Wagen erfolgte und so die Gerätschaften auch hier passten.
Wobei auf
Nebenstrecken
fehlten diese Einrichtungen.
Die Beleuchtung wurde nicht unabhängig von der Steuerung aufgebaut. Zwar gab es durchaus Bereiche, die von der Steuerung nicht beeinflusst wurden. Dazu gehörten Lampen, die in den technischen Schränken montiert wurden und die leuchteten, wenn die Türe geöffnet wurde.
Alle anderen
Beleuchtungen
konnten jedoch von der Steuerung geregelt werden. Dabei gab es zwei
grund-legend unterschiedliche Zustände, die näher betrachtet werden
müssen. Beginnen wir mit der Beleuchtung im inneren Bereich des Triebwagens. Hier gab es zwei grundlegend unterschiedliche Teilbereiche zu beachten. So wurden zu diesem Punkt die beleuchteten Instrumente in den Führerständen gezählt.
Aber auch die
Beleuchtung
der Abteile gehörte dazu. Diese wurde jedoch nur eingeschaltet, wenn
Reisende zu erwarten waren und wenn mit diesen in der Nacht und auf
Strecken mit
Tunnel
gefahren wurde. Eine spezielle Regelung gab es für die Deckenlampe in den beiden Führerständen. Wurde dieser besetzt, wurde die Lampe zur Beleuchtung des Führerstandes und konnte vom Lokführer beeinflusst werden.
Bei unbesetztem
Führerstand,
handelte es sich um eine Lampe der Abteile und wurde über deren Schalter
angesteuert. Schaltete der Lokführer den
Triebwagen aus, gab es im Führerstand automatisch
Licht.
Einfluss auf diese
Beleuchtung nehmen konnte der Lokführer. Er entschied,
ob die Abteile im ganzen Zug beleuchtet wurden oder nicht. Das
Zugpersonal hatte jedoch bei den Abteilen zusätzlich die Möglichkeit die
Beleuchtung jedes Fahrzeuges unabhängig zu schalten. In diesem Fall wurde
diese nicht mehr über die Steuerung, sondern direkt ab der
Batterie
versorgt. Ein Punkt, der gerade bei abgestellten
Triebwagen beachtet
werden musste.
Dabei wurde die obere Lampe mit
einer zweiten Lampe versehen, die ein rotes Glas erhalten hatte. Wichtig
dabei war, dass diese zwei Lampen in der Türe montiert werden mussten.
Damit waren sie nur korrekt ausgerichtet, wenn die Türe geschlossen war. Die unteren beiden Lampen waren über den beiden Puffern angeordnet worden. Sie hatten ein klares Glas erhalten und konnten daher nur weiss leuchten.
Die
damals noch verwendeten farbigen Bilder an dieser Stelle wurden mit
entsprechend gefärbten Vorsteckgläser verwirklicht. Ein solches Glas
musste auch verwendet werden um das normale
Zugschlusssignal zu
signalisieren. Damit gab es hier eigentlich keinen Unterschied zu anderen
Baureihen. Eingeschaltet wurde die Dienstbeleuchtung mit einem Steuerschalter. Dieser konnte jedoch nur grundlegend «Ein» oder «Aus» bestimmen. Welche Lampe wirklich leuchtete, war mit zusätzlichen Schaltern zu erstellen. Bei der oberen Lampe, konnte jetzt auch die rote Lampe beleuchtet werden. Parallel dazu, war aber auch die weisse Lampe möglich. Es war daher vom Fahrpersonal abhängig, dass die korrekten Signalbilde gezeigt wurden. Es wird nun Zeit, dass wir zur eigentlichen Steuerung des Triebwagens kommen. Diese hatte klare Aufgaben. So musste sie die vom Personal erteilten Befehle ausführen und gleichzeitig auch die korrekte Funktion gewisser Baugruppen überprüfen.
Die Befehle werden wir bei der Bedienung noch näher
ansehen, hier sind die Überwachungen viel wichtiger, denn diese hatten auf
das Fahrzeug mehr oder weniger grosse Auswirkungen. Mit Druckluft betrieben wurde die Türsteuerung. Sofern erforderlich, wurde damit ein Zylinder versorgt. Dieser drückte nun so auf die Türen, dass diese geschlossen wurden.
Eine Einrichtung, wie ein
Einklemmschutz, war
hingegen nicht vorhanden. Speziell war, dass die Türe durch den
Zylinder
blockiert wurde. Man konnte die Türe nur noch mit sehr viel Kraft
aufstossen. Eine normale Öffnung, wie im Abschnitt «Fahrgastbereich»
beschrieben, war jedoch nicht mehr möglich.
In den meisten Fällen, wurde
jedoch durch ein
Relais bei dessen Ansprechen, der
Hauptschalter
ausgeschaltet. Wobei hier das Relais zur Minimalspannung mit einer kurzen
Verzögerung versehen wurde. So führte ein kurzer Bügelsprung nicht gleich
zur Auslösung des Hauptschalters.
Mit
dem Befehl den
Hauptschalter auszuschalten wurden die
Relais
zurückgestellt. Der Schalter konnte nun wieder durch das Personal
eingeschaltet werden. Sprach das Relais erneut an, war die Fahrt jedoch
nicht mehr möglich und der Lokführer musste die Störung anhand der
Meldeklappen suchen und beheben. Er konnte so vielleicht einen Notbetrieb
herstellen, oder musste ein Ersatzfahrzeug anfordern. Das hing letztlich
vom betroffenen Relais ab. Neben diesen technischen Überwachungen der elektrischen Bereiche des Triebwagens, gab es noch die mechanischen und die menschlichen Kontrollen. Eine wichtige Kontrolle war dabei der Schleuderschutz.
Dieser wurde nur
benötigt, wenn das Fahrzeug ferngesteuert wurde und daher kein Lokführer
anwesend war. Es war jedoch auch auf dem besetzten
Triebwagen in allen
Funktionen aktiv und kontrollierte die Drehzahlen. Trat ein Ereignis beim Schleuderschutz auf, wurde in einer ersten Stufe nur eine Lampe aktiviert. Der Lokführer konnte so reagieren. Reichte dessen Massnahme nicht aus, wurde die Schleuderbremse angelegt und so versucht, die zu schnelle Achse abzubremsen.
Reichte auch das nicht mehr aus, wurde
die
Hüpfersteuerung beeinflusst und die
Fahrstufen abgeschaltet.
Anschliessend konnte durch das Personal wieder zugeschaltet werden. Überstieg die Drehzahl einer Achse den Wert von 121 km/h, wurde der Hauptschalter ausgeschaltet. Jedoch wurde nie eine Zwangsbremsung aktiviert. Der Grund lag beim Gleitschutz der mit dieser Einrichtung aufgebaut wurde.
Sprach dieser Teil des
Schleuderschutzes an, wurden mit
Ausnahme der
Schleuderbremse alle erwähnten Massnahmen umgesetzt. Nicht
erkennt werden konnte jedoch ein gleichmässiges Gleiten sämtlicher
Triebachsen.
Wurde dies unterlassen, passierte auf den ersten 50 Meter
nichts. Anschliessend wurde während weiterer 50 Meter eine akustische
Warnung ausgegeben und so der Lokführer vor seinem Versäum-nis gewarnt. Er
konnte nun die Einrichtung zurückstellen. Erfolgt auch jetzt keine Reaktion durch das Personal, wurde der Hauptschalter und somit Triebwagen ausgeschaltet. Durch die Steuerung wurde nun die Hauptleitung entleert und eine Zwangsbremsung eingeleitet.
Da die Leitung jedoch während diesem Vorgang vom
Bremsventil laufend mit
Druckluft versorgt wurde, kam es nicht zur komp-letten Entleerung der
Hauptleitung. Daher darf hier nicht von einer
Schnellbremse gesprochen
werden.
Die
Massnahme dieser als
Schnellgang
bezeichneten Funktion, konnte mit Drücken
des
Pedals aufgehoben werden. Da nun aber die Gefahr bestand, dass dieses
Pedal immer gedrückt wurde und weil nicht ausgeschlossen werden konnte,
dass dieses mit einem Gegenstand mutwillig blockiert wurde, gab es bei der
Sicher-heitssteuerung
eine zwei Überwachung, die jedoch längere Zeit
inaktiv blieb und als
Langsamgang bezeichnet wurde.
Diese
Wachsamkeitskontrolle sprach nach längerer Zeit mit einer akustischen
Warnung, die sich von jener des
Schnellgangs unterschied, an. Der
Lokführer hatte nun während 200 Metern Zeit, das
Pedal zu heben, oder aber
eine
Fahrstufe zu schalten, sowie eine pneumatische Bremsung auszuführen.
Erfolgte das nicht, wurden die gleichen Massnahmen aktiviert, wie beim
Schnellgang. Auch jetzt konnte mit einer der Handlungen eine Rückstellung
erfolgen.
All
diese Schutzfunktionen waren auch aktiv, wenn der
Triebwagen nicht bedient
wurde. Damit gerade die
Sicherheitssteuerung bedient werden konnte, musste
bei der
Vielfachsteuerung darauf geachtet werden, dass die Signale sicher
übertragen wurden. Wie bei allen Triebwagen der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB war eine solche Einrichtung vorhanden und sie diente in
erster Linie der
Fernsteuerung des
Triebfahrzeuges ab einem
Steuerwagen.
Verwendet wurde für die
Vielfachsteuerung der Kabeltyp I. Dieses wurde
schon bei den
Triebwagen der Baureihen
Ce
4/6 und Fe 4/4 verwendet. Das
verwendete Kabel hatte 30 Adern und war schon veraltet. Jedoch zeigten
gerade die erwähnten Triebwagen, dass die Funktion gewährleistet war und
dass damit im Gegensatz zur
Lokomotive der Baureihe
Ae 4/6 und zum
Triebwagen RFe 4/4 kaum Störungen zu erwarten waren.
Der Grund war simpel, denn noch war dieses
Kabel neu und man wollte im
Regionalverkehr noch Wagen älterer
Bauart
einsetzen. Die
Staatsbahnen wollten schlicht kein zweites Desaster nach
Muster
Ae 4/6. In der Folge war daher nur eine Vielfachsteuerung mit einem weiteren Trieb-wagen der Baureihe CFe 4/4 oder die Fernsteuerung ab einem passenden Steuerwagen möglich.
Die theoretische
Vielfachsteuerung mit den
Uralttriebwagen der ersten Gene-ration war dank dem gleichen Kabel
theoretisch möglich, wurde jedoch nicht vorgesehen und hätte schon wegen
der unterschiedlichen Anzahl
Fahrstufen nicht sonderlich gut funktioniert. Nicht direkt über die Vielfachsteuerung übertragen wurden die Relais. Diese schalteten auf dem ferngesteuerten Triebwagen den Hauptschalter aus. Da nun dieses Signal auch auf der Vielfachsteuerung übertragen wurde, schaltete auch der zweite Triebwagen aus.
Auf dem
Steuerwagen war jedoch
nur die fehlende
Zugkraft und der Ausfall der
Fahrleitungsspannung
zu erkennen. Die Suche der Störung erfolgte immer auf dem betroffenen
Fahrzeug.
Bleibt zum Schluss noch die auf dem
Triebwagen verbaute
Zugsicherung.
Diese war nur aktiv, wenn der
Triebwagen bedient wurde. Sie oder deren
Bedienung wurde auch nicht über die
Vielfachsteuerung übertragen. Damit es
keine fehlerhaften Funktionen im ferngesteuerten Zustand gab, wurde diese
mit einem Kontakt beim Hahn zu den
Bremsventilen aktiviert. War dieser
geschlossen, bewirkte die Zugsicherung nichts.
Die
automatische
Zugsicherung nach
Integra konnte die von den Geräten
übertragenen
Warnung erkennen. Diese mussten mit einem speziellen Schalter
durch den Lokführer quittiert werden. Erfolgte das nicht, wurde nach einer
Strecke von 50 Metern der
Hauptschalter ausgelöst und durch die
Sicherheitssteuerung eine
Zwangsbremsung eingeleitet. Eine Rückstellung
war jedoch nur mit der Betätigung des
Quittierschalters möglich.
Eine
Einrichtung, die auch reagierte, wenn ein rotes Signal passiert wurde, gab
es schlicht nicht. Diese war damals auch nicht nötig, weil die
entsprechenden Signale auch nicht damit ausgerüstet waren. Der
Triebwagen
hatte so aber eine moderne Steuerung erhalten. Wenn man einen Mangel
suchen wollte, dann wäre dieser beim Kabel der
Vielfachsteuerung zu
finden. Doch davon lassen wir vorerst die Finger und bedienen den
Triebwagen.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Als
Speichermedium wurden
Als
Speichermedium wurden
 Jedoch
war die Kapazität auch jetzt nicht unbegrenzt. Daher mussten diese
regelmässig geladen werden. Dazu wurde von den
Jedoch
war die Kapazität auch jetzt nicht unbegrenzt. Daher mussten diese
regelmässig geladen werden. Dazu wurde von den
 Wenn
wir zur
Wenn
wir zur
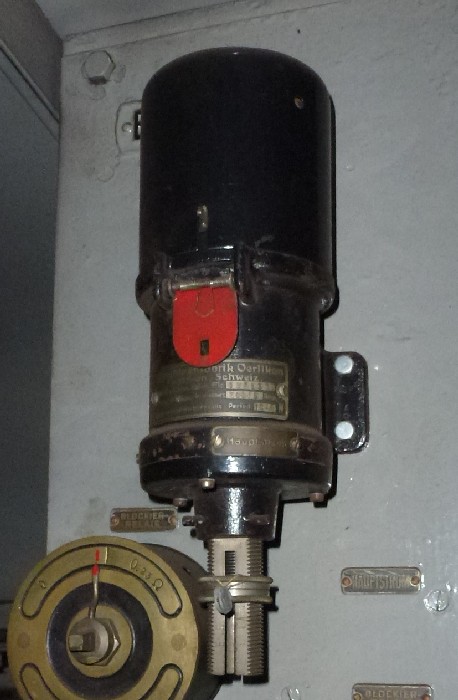 Die
Überwachung der technischen Funktionen erfolgte mit
Die
Überwachung der technischen Funktionen erfolgte mit  Um
mit dem
Um
mit dem
 Überraschend dabei war eigentlich nur, dass der
Überraschend dabei war eigentlich nur, dass der