|
Entwicklung und Beschaffung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Im Jahr 1987 kam die Idee auf, mit neuen
Neigezügen
den Verkehr mit Italien zu beschleunigen. Gerade die Strecke zwischen
Mailand und Genf war für solche Züge hervorragend geeignet. Viele gerade
Abschnitte, deren Geschwindigkeit oft nur wegen wenigen
Kurven
vermindert werden musste. Das war in Italien auch die Idee, die hinter
diesen speziellen Fahrzeugen steckte. Nur es war damit noch lange nicht
getan.
Aber auch viele andere Abschnitte im Land
würden passen. Diese Ideen waren revolutionär, denn ei-gentlich ging es
bei der Planung lediglich um neue Fahrzeuge für den recht wichtigen
Verkehr mit dem südlichen Nachbar. In der Schweiz kam eine richtige Euphorie auf. Bisher kaum bekannt, sahen viele Leute den Vorteil bei den Neigezügen. Viele Stimmen sprachen sogar davon, dass man ins Abseits geraten könnte. Noch ahnte niemand, dass solche Züge auch
im Land verkehren sollten. Die Technik war für das Land neu und die Bahnen
in der Schweiz sollten erneuert werden. Ein Beispiel war sicherlich die
neue
S-Bahn
in Zürich. Um überhaupt erste Erfahrungen mit dieser neuen Technik zu sammeln, musste in der Schweiz Ver-suchsfahrten durchgeführt werden. Die Idee mit
Einheitswagen III,
die mit einer aktiven
Neigetechnik
versehen werden könnten, schied schnell aus. Es musste ein passendes
Fahrzeug sein. Dieses gab es in Italien. Jedoch war es nicht für das
Stromsystem
der Schweiz geeignet. Technische Probleme sollten aber zu lösen sein. So fanden in der Schweiz auf mehreren
Strecken Versuche mit einem geschleppten italienischen
Triebzug
statt. Da es aber schneller um die
Kurven
ging, musste noch das passende
Triebfahrzeug
gefunden werden. Die neue
Lokomotive
Re 4/4 IV der Schweizerischen Bundesbahnen SBB war verfügbar und technisch
so ausgelegt, dass sie auch schneller um die Kurven fahren konnte. Eine
Neigetechnik
war jedoch nicht vorhanden.
Dabei wirkten auf den Lokführer und die
Leute im
Messwagen
erhöhte Fliehkräfte, jedoch nicht auf die Leute, die im
Neigezug
sassen. Um diese ging es letztlich bei den
Versuchsfahrten,
denn technisch wa-ren ja höhere Werte kein Problem. Die 1990 durchgeführten Versuche zeigten, dass auch in der Schweiz Neigezüge, die damals nach dem ita-lienischen Muster häufig «Pendolino» genannt wur-den, verkehren konnten. Damit war mehr oder weniger klar, dass man
solche Züge für den Verkehr nach Italien beschaffen könnte. Die erhoffte
Reduktion der
Fahrzeit zwischen den erwähnten Zentren war so möglich und man konnte
die
Ausschreibung
für die neuen Züge präzisieren. Die Hersteller in der Schweiz begannen
daraufhin mit eigenen Versuchen. Man musste den Rückstand auf die
italienischen Hersteller innert kurzer Zeit aufholen. Schliesslich ging es
um einen lukrativen Auftrag, den man gerne an Land holen würde. Dabei
stellte sich aber auch gleich die Frage nach der
Neigetechnik,
denn wie durch ein Wunder gab es auch eine zweite Lösung für das Problem
und die fand man bei der Armee. Eine Lösung war der Weg mit einer
Kooperation. Bei den
Neigezügen
in Italien war der Hersteller Fiat führend. So suchte man dieses Wissen um
die Erfahrung ins Land zu holen. Andere Firmen gingen jedoch andere Wege.
Dort versuchte man es mit einer mechanischen Lösung. Diese stammte aus dem
Kampfpanzer «Leopard II» und wurde für die Ausrichtung des Rohres genutzt.
Das war schnell genug für einen Neigezug.
Sie werden in einem eigenen Artikel
vorgestellt und wir kehren zur Entwicklung des Zuges zurück, der die
Schweiz mit Italien verbinden sollte. Während die Hersteller in der Schweiz ihre Projekte bauten und mit Versuchen begannen, schoss sich die Politik auf die neuen schnellen Züge ein. Damit war es aber noch lange nicht getan, denn die Bahnen mussten auch noch von den Triebwagen überzeugt werden. Genau dort lag letztlich das Problem, das
man noch lösen musste. So simpel sich die Sache anhört, war sie auch
wieder nicht, aber man musste jemanden finden, der die neuen Züge
bestellte. Jedoch hatten die beteiligten Bahnen an dem neuen Zug wenig Interesse, denn niemand wollte den teu-ren Zug alleine finanzieren und dann auf der Strek-ke alleine betreiben. Die neuen Züge konnten nur finanziert
werden, wenn man zwischen den beteiligten
Bahngesellschaften
eine Lösung für die Finanzierung fand. So einfach, wie man meinen könnte,
war das auch wieder nicht, denn zu unterschiedlich waren die Interessen. Nach langen Verhandlungen zwischen den
Bahngesellschaften
einigte man sich schliesslich auf die Gründung einer eigenständigen
Gesellschaft, die sich für die Beschaffung und den Betrieb der neuen
Neigezüge
verantwortlich zeigen sollte. Damals eine Neuerung, welche jedoch die
Zusammenarbeit der Bahngesellschaften verbessern sollte. Das war durchaus
keine schlechte Idee, wenn man grosse Projekte finanzieren musste.
Man erhoffte sich so gewisse Vorteile bei
den Risiken, die durch solche Gesellschaften im Ausland entstehen
konn-ten. Zumindest hatte man nun eine Aktiengesellschaft und die musste
eine Aufgabe wahrnehmen können. Die Aufgabe der neuen, von den Bahngesellschaften unabhängig arbeitenden Firma war klar, denn sie sollte die neuen Züge beschaffen und anschliessend eigenständig betreiben. Nur das fahrende Personal wurde von den
jeweiligen Bahnen gestellt. Wie es sich jedoch mit den komplizierten
rechtlichen Verhältnissen innerhalb der neuen Aktienge-sellschaft
darstellte, war schon ein anderes Thema, das wir auch behandeln müssen. Aufgeteilt war das Aktienkapital der
Cisalpino AG in meh-rere Teilhaber. 50% der Aktien und somit die Hälfte
der Gesellschaft lagen dabei in den Händen der Italienischen Staatsbahnen
FS. Womit eigentlich die Italiener in der Schweizer Firma das Sagen
hatten, denn die anderen Teilhaber schafften bei Streitigkeiten keine
Mehrheit und eine Lösung gab es so nicht. Doch wer waren die anderen
Teilhaber? Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
hielten 40% der Aktien und waren daher der zweitgrösste Teilhaber. Die
restlichen 10% der Aktien und somit eine Minderheit, teilten sich auf die
Lötschbergbahn (6%) und die Westschweizer Kantone (4%) auf. Man konnte
daher von einer Patsituation zwischen der Schweiz und Italien sprechen.
Letztlich erreichte man ohne die FS jedoch innerhalb der Firma Cisalpino
AG nichts.
Der Grund, war in Italien zu finden, denn
die FS wollte Komponenten anderer Züge nutzen können und so poch-ten sie
auf italienische Züge. Sehr zum Missfallen der schweizerischen Teilhaber.
Doch blicken wir zuerst ins
Pflichtenheft. Man forderte einen neunteiligen
Triebzug
mit
Neige-technik
und elektrischem Fahrantrieb. Dabei sollten die beiden
Stromsysteme
in der Schweiz und in Italien abge-deckt werden. Es war also von einem
Zweisystemzug die Rede und mit neun Wagen solle der Zug eine Länge von
ungefähr 240 Meter haben. Damit war auch klar, dass es keine
Vielfachsteuerung
braucht, denn von der Länge her wäre der Zug für die Schweiz zu lange
gewesen. Gerade diese Länge war ein Wunsch der FS.
Ähnliche nur für Italien beschaffte Züge konnten so in der Entwicklung
berücksichtigt werden. Man erhoffte sich so auch, dass die Vorhaltung von
Ersatzteilen vereinfacht wird. Italien war gut abgedeckt, was von den
anderen beteiligten Bahnen nicht gesagt werden kann. Die mussten daher die
Teile bei den FS beziehen, was natürlich verrechnet werden sollte und so
Geld ins Land brachte. Es muss erwähnt werden, dass damals bei den meisten
Erbauern von Fahrzeugen für den Schienenverkehr noch jedes Modell einzeln
geplant und gebaut wurde. Die heute üblichen Lösungen mit einer Art
Baukasten, wurden erst danach entwickelt. Mit der Wahl eines
vergleichbaren
Triebzuges konnte die Cisalpino AG auch die hohen Kosten
für die Entwicklung sparen. Gerade bei einem
Neigezug
waren diese bisher
sehr hoch.
Nur auf eine hohe Geschwindigkeit getrimmte
Antriebe waren daher ausgeschlossen worden. Doch bei der Forderung gab es
noch ein sehr grosses Problem, das nicht so leicht gelöst werden konnte. Neigezüge sind eigentlich nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet. Die Führung der Radsätze muss bei solchen Zügen zu Verminderung der Kräfte im Gleis flexibel aufgebaut werden. Für hohe Geschwindigkeiten waren jedoch starr geführte Achsen wichtig. Mit dem
Wert von 200 km/h sollte ein Mittelwert erreicht werden. Das Problem
konnte mit aktiv gesteuerten
Radsätz gemildert werden. Die gab es in der
Schweiz, wo aber nicht gebaut wurde. Zudem wurde damals keine der vorgesehenen Strecken schneller be-fahren. Selbst die ersten Planungen für einen neuen Alpentunnel in der Schweiz gingen davon aus, dass dort nicht schneller gefahren werden sollte. Das Land mit den hohen Bergen war nicht für hohe
Geschwindigkeiten geeignet. Damals war in der Schweiz noch nicht restlos
klar, ob der neue
Neigezug
der Firma Cisalpino AG überhaupt so schnell
fahren kann. Die Schweiz entwickelte damals gerade das
Signalsystem N. Dieses war so ausgelegt worden, dass auch mit mehr als 160
km/h gefahren werden konnte. Als Ergänzung dazu, sollte eine
Zugbeeinflussung mit
Bremskurven eingeführt werden. Beide hier erwähnten
Ideen kamen in Betrieb, aber damals steckten diese wirklich noch in den
Kinderschuhen. Zudem sollte mit Aussensignalen nicht schneller als 160
km/h gefahren werden.
Das
heisst, er musste Wagen der ersten
Wagenklasse, ein-en
Speisewagen und
natürlich die Wagen zweiter Wagen-klasse besitzen. Alle Fahrzeuge mussten
zudem mit
Klimaanlagen versehen werden, denn auch das wurde bei einem
Eurocity gefordert. Sie sehen damit waren gewisse Punkte klar umschrieben. Aufgeteilt werden sollten die Plätze im Verhältnis
von 1:2. Der Zug bekam daher insgesamt ungefähr 470 Sitzplätze. Für einen
Neigezug
war das damals ein hoher Wert. Wobei wir auch eingestehen müssen,
dass es solche Modelle in Europa bisher nur in Italien gab und dort hatte
sich diese Aufteilung durchaus bewährt. Dass es in der Schweiz etwas
anders aussehen könnte, war den Leuten bekannt, das wurde jedoch
ignoriert. Bei den Zügen in der Schweiz waren die Verhältnisse
oft zu Gunsten der zweiten
Wagenklasse verschoben worden. Nur in den
Zügen, wo mit vielen Geschäftsleuten gerechnet werden musste, wurden die
Verhältnisse zu Gunsten der ersten Klasse verschoben. Bei
Triebzügen
konnte das natürlich nicht jeden Tag neu angepasst werden. Daher wurde
einfach ein Wert genommen. Ob der passte, musste der Betrieb zeigen. Unter diesen Vorgaben, die im Lauf der Ausschreibung
immer wieder angepasst und verändert wurden, war es für die vielen
Hersteller schwer eine optimale Eingabe einzureichen. War das Modell
fertig, wurde einfach wieder ein Bauteil anders gewünscht. Die Anbieter
mussten dann wieder über die Bücher und so das Modell nach den neuen
Wünschen gestalten. Eine richtige Mitsprache hatten sie dabei jedoch
nicht.
So abwegig war das nicht, aber in Italien sollen die Uhren
bekanntlich etwas anders laufen. Wurde das Modell der FS angepasst,
erfolgte nur wenige Zeit später jene für das Modell der Cisalpino AG. Letztlich war es jedoch soweit und die Cisalpino AG be-stellte die neun benötigten Züge. Da die meisten Herstel-ler schon das Handtuch geworfen hatten, war sofort klar, der neue Zug wird in Italien gebaut. Als dann noch als Muster
die Baureihe ETR 460 der FS angegeben wurde, war auch klar, wer da die
Hände im Spiel hatte, es war jener, der bei der neuen Firma
un-eingeschränkte Macht genoss und das nun bei der Be-schaffung auch
ausspielte. Das obwohl man bei der FS mit den nagelneuen
Neigezügen der Baureihe ETR 460 schlicht keine Erfahrung hatte, denn diese
wurden schliesslich auch erst gebaut. Verkehrt war also vom Muster noch
kein einziger
Triebzug und die Ausrüstung für zwei
Stromsysteme musste
auch noch umgesetzt werden. Wann der Hersteller zuletzt ein
Triebfahrzeug
für
Wechselstrom geliefert hatte, war schlicht nicht klar zu beantworten. Begründet wurde der Entscheid der Cisalpino AG
schliesslich mit den vom Hersteller bereits getätigten Erfahrungen im
Bereich der
Neigetechnik. Keine Chance hatten die gut aufgestellten
Hersteller aus der Schweiz, die mit einem mechanischen Stellantrieb
offerierten. Was dieser konnte, zeigte er jeden Tag im Kampfpanzer und
später dann mit der Reihe RABDe 500 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB,
bei der die Leute weniger Probleme hatten.
Wer nun aber moniert, dass auch beim ETR 460
ein solcher Antrieb verwendet wurde, liegt gar nicht so falsch, denn die
hydraulische Lösung war das Steckenpferd des italienischen Herstellers
Fiat. Sollen die Gewindestangen der anderen brechen, das
Öl floss, wenn
auch in den Boden. Einige Komponenten der neuen Züge sollten in der Schweiz gebaut werden, jedoch sollte der Hauptteil in Italien gefertigt werden. Dazu sah man die Firma Alstom vor, die vor kurzem die italienischen Firmen übernommen hatte. Dass das nur als Zückerchen für die
benachteiligten Hersteller aus der Schweiz angesehen wurde, war wohl allen
Lesern klar. Man wollte damit die Cisalpino AG nicht schon beerdigen,
bevor die Züge geliefert wurden. Jedoch muss man auch eingestehen, dass das Konstrukt dieser Cisalpino AG nicht funktionieren konnte. Wenn eine Bahnge-sellschaft 50% der Aktien zugeschlagen bekommt, kann sie handeln, wie sie will. Ein
anderer Verteilschlüssel hätte andere Lösungen zur Folge gehabt. Aber
alles der FS in die Schuhe zu schieben, war nicht fair. Von den anderen
Aktionären war so viel Motivation vor-handen, dass es zum Glas bei einer
Presseveranstaltung reichte. Auf jeden Fall war nun klar, wer die
Neigezüge für
den Verkehr zwischen der Schweiz und Italien bauen sollte. Auch wenn die
Industrie in der Schweiz das nicht eingestehen wollte. Man hatte zwar die
funktionierende Technik, aber in einem Zug eingebaut und erprobt war diese
schlicht noch nicht. Daher war der Entscheid der Cisalpino AG nicht so
falsch. Man konnte es nicht jedermann recht machen und das war das
Problem.
Ein Vorteil, der zur Hoffnung
Anlass gab, dass mit einer kurzen Lieferfrist zu rechnen war, denn gerade
dort schwiegen sich die Italiener immer wieder aus. Einmal war es so, dann
doch wieder anders. Die neu zu beschaffenden Züge sollten als Reihe ETR
470 bezeichnet werden. Auch hier zeigte sich die italienische Hand, denn
man verwendete eine Bezeichnung nach italienischem Muster und nicht nach
der in der Schweiz üblichen Art. Der Vorteil sah man bei den
Zulassungen,
denn im Gegensatz zur Schweiz mussten sämtliche in Italien verkehrenden
Züge eine italienische Bezeichnung tragen. Eine Vorschrift, die später zu
doppelten Bezeichnungen von Zügen führen würde. Man sah insgesamt neun
Triebzüge der Baureihe ETR 470
vor. Dabei sollten acht Züge planmässig eingesetzt werden, während beim
verbliebenen Zug der reguläre Unterhalt ausgeführt wurde. Eine Lösung, die
man als knappe Planung verstehen kann, denn ein einziger Ausfall hatte
bereits grosse Folgen. Zumindest dann, wenn ein Zug im Unterhalt war und
nicht eingesetzt werden konnte. Der FS war das sicher bekannt. Damit haben wir nun den gewünschten
Neigezug für den
Verkehr nach Italien erhalten und können uns der mechanischen Konstruktion
des Zuges zuwenden. Es wird Sie sicherlich nicht mehr überraschen, wenn
ich erwähne, dass einige Punkte den
Triebzügen ETR 460 entsprachen.
Meistens erfolgten nur die notwendigen Anpassungen an den Einsatz unter
Wechselstrom. Doch beginnen wir mit dem ETR 470 und bauen den Zug auf.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 So
sprangen auch andere Strecken ins Blickfeld der Planer. Die
So
sprangen auch andere Strecken ins Blickfeld der Planer. Die
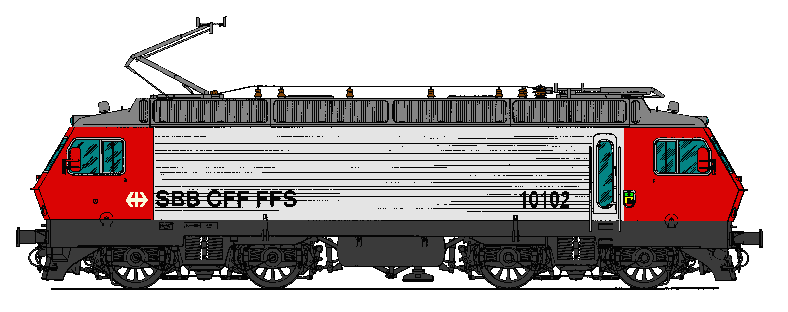 Mit
einer
Mit
einer
 Um
in der Zeit etwas vorzugreifen, muss erwähnt werden, dass die mechanische
Lösung aus dem Kampfpanzer funktionierte. Die später an die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgelieferten
Um
in der Zeit etwas vorzugreifen, muss erwähnt werden, dass die mechanische
Lösung aus dem Kampfpanzer funktionierte. Die später an die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB ausgelieferten
 Daher
wurde am 25. November 1993 die Aktienge-sellschaft Cisalpino AG gegründet.
Mit dem Geschäftssitz in Bern, war die neue Firma zumindest nach aussen
hin eine Gesellschaft nach Schweizer Recht.
Daher
wurde am 25. November 1993 die Aktienge-sellschaft Cisalpino AG gegründet.
Mit dem Geschäftssitz in Bern, war die neue Firma zumindest nach aussen
hin eine Gesellschaft nach Schweizer Recht. Deutlich
zeigte sich das letztlich bei der Beschaffung der neuen Züge. Obwohl die
schweizerischen Hersteller funk-tionierende
Deutlich
zeigte sich das letztlich bei der Beschaffung der neuen Züge. Obwohl die
schweizerischen Hersteller funk-tionierende
 Mit einer
Mit einer
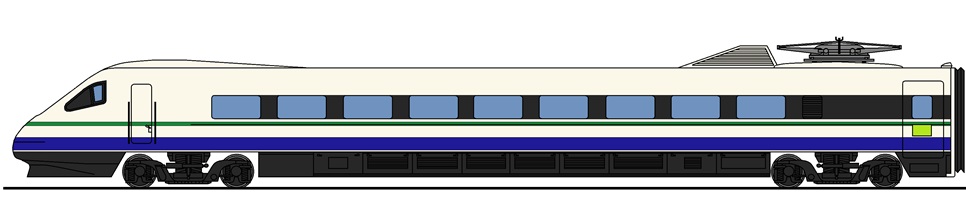 Damit der Zug im interna-tionalen Verkehr eingesetzt
werden konnte, musste er den Anforderungen eines
Damit der Zug im interna-tionalen Verkehr eingesetzt
werden konnte, musste er den Anforderungen eines
 Daher war man sich in Fachkreisen schnell einig, dass
die Lieferung der Züge schon klar war, als man die
Daher war man sich in Fachkreisen schnell einig, dass
die Lieferung der Züge schon klar war, als man die
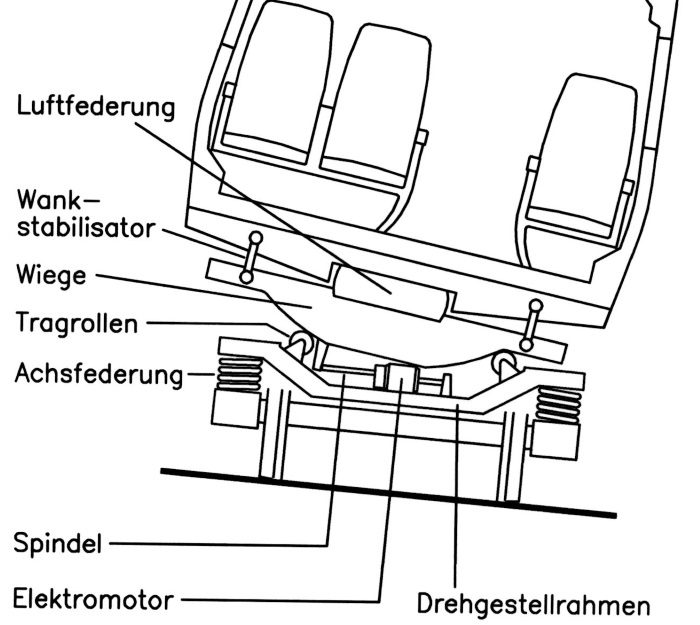 Offenbar traute man beim Besteller der aus der
Rüstungsindustrie stammenden Technik nicht über den Weg und wählte einen
hy-draulischen Stellantrieb.
Offenbar traute man beim Besteller der aus der
Rüstungsindustrie stammenden Technik nicht über den Weg und wählte einen
hy-draulischen Stellantrieb. Als Lieferant der Baureihe ETR 450 hatte der
Hersteller schon gute Erfahrungen machen können. Zudem baute die Firma
bereits die neuen
Als Lieferant der Baureihe ETR 450 hatte der
Hersteller schon gute Erfahrungen machen können. Zudem baute die Firma
bereits die neuen