|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Druckluft bei einem Fahrzeug
der Eisenbahnen gehörte mittlerweile dazu, wie die
Räder auf denen es
abgestellt wurde. Seinerzeit für die
Bremsen eingeführt, übernimmt
Druckluft mittlerweile auch andere Funktionen. Bei diesem
Triebzug war das
nicht anders und daher müssen wir uns deren Erzeugung etwas genauer
ansehen, denn diese hatte sich in den Jahren seit der Einführung der
Druckluft deutlich verändert.
Diese waren über eine Leitung, die wir noch
kennen lernen werden, miteinander verbunden. Speziell dabei war, dass ein
Kompressor durchaus in der Lage war, den kompletten
Triebzug mit der
benötigten
Druckluft zu versorgen. Das zweite Modell war Reserve. Da nun wirklich niemand einfach zum Spass einen Kompressor spazieren fährt, muss der Grund erwähnt werden. Bei den Trieb-zügen wurde ein sehr hoher Standard bei der Verfügbarkeit angestrebt.
Daher sollte ein einfacher Ausfall nicht dazu
führen, dass die ge-wollte Fahrt beendet werden kann. Daher wurde der
Ersatz vor-gesehen. Die Steuerung sorgte jedoch dafür, dass jeder
Kompressor über die gleiche Anzahl der Betriebsstunden verfüg-te.
Wenn wir nur den
Kompressor
alleine betrachten, hätten wir ein Problem. Er war vielmehr ein Teil der
Luftaufbereitung. Doch in diesem Teil war der für die Erzeugung benötigte
Schraubenkompressor vorhanden. Dieser war so ausgelegt worden, dass er für
einen
Triebzug und eine weitere Einheit, die geschleppt wurde, ausreichte.
Daher konnte er natürlich auch mit einer geringeren
Leistung versehen
werden, was ebenfalls half Gewicht zu sparen.
Dieser
Kompressor wurde
zusammen mit dem
Kühler und dem
Lufttrockner in einem kompakten Dachgerät
montiert. Das Gerät selber war schwingungstechnisch vom Fahrzeug
entkoppelt worden, so dass der Einsatz des Kompressors von den Fahrgästen
nicht gehört wurde und dieser sehr ruhig lief. Trotzdem müssen wir uns
dieses Bauteil etwas genauer ansehen. Wichtig war nur, bei einem Tausch
wurde alles gewechselt.
Daher wurde zuerst mit der
Kühlung verhindert,
dass davon zu viel ausge-schieden wurde. Das
Kondensat
wurde anschliessend
vom
Lufttrockner ab-geführt. Es wurde in einem Behälter gesammelt und
konnte in einer Werk-statt fachgerecht entsorgt werden. Diese Massnahme verhinderte, dass die Luft zu trocken wurde, aber dass auch kein Eis entstehen konnte. Daher konnte die Druckluft nun direkt den Hauptluftbehältern zugeführt werden.
Bei jedem
Triebkopf stand dabei ein Volumen von 300 Litern zur
Verfügung. Für den kompletten Zug bedeutete das, dass ein ausreichendes
Reservoir vorhanden war. Zusätzlich wurden noch kleinere Behälter bei den
Zwischen-wagen verbaut.
Da auch hier der
Kompressor
durchaus mehr
Druckluft erzeugen konnte, als die Verbraucher in der Regel
verbrauchten, stieg der
Luftdruck an. Dieser war in den Behältern auf
einen Wert von zehn
bar beschränkt worden. Das dabei erforderliche
Überdruckventil war ebenfalls Bestandteil der Luftaufbereitung auf dem
Dach des Fahrzeuges. Wir haben daher eine Lösung erhalten, die bei vielen
anderen Baureihen verwendet wurde.
Die so erzeugte
Druckluft
wurde in den
Hauptluftbehältern gespeichert. Das galt jedoch auch, wenn
der
Triebzug abgestellt war. Die sonst üblichen Hähne zu den
Hauptluftbehältern waren daher auch hier vorhanden. Jedoch wurden diese
durch die Steuerung geschlossen und geöffnet. Das Problem mit der
fehlenden Druckluft konnte daher auch hier entstehen. Aus diesem Grund
musste für diesen speziellen Fall eine Lösung vorgesehen werden.
Vielmehr wurde mit dem Kompressor nur die Druck-luft erzeugt, die für den Stromabnehmer und den Hauptschalter benötigt wurde.
Er war so
lange im Betrieb, bis in den Leitungen ein ausreichender Druck vorhanden
war und es so kei-ne Probleme gab. Kehren wir jedoch zu den Hauptluftbehältern und damit zum normalen Fall zurück. Diese waren mit der Speiseleitung verbunden worden. Diese wurde durch den ganzen Zug geführt.
Zusätzlich wurde sie auch zu den
automatischen Kupplungen geführt und
konnte daher auch von ein-em angehängten und geschleppten
Triebzug genutzt
werden. Einen grossen Unterschied zu den anderen Baureihen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB gab es jedoch nicht.
Damit können auch wir uns den
an dieser
Speiseleitung angeschlossenen Verbraucher zuwenden. Die dazu
erforderlichen EP-Ventile und
Absperrhähne wurden an einem zentralen
Luftgerüst montiert. Dort befanden sich die einzelnen Baugruppen, deren
Stellung so ausgelegt war, dass schnell eine Abtrennung erkannt werden
konnte. Eine Lösung, die bei Fahrzeugen aus Schweizer Produktion schon
seit Jahren umgesetzt wurde.
Im Gegensatz zu anderen
Triebzügen waren jedoch eher wenige Verbraucher vorhanden, da gewisse
Funktionen elektrisch gelöst wurden und es auch keine
Trennhüpfer mehr
gab. Trotzdem gab es diese Verbraucher und dabei haben wir im Kapitel
<<Laufwerk mit Antrieb>> die
Sandstreueinrichtungen bei den
Triebachsen
bereits kennen gelernt. Sie wurde dabei direkt an der
Speiseleitung
angeschlossen und arbeitete daher mit einem veränderlichen Druck.
Es gab
bei diesem
Triebzug zwei Signalhörner. Diese erzeugten einen Ton mit 370
und 600
Hertz. Daher konnten diese Töne separat erzeugt werden, was
verhinderte, dass die übliche Klangfolge der Schweiz ertönte. Weitere von den Bremsen unabhängige Verbraucher des Fahrzeuges konnten nicht über die Speiseleitung angeschlossen werden. Der Grund dafür war, dass hier für die korrekte Funktion ein genau definierter Luftdruck vorhanden sein musste.
Daher wurde an der
Speiseleitung ein
Druckredu-zierventil angeschlossen.
Dieses
Ventil reduzierte den Wert in der anschliessenden
Apparateleitung
auf einen
Luftdruck von 6.3
bar.
Nutzer der
Apparateleitung
befanden sich im Bereich der
Drehgestelle und im Bereich des
Führerstandes. Beim Führerstand waren das die beiden seitlich montierten
Rückspiegel. Diese konnten mit Hilfe der
Druckluft ausgeklappt werden. Je
nach Geschwindigkeit und Land, schlossen sich diese Spiegel automatisch,
oder wurden in der offenen Stellung behalten. Eine Lösung, die schon bei
der
Lokomotive
Re 460 angewendet wurde.
Im Bereich des
Triebdrehgestelles wurde die benötigte
Spurkranzschmierung an der
Apparateleitung angeschlossen. Diese drückte mit dem vorhandenen
Luftdruck
das
Schmiermittel in regelmässigen Abständen an den
Spurkranz. Dabei war
jedoch immer nur die Anlage des vorlaufenden
Triebkopfes aktiv, so dass
auch die anderen
Radsätze dadurch geschmiert wurden. Die zusätzliche
Reduktion der Kräfte war bei der
Zulassung zur
Zugreihe R wichtig.
Die Luftfedern der Laufdrehge-stelle waren jedoch mit einer eigenen Leitung versehen wor-den. Daher wurde auch bei diesem Triebzug nur die Speiseleitung durch das ganze Fahrzeug ge-führt.
Damit sind wir wieder bei
die-ser Leitung und können deren grössten Verbraucher kennen-lernen. Auch bei diesem Triebzug wa-ren die pneumatischen Bremsen der wichtigste Verbraucher der Druckluft. Diese wurden an der Speiseleit-ung angeschlossen und dabei gab es, wie bei den meisten Triebfahrzeugen zwei Systeme.
Gleichzeitig wurde jedoch auch
Druckluft benötigt um die bei den
Triebdrehgestellen vorhandene
Federspeicherbremse zu lösen. Daher konnten nur diese
Drehgestelle zur
Sicherung
des Zuges genutzt werden, was jedoch durchaus ausreichend war.
Bevor wir zu den normalen
Bremssystemen
kommen betrachten wir eine
Bremse, die lediglich auf die
Triebdrehgestelle wirkte. Das war die
Schleuderbremse und diese wirkte
nicht auf die üblichen mechanischen Bremsen des Zuges. Sie wurde einem
Bremszylinder
zugeführt, der über ein einfaches
Bremsgestänge
an einem
Bremsklotz
angeschlossen war. Jedoch war kein
Gestängesteller vorhanden, die
das Gestänge der Abnützung anpasste.
Der
Bremsklotz bestand aus
Sintermetall. Dieses raute die
Laufflächen nicht so stark auf, wie das bei
Bremsklötzen aus Guss der Fall war. Jedoch sorgten sie durch die auf die
Lauffläche wirkende Kraft, dass das
Rad nicht durchdrehen konnte.
Gleichzeitig wirkte der Bremsklotz auch als Putzklotz, der die Laufflächen
vor anhaftendem Laub befreite und so für saubere Laufflächen sorgte. Daher
wurde diese
Bremse auch als Putzklotzbremse bezeichnet.
Wir kommen nun zu den anderen
pneumatischen
Bremssystemen. Diese wirkten jedoch nicht auf die zuvor
vorgestellte
Klotzbremse. Daher waren sie völlig davon unabhängig. Auch
sie wurden mit
Druckluft betrieben, die von der
Speiseleitung abgenommen
wurde. Hier wollen wir, wie bei den anderen
Triebfahrzeugen, mit der
direkten Bremse beginnen. Dieses einfache Bremssystem war jedoch nicht
mehr als
Rangierbremse ausgeführt worden.
Stattdessen wurde eine direkt
wirkende
EP-Bremse eingebaut. Diese bestand aus zwei separaten
Kreisen,
die von der Steuerung geregelt wurden. So konnten die mechanischen
Bremsen
der
Laufachsen wirksam werden, während jene der
Triebachsen nicht wirkten.
Wichtig war das bei Anwendung der
elektrischen
Bremse, die somit immer
wirksam blieb. Es konnte so eine optimale Wirkung der Bremsen umgesetzt
werden.
Um zu verhindern, dass dabei die Laufachsen bei starken Bremsungen blockierten, war jede Achse mit ein-em eigenen Gleitschutz versehen wor-den.
Dieser regelte die
Bremskraft
der
Laufachsen so, dass
eine möglichst gute Bremswirkung erreicht wurde. Der
Gleitschutz bei den
Triebrädern war hingegen Bestandteil des
Schleu-derschutzes. Als zweites Bremssystem kam eine in-direkt wirkende Bremse zum Einsatz. Dabei wurde die übliche automatische Bremse verwendet.
Diese wurde mit der normalen
Hauptleitung
betrieben und die
Bremsen reagierten in jedem Fall auf eine Absenkung des
Druckes. Diese Absenkung erfolgte in der Regel durch das Bedienpersonal,
aber sie konnte auch von einer
Sicherheitseinrichtung, oder von einer der
im Zug verbauten
Notbremse kommen.
Vorteil dieser
automatischen Bremse mit
Steuerventil war, dass der
Triebzug mit jedem beliebigen
Fahrzeug abgeschleppt werden konnte, und dabei erst noch über die normalen
pneumatischen
Bremsen verfügte. Deshalb wurde die
Hauptluftleitung auch in der
automatischen Kupplung auf andere Fahrzeuge übertragen. Jedoch war nicht
vorgesehen, dass mit dem Fahrzeug auch Wagen geschleppt würden. Wobei dies
technisch möglich gewesen wäre.
Sowohl die direkte
EP-Bremse,
als auch die
automatische Bremse, wirkten auf mehrere
Bremszylinder. Diese
wiederum pressten durch die einströmende
Druckluft die
Bremsbeläge gegen
die rotierende
Bremsscheibe und verzögerten so das Fahrzeug. Verwendet
wurden wegen dem verfügbaren Platz
Scheibenbremsen, die direkt an den
Rädern montiert wurden. Diese
Radscheibenbremsen waren dabei sehr
leistungsfähig.
Dabei waren die
beiden
Zylinder einer
Achse mit der Luftleitung so verbunden, dass sie
nicht unabhängig arbeiten konnte. Es war daher auch hier immer nur jede
Achse separat angeschlossen worden. Eine Lösung, die besonders bei
Störungen hilfreich war. Gerade bei Störungen konnten die Scheibenbremsen jedoch nicht kontrolliert werden. Damit deren Zustand jedoch geprüft werden konnte, wurde für jede Achse eine Anzeige montiert.
Diese Anzeige bestand aus drei Feldern, die mit Symbolen und Farben
definiert wurden. Bei der grünen Fläche waren die
Bremsen lose. Rot mit
schwarzem Punkt, bedeutet fest und weiss mit einem Kreuz zeigte eine
fehlerhafte Anzeige an.
Es wird Zeit, dass wir uns
die Berechnung der
Bremsen ansehen. Wir ersparen uns dabei den Weg über
die
Bremsgewichte und benutzen gleich das
Bremsverhältnis. So wurde in
diesem Fall ein Bremsverhältnis von 170% angegeben. Obwohl bei der
automatischen Bremse die üblichen Gewichte für die
P-Bremse vorhanden
waren, wurde in jedem Fall mit der
R-Bremse gerechnet. Eine Umstellung war
schlicht nicht möglich, die R-Bremse wirkte immer.
Das
Bremsverhältnis war
ausreichend, dass der
Triebzug in der Schweiz problemlos nach der höchsten
Bremsreihe für die
Zugreihe R verkehren konnte. Auch deren
Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h war eigentlich kein Problem. Sie sehen,
dass sehr viel Wert auf eine gute Verzögerung gelegt wurde. Ein wichtiger
Punkt bei der
Stadtbahn in Zug, wo eine kurze Abfolge der Halte vorhanden
war. Trotzdem war die Höchstgeschwindigkeit ein Problem.
Zwar reichten die Werte, jedoch verlangten die Vor-schriften bei mehr als
140 km/h zusätzlich eine von der Drehung der
Räder unabhängige
Bremse.
Diese war bei diesem
Triebzug als
Magnetschienenbremse ausgeführt worden.
Die Ansteuerung unterschied sich jedoch von anderen Fahrzeugen.
Aktiviert wurde die
Magnetschienenbremse in direkter Abhängigkeit der verlangten
Bremskraft.
Dabei spielte es keine Rolle, ob die
EP-Bremse, oder die
automatische Bremse benutzt wurde. Speziell war jedoch die direkte Ansteuerung. So
konnten die Magnetschienenbremse auch dazu genutzt werden um mit der
Reibung
Schienen zu trocknen und so die
Bremskraft der normalen
Radscheibenbremsen zu verbessern. Selbst eine Aktivierung im Stillstand war
möglich.
Nur die beiden äusseren
Laufdrehgestelle wurden beim vierteiligen
Triebzug mit der
Magnetschienenbremse versehen. Diese konnten trotz der niederen Bauweise
der
Drehgestelle hoch aufgehängt werden und entsprachen daher der üblichen
Bauweise bei
Vollbahnen. Die Absenkung der
Magnetschienenbremse erfolgte
mit
Druckluft. Diese wurde jedoch nicht von der
Hauptleitung, sondern von
der
Apparateleitung abgenommen.
Eine Ausstattung des
mittleren
Drehgestells war bei einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h
nicht erforderlich. Nicht möglich war der Einbau jedoch bei den beiden
Triebdrehgestellen. Trotzdem gab es davon Abweichungen. Die
Triebzüge der
Baureihe RABe 524 mit den Nummern 524 101 bis 524 117 waren durch den
Aufbau schwerer. Daher musste dort die Ausstattung der
Bremsen verändert
werden. Eine
Magnetschienenbremse mehr war daher kein Problem.
Da die
Magnetschienenbremsen
in Abhängigkeit der verlangten
Bremskraft
wirkten, konnten sie in den Fällen, wo dies verlangt war, angerechnet
werden. In diesem Fall konnte das
Bremsverhältnis
auf einen Wert von 195% gesteigert werden. Der
Triebzug
hatte daher sehr gute mechanische
Bremsen
erhalten, die ihm auch
ohne die
elektrische
Bremse eine ausgesprochen gute Verzögerung und daher
kurze
Bremswege
verschafften. In der Schweiz hatte dies jedoch keinen Einfluss auf die
Bremsreihe.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Erzeugt wurde die
Erzeugt wurde die  Bei jeder Erzeugung von
Bei jeder Erzeugung von
 Seit einigen Jahren hatten
sich dafür
Seit einigen Jahren hatten
sich dafür
 Im Bereich des
Im Bereich des
 Hinzu kamen im Bereich der
Hinzu kamen im Bereich der
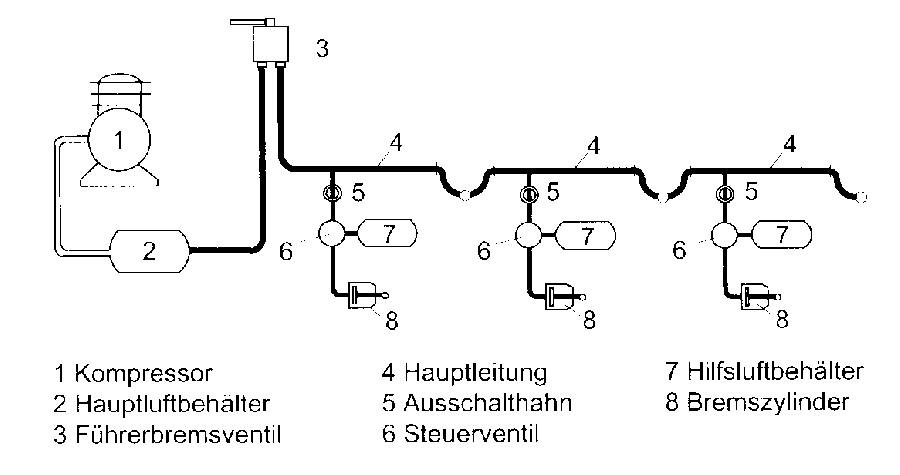 Dank dieser Lösung mit den
zwei Bremsbereiche war eine optimale Ab-bremsung mit dieser
Dank dieser Lösung mit den
zwei Bremsbereiche war eine optimale Ab-bremsung mit dieser
 Um das Gewicht zu reduzieren
und weil der Platz für ein
Um das Gewicht zu reduzieren
und weil der Platz für ein
 Obwohl
ein hohes
Obwohl
ein hohes