|
Änderungen und Umbauten |
|||||
| Navigation durch das Thema | |||||
|
Um es gleich am Anfang zu sagen, das grösste Problem, der Re 460
für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB hatte man in den Büros der
Lötschbergbahn treffend erkannt. Die
Staatsbahnen
hatten nicht weniger 119 Prototypen
erhalten. Zwar waren die gleich, aber jede hatte immer wieder ein anderes
Experiment eingebaut bekommen. So gab es immer wieder Beschränkungen bei
den
Dienstplänen
und beim Einsatz der
Lokomotiven.
Die Aussage der Industrie, dass man in der Lage sei, eine
Lokomotive ohne
Prototypen
zu bauen, wurde bei der Lok 2000 bitter bezahlt. Das brachte der
Lokomotive anfänglich einen sehr schlechten Ruf ein. Nur kann ganz klar
gesagt werden, bei Prototypen hätte man bereits in der Erprobung die
grössten Probleme der Maschine erkannt. Dort behoben und in einer Serie
umgesetzt, hätte einen erfolgreichen Start ermöglicht.
Kinderkrankheiten bei neuen Fahrzeugen sind häufig und selbst die
Re 4/4 II
funktionierten am Anfang nicht sehr zuverlässig. Die theoretisch
ausgedachten Vorgaben, werden dann in der Praxis plötzlich unbrauchbar und
Bauteile, die noch so gut berechnet wurden, können sich anders abnützen,
wie man das erwartet hätte. Dynamische Kräfte und die oft unmöglichen
Gleiszustände in der Praxis belasteten die Bauteile stärker als erwartet.
Daher mussten die Anpassungen an sämtlichen
Lokomotiven
gemacht werden. Dass die Re 465 davon nicht betroffen war, zeigt deutlich,
dass man die Probleme bei
Prototypen
einfacher hätte lösen können. Für uns hat die Sache aber auch einen
Vorteil, denn die aufgeführten Umbauten und Änderungen betrafen sämtliche
Re 460. Bei der Re 465 gilt diese Feststellung natürlich auch, wobei diese
erst später mitmachte und einen guten Start hatte.
So kam es immer wieder vor, dass die
Lokomotive
stand, weil die
PMS
nicht gelöst werden konnte. Zwar hatte man für diesen Umstand bei der
Entwicklung mechanische Hilfen vorgesehen, aber die Probleme waren so
häufig, dass damit nicht gearbeitet werden konnte.
Hinzu kam, dass die
Lokomotive
keine
Zugkraft
aufbauen konnte, da eine angezogene
PMS,
eine
Fahrsperre
generierte. Zusätzlich traute man der PMS mehr zu, als sie wirklich
leistete, man hätte die Maschine problemlos mit angezogener PMS mit einer
anderen Lokomotive wegschieben können. Nur, die neue Maschine sollte ja
aus eigener Kraft fahren und nicht immer durch eine ältere Lokomotive zur
Seite geschoben werden.
Die Lösung musste an zwei Orten angesetzt werden. Einerseits
sanierte man die Pumpen, so dass sie zuverlässiger arbeiteten und
zusätzlich lockerte man die
Fahrsperre
der
Lokomotive
in Bezug auf die
PMS.
Daraus ergab sich, dass die PMS besser funktionierten und wenn sie einmal
ausfielen, konnte sich die Maschine mit 7 km/h aus eigener Kraft bewegen
und so an einen Ort fahren, wo sie nicht so sehr störte.
Die Software der
Fahrzeugrechner
war neu entwickelt worden. Daher mussten die dort enthaltenen Fehler auch
ausgebessert werden. Die Funktion der
Lokomotiven
wurde daher immer mehr verbessert. Bei einigen Maschinen wurden diese
Erkenntnisse noch während des Baus berücksichtigt. Trotzdem, konnte man
ein Problem nicht einfach lösen und das sollte sich dann zum grössten
aller Probleme entwickeln.
Sehr fein arbeitete der
Schleuderschutz.
Im Betrieb war er daher nahezu unbrauchbar. Die
Lokomotive
bekundete bei schlechten Verhältnissen sehr grosse Probleme mit
durchdrehenden
Rädern.
Daher begann man mit umfangreichen Versuchsfahrten um diese Problem in den
Griff zu bekommen. Dabei stellte man überraschende Ergebnisse fest. Die
Anpassungen führten dann zu einem immer besser funktionierenden
Schleuderschutz, der im Betrieb auch genutzt werden konnte.
Trotzdem blieb die
Lokomotive
bei schönem Wetter ein Traum. Bei widrigen Verhältnissen wurde sie sehr
schnell zum Alptraum des Lokführers. Die Re 460 hatten schnell den Ruf
einer Schönwetterlokomotive. In diesem Punkt, konnte sich die Re 465 noch
weniger rühmen, denn sie neigte selbst bei guten
Schienen
zum Durchdrehen der
Räder.
Dort war schlicht zu viel
Leistung
vorhanden, so dass man Sie auf die Werte der Re 460 anpasste.
Die Probleme erkannte man schnell, denn die glatten und ruhig
rollenden
Räder
waren so fein, dass sich der Wasserfilm, der auf den
Schienen
war, nicht mehr in Einbuchtungen oder feinen oberflächlichen Risse pressen
konnte, daher rutschte die Lokomotive auf dem feinen Wasserfilm, lange vor
anderen
Lokomotiven, aus. Der Lokführer griff in der Folge
zum Sandschalter, was den Sandverbrauch, gegenüber anderen Lokomotiven,
erhöhte.
Doch auch die Lokführer bekundeten mit dem
Schleuderschutz
grosse Mühe. Die Anzeigen, die nach den Vorgaben der alten
Lokomotiven
gebaut wurden, passten hier nicht mehr. Hauptsächlich, war die blinkende
Meldelampe kaum zu erkennen. Die Software wurde in der Folge sehr früh
geändert und so programmiert, dass die Lampe nun bei schleudernden
Rädern
dauernd leuchtete. Sie war so besser zu erkennen, was die Bedienung der
Schleuderbremse etwas erleichterte.
Die
Antriebe
mussten saniert werden, was natürlich auch wieder die ganze Serie betraf.
Glaubte man anfänglich noch an einen Mangel der Elemente erkannte man mit
der Zeit, den Zusammenhang mit dem
Schleuderschutz
der
Lokomotive. Soweit können wir die Mängel zu Beginn abhaken. All diese Probleme hätten mit ein paar Prototypen frühzeitig erkannt und gelöst werden können, ohne dass die ganze Serie von 119 Maschinen betroffen gewesen wäre.
Bei den Re 465 der Lötschbergbahn konnte man all diese
Erkenntnisse schon beim Bau berücksichtigen. So dass man durchaus sagen
kann, die 18
Loko-motiven
der Lötschbergbahn waren die Serie, auch wenn die Maschinen grosse
Probleme hatten. Gerade die erhöhte Leistung der Re 465 führte dazu, dass sie im Vergleich mit den Re 460 in vielen Punkten schlechter abschnitt. So kam die Lokomotive selbst bei trockenen Schienen ins Schleudern.
Bei nassen
Schienen
konnten kaum bessere Ergebnisse erzielt werden. Man erkannte, dass eine
Lokomotive
auf vier
Triebachsen
nicht mit 7 000 kW arbeiten konnte. Man war auch mit einer optimalen
Tiefzugvorrichtung
mit 300 kN an der physikalischen Grenze angelangt.
In der Folge wurden die Re 465 den Re 460 angepasst. So konnten
diese Maschinen optimal arbeiten und man hatte die Möglichkeit die
Vorschriften zu vereinfachen. Das führte dazu, dass für beide Typen ein
Reglement entstand. Sowohl die Lokführer der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB, als auch die Kollegen der Lötschbergbahn arbeiteten daher mit dem R
430.5 oder dem „Bedienerhandbuch Re 460/465“.
Daher kann man kaum von einem zeitlichen
Ablauf
ausgehen. So wurde bei den Re 460 schon früh die Steuerung der
Stromabnehmer
geändert. Bei
Vielfachsteuerung
sollten nun alle
Lokomotiven
den vorderen Stromabnehmer heben. Damit wollte man dem Personal etwas unter die Arme greifen. Da der Schalter für den Stromabnehmer in der Regel auf N stand, kontrollierte niemand dessen Stellung. Musste nun ein Lokführer manuell umstellen, blieb diese Stellung lange Zeit erhalten.
Zumindest so lange, bis ein pingeliger Lokführer eben auch diesen
Schalter genauer kontrollierte und wieder zurück geschaltet hatte. In der
Folge blieb der Schalter zum
Stromabnehmer
grundsätzlich auf N. Die gigantischen elektrischen Bremskräfte der Lokomotive machten nicht allen Per-sonen Freude. Hatte man trockene Schienen konnte man gut und gerne das Ge-wicht, das man ziehen konnte, elektrisch abbremsen.
Letztlich führten die Kräfte der
elektrischen
Bremse in
Verbindung
mit einer sehr unglücklichen Zugsformation und schlechtem Wetter zu einer
folgenschweren
Entgleisung.
In der Folge wurden die zulässigen Werte drastisch reduziert.
Mit zunehmender Zahl
Lokomotiven
vom Typ Re 460 kamen immer wieder neuartige Störungen an den Tag. Ein
Problem, das mit
Prototypen
nicht gelöst werden konnte. Die Lokomotiven schalteten sich ab, weil die
100 Hz Kontrolle in der Maschine angesprochen hatte. Diese Probleme
verschärften sich immer dann, wenn wenig Verkehr war. Das Problem, das man
zunächst den neuen Re 460 in die Schuhe schob, verursachte umfangreiche
Abklärungen.
Dabei erkannte man, dass
Lokomotiven
mit
Umrichtertechnik
unabhängig der Baureihe, Oberwellen in der
Fahrleitung
erzeugten. Diese wurden durch die klassischen Lokomotiven, wie zum
Beispiel der
Re 6/6,
abgebaut. Beide Lokomotiven profitierten letztlich davon. Waren aber zu
wenig ältere Lokomotiven im Einsatz, schaukelten sich diese Oberwellen
auf, und führten dazu, dass die Kontrolle der Maschine auslöste.
Letztlich konnte nach anfänglichen Anpassungen bei den
Lokomotiven
die Probleme mit einem einfachen aber wirkungsvollen Trick gelöst werden.
Dabei musste man nicht einmal bei den Maschinen ansetzen. Man begann
damit, die
Fahrleitungen,
die bisher eine
Frequenz
von 16 2/3, also 16.666666
Hertz
hatten, mit einer Frequenz von nun 16.7 Hertz zu betreiben. Diese kleine
oft als Rundung betrachtete Abweichung brachte die Lösung bei den
Problemen mit 100 Hz und letztlich auch den endgültige Durchbruch bei den
Umrichterlokomotiven.
Diese Störung sollte eigentlich eine
Schnellbremsung
ausführen. Das tat der
Bremsrechner, wie man nun wusste, nicht
immer. Daher wurden in den
Führerständen
Nothahnen
montiert, die mechanisch die
Hauptleitung
entleerten. Ein neuer für die Lokomotiven vorgesehener Einsatz waren die Züge der Rola. Diese sollten mit langen Zügen, mit einer da-zwischen eingereihten Re 460 betrieben werden. Die Loko-motive musste im Bereich der Software angepasst werden.
Das heisst, man baute einen zweiten
Zugbus
ein. Dieser konnte nun gewählt werden, wenn es wegen der über 300 Meter
langen
EP-Leitung,
zu Problemen bei der Übertragung der Signale kam. Auch die Bremssteuerung musste angepasst werden. Neu war nun beim Bremsumschalter die Stellung EP Hupac möglich. Diese verhinderte den Hochdruckfüllstoss und arbeitete in der lang-sameren G-Stellung.
Man sorgte so in der
Hauptleitung
für ausgeglichene Drücke. Zudem konnten die
Lokomotiven
nun etwas grössere Kräfte bei der
elektrischen
Bremse aufbauen. Die bisherige
Position EP wurde zu EP-IC umgetauft.
Auch als
Versuchsträger
waren die Re 460 immer wieder geeignet. So baute man bei einer Maschine
eine
Radscheibenbremse
ein und untersuchte deren Erwärmung und die Abführung dieser Wärme. Zudem
sollten die Auswirkungen auf das
Rad
und das
Drehgestell
abgeklärt werden. Bei den Lok 2000 kam es nach dem Versuch nicht mehr zu
einer Umrüstung. Die Radscheibenbremsen kamen aber bei vielen anderen
Lokomotiven
zum Einsatz.
Schnell erkannte man den Vorteil einer
Lokomotive
im Zugsverband auf der Talfahrt am Gotthard. Daher kam die Idee auf, die
eigentlich nur auf der Bergfahrt benötigte
Schiebelokomotive
auch auf der Talfahrt mitzuführen. Damit man auf den Lokführer der
schiebenden Lokomotive verzichten konnte, musste man diese aber
fernsteuern. Die einzige für diese
Fernsteuerung
geeignete Maschine war die Re 460.
Um auf das Kabel der
EP-Leitung
durch die unterschiedlichen Wagen zu verzichten, erhielten einige
Lokomotiven der Reihe Re 460 eine
Funkfernsteuerung.
In der Folge wurden diese Lokomotiven als Ref 460 bezeichnet. Die
eingebaute Funkfernsteuerung wurde von der Firma Harris, die in Amerika
schon Erfahrungen mit solchen Systemen gesammelt hatte, geliefert. Diese
Steuerung erlaubte es, die Lokomotive am Schluss mit einem
Funkgerät
von der Spitze aus zu bedienen.
Dazu mussten auch einige
Re 4/4 II und
Re 6/6
angepasst werden. Wobei nur die Re 460 passiv sein konnte. Was letztlich
hiess, die neuen Ref 460 hätten eigentlich die Vielfachsteuerung mit der
EP-Leitung nicht mehr benötigt. Man hätte dazu die
Vielfachsteuerung
benutzen können. Speziell formiert, hätte man nun 16
Lokomotiven der Baureihen Re 460 und Ref 460 mit nur einem
einzigen Lokführer steuern können.
|
|||||
|
Megatraktion mit Ref 460 und Re 460 |
|||||
| Steuerung | 1 Lok | 2 Lok | 3 Lok | 4 Lok | Leistung |
| Bedient | Ref 460 |
24'400 kW |
|||
| Vst EP | Re 460 | Re 460 | Re 460 | ||
| Funk | Ref 460 |
24'400 kW |
|||
| Vst EP | Re 460 | Re 460 | Re 460 | ||
| Funk | Ref 460 | 24'400 kW | |||
| Vst EP | Re 460 | Re 460 | Re 460 | ||
| Funk | Ref 460 | 24'400 kW | |||
| Vst EP | Re 460 | Re 460 | Re 460 | ||
| Die totale Leistung diese Formation mit 16 Loks: |
97'600 kW / 132'800 PS |
||||
|
Die Maschine zog nun mit einem
Drehgestell,
während das andere elektrisch bremste. So waren die
Getriebe
immer unter Belastung und wurden nicht mehr so stark abgenützt. Man sprach
in diesem Zusammenhang oft auch von Schmierstrom. Nach dem es bei zwei Zugstrennungen beinahe zu einer schweren, wenn nicht tödlichen Verletzung des Lokführers gekommen war, stellte man fest, dass die Kräfte durchaus zu einem Genickbruch führen konnten.
Die Lösung, die mit alten
Lokomotiven jeder Lokführer in der Kenntnis dieser
Kräfte machte, konnte bei den Re 460 nicht umgesetzt werden. Die Sitze
wurden daher zum Schutz des Lokführers mit zusätzlichen Kopf-stützen
ausgerüstet. Auch die Re 465 blieben nicht vor Veränderungen verschont. Um die Rola im Raum Basel ohne Lokwechsel wenden zu können, musste die Loko-motive der BLS bis zum geplanten Lokwechsel am Zug bleiben.
Vor Jahren löste man ein ähnliches Problem damit, dass die
Fahrleitung
der DB an die schweizerischen Normen angepasst wurde. Das war jetzt nicht
mehr möglich und so musste auf den Re 465 ein
Stromabnehmer
mit einer breiten
Schleifleiste
nach Normen der DB ausgerüstet werden. Als es endlich so weit war, und man die Re 460 mit 200 km/h hätte ein-setzen können, stellten sich neue Probleme ein. Erstens waren da die Züge, diese sollten nun nicht mehr ausschliesslich gezogen werden, sondern sie wurden zu Pendelzügen formiert und in der Folge geschoben.
Bei den
Lokomotiven mussten Änderungen und Nachbesserungen
vorge-nommen werden. Diese zeigten sich bei den
Puffern,
bei den
Getrieben
und in der Software.
Verändert wurde auch der
Führerstand.
In der Schweiz gab man die Idee auf, mit dem Signalsystem N bis zu 200
km/h zu fahren. Die Anzeige für die Geschwindigkeit und das
Funkgerät
mussten durch Monitore ersetzt werden. Dazu kamen noch weitere
Anpassungen, die es erlaubten, die
Lokomotive mit
ETCS
Level 2
einzusetzen. Diese neuartige Ausrüstung war bei den Re 460 und Re 465
nachzurüsten, da diese erst nach der Beschaffung der Lokomotiven
beschlossen wurde.
Die damaligen Versuche wurden nur bis 160 km/h durchgeführt und da
klappte der Kontakt noch optimal. Mehr konnte man nicht fahren, weil die
ent-sprechenden Strecken in der Schweiz schlicht fehlten und man im
Ausland keine Versuche bis zur
Höchstgeschwindigkeit
durchführte. Die Luftströme waren bei 200 km/h so stark, dass der Stromabnehmer immer wieder den Kontakt zur Fahrleitung verlor. Die Lösung mit der Anpassung bei den Vorschriften konnte man nicht lange halten, da die Beschränkung auf 160 km/h immer wieder möglich war.
So gesehen ein Problem, das man bei der Ablieferung mit den
entsprechenden Versuchsfahrten erkannt hätte. Aber diese unterlies man
offenbar um Kosten zu sparen. Man musste neue Stromabnehmer montierten. Diese beschaffte man bei der Firma Faiveley. Sie zeichneten sich durch eine aerodynamisch bessere Konstruktion und nur noch einem Schleifstück aus.
Nach Abschluss der Versuche, die viele Jahre dauerten, beschloss
man die Umrüstung aller Re 460. Die demontierten noch neuwertigen
Stromabnehmer
alter
Bauart
kamen auf umgebauten
RBDe 560 zum Einsatz. Die Kommunikation wurde ebenfalls verändert. So wurde der alte Zugfunk vom Typ VZFK-90 durch einen neuen Funk ersetzt. Der neue GSM-R-Funk war für die Daten und die Sprache geeignet. Dank dem neuen Gerät konnte der Lokführer nun auch zu Hause die Meldung absetzen, dass seine Schicht wegen einem Problem im Grenzbahnhof länger dauert.
Damit haben wir die Umbauten und Änderungen kennen gelernt. Im
Lauf der Jahre funktionierten die
Lokomotiven immer besser und sehr zuverlässig. Jedoch
haben wir bisher den Einsatz in
Pendelzügen
nur angeschnitten. Diese Veränderung war jedoch so umfangreich, dass wir
uns mit den Pendelzügen und den damit verbundenen Anpassungen befassen
müssen. Eingebunden werden dabei auch die
Steuerwagen.
|
|||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||||
 Besonders
grosse Probleme hatte man mit den neu-artigen
Besonders
grosse Probleme hatte man mit den neu-artigen 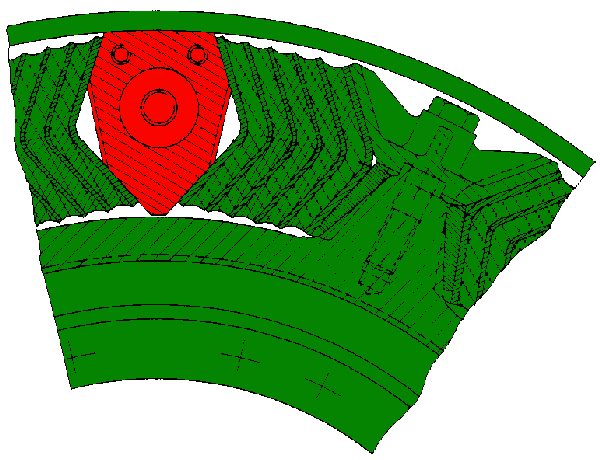 Die
schlagartigen Zugkraftänderungen, die bei schleudernden
Die
schlagartigen Zugkraftänderungen, die bei schleudernden  Da
sich bei so vielen Maschinen die Arbeiten hinzogen, kam es bereits zu
Anpass-ungen, die auf Grund neuer Vorgaben gemacht werden mussten, noch
bevor die Kinderkrankheiten gelöst waren.
Da
sich bei so vielen Maschinen die Arbeiten hinzogen, kam es bereits zu
Anpass-ungen, die auf Grund neuer Vorgaben gemacht werden mussten, noch
bevor die Kinderkrankheiten gelöst waren. Nachdem
es beinahe zu zwei Unfällen gekommen war, weil die
Nachdem
es beinahe zu zwei Unfällen gekommen war, weil die

 Bei
den Versuchsfahrten auf der
Bei
den Versuchsfahrten auf der