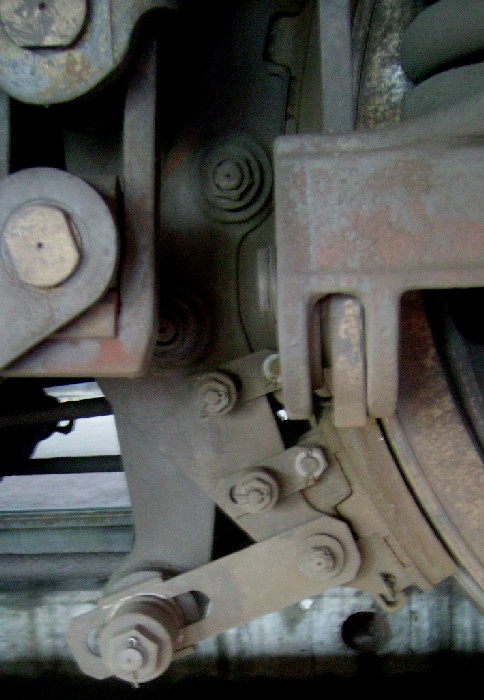|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bei der Versorgung des
Triebzuges
mit
Druckluft
ging man gegenüber den anderen
Triebfahrzeugen
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB einen grossen Schritt weiter. Daher
wurden im Triebzug RAe TEE II zwei
Kompressoren
eingebaut. Diese waren jedoch nicht gleichwertig aufgebaut worden und sie
hatten eine andere Versorgung. Daher müssen wir uns jeden einzelnen
Kompressor etwas genauer ansehen.
Normal an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen wurde der erste
Kompressor.
Diesen können wir daher getrost als Hauptkompressor bezeichnen. Er war für
den normalen Betrieb des
Triebzuges
ausgelegt worden und reichte nicht für einen erhöhten Bedarf an
Druckluft.
Eine automatische Druckregelung, die den Druck in einem bestimmten Bereich
hielt, war natürlich ebenfalls vorhanden. Daher gab es hier zu anderen
Triebfahrzeugen
eigentlich keinen Unterschied.
Der zweite
Kompressor
wurde jedoch ab den
Batterien
mit Energie versorgt. Dadurch stand er auch zur Verfügung, wenn der
Triebzug
ausgeschaltet war. Aus diesem Grund wurde dieser mit Hilfe dieses
Kompressors in Betrieb genommen. Er kam jedoch auch bei Notfällen und als
Ergänzung für den ersten Kompressor zum Einsatz. Daher hatte er deutlich
mehr Aufgaben, als ein
Hilfsluftkompressor,
wie sie heute bei
Lokomotiven
verwendet werden.
Da diese im Gegensatz zu einer
Lokomotive
nicht lange Züge versorgen mussten, waren sie etwas kleiner aufge-baut
worden. Zudem reichte der Hauptkompressor nur für den Normalbetrieb. Das
war kein Problem, da ihm bei Be-darf der zweite
Kompressor
zu Verfügung stand. Die von den Kompressoren erzeugte Druckluft wurde der angeschlossenen Leitung zugeführt und verflüchtigte sich dadurch wegen den grösseren Volumen wieder.
Da in diesem Moment die Feuchtigkeit in der
Luft ausge-schieden wurde, war ein Ölabscheider eingebaut worden. Dieser
reduzierte die Feuchtigkeit in der Luft, trocknete diese jedoch nicht
vollständig. Das gesammelte Kondensat musste im Unterhalt abgelassen
werden. Abgeschlossen wurde diese Leitung mit den Hauptluftbe-hältern. Diese bildeten ein Volumen, das verhinderte, dass die Kompressoren dauernd in Betrieb standen.
Beim abgestellten
Triebzug
konnte die Luft in diesem Be-hälter mit
Abschlusshähnen
eingeschlossen werden. Da-durch blieb der Vorrat erhalten, wobei das hier
nicht so wichtig war, weil der Vorrat vom
Kompressor
zwei auch erzeugt werden konnte, wenn keine
Druckluft
vorhanden war.
Schöpften die beiden
Kompressoren Luft und wurde
diese nicht von den Verbrauchern benötigt, stieg der Druck in den
Hauptluftbehältern an. Damit dieser nicht zu hoch werden konnte, war in
der Leitung ein
Überdruckventil eingebaut worden. Dieses verhinderte, dass
der Druck in der Leitung einen Wert von 10.5
bar übersteigen konnte. Wurde
ein Druck von rund acht bar erreicht, schaltete der Kompressor 2 ab, da
nun der Hauptkompressor ausreichte.
An dieser
Speiseleitung waren zahlreiche Verbraucher
in den einzelnen Wagen angeschlossen. Hier jeden Ver-braucher zu erwähnen
ergäbe eine lange Aufzählung. Vielmehr wollen wir die Verbraucher in den
einzelnen Wagen des
Triebzuges ansehen. Beginnen werde ich diese
Betrachtung mit den beiden
Steuerwagen, die einen grossen Verbrauch hatten
und dabei durchaus auch den
Maschinenwagen übertrafen.
Der Grund dafür war, dass hier, die später noch
genauer betrachteten
Druckluftbremsen angeschlossen wurden. Vorerst beschränken wir
uns auf die anderen Baugruppen im
Steuerwagen. Dazu gehörte die
Ansteuerung der Türen. Diese wurden mit Hilfe von
Druckluft verriegelt und
geöffnet. Gerade die automatische Türschliessung und die Verriegelung
waren schon bei anderen Baureihen und bei den
Einheitswagen eingeführt
worden.
Weiter wurden im
Steuerwagen auch die Funktionen der
automatischen Kupplung und die
Scheibenwischer an der
Speiseleitung
angeschlossen. Diese Verbraucher wurden mit der
Spurkranzschmierung des
Steuerwagens ergänzt. Dabei war jedoch durch die Fahrrichtung geregelt,
dass nur der führende Steuerwagen die
Schmierung der
Spurkränze auch
ausführte. Zudem wurde die Schmierung mit einem etwas geringeren Druck
ausgeführt.
Speziell war, dass die akustische Signaleinrichtung
nicht hier angeschlossen wurde. Beim
Triebzug RAe TEE II wurde nicht die
in der Schweiz übliche
Pfeife verwendet. Diese wäre bei hohen
Geschwindigkeiten kaum zu hören gewesen. Daher wurden, auch um
ausländische Vorschriften zu berücksichtigen, elektrisch angesteuerte
Makrofone verwendet. Diese benötigten jedoch keine
Druckluft und
arbeiteten davon unabhängig.
Wenn wir uns nun den anderen Wagen des Zuges
zuwenden, erkennen wir, dass auch diese an der
Speiseleitung angeschlossen
wurden. Dabei wurde diese für die
Bremsen benötigt. Jedoch auch die
Einstiegstüren der beiden Zwischenwagen bezogen die
Druckluft direkt. Die
Ansteuerung erfolgte über elektrische Signale. Es war daher so, dass diese
nur sehr wenig Druckluft benötigten und daher eigentlich vernachlässigt
werden konnten.
Damit kommen wir zum
Maschinenwagen und die dort an
der
Speiseleitung angeschlossen Verbraucher. Hier waren überraschend wenig
Verbraucher direkt angeschlossen worden. Neben dem
Schleuderschutz des
Zuges, war nur noch der Vorratsbehälter der
Apparateleitung an der
Speiseleitung angeschlossen. Dieser Anschluss erfolgte zudem über ein
Druckreduzierventil, so dass in dieser Leitung nur noch ein Druck von
sechs
bar vorhanden war.
Statt
den Druck, wie bei den
Steuerwagen zu reduzieren, schloss man diese
Einrichtung einfach an der
Apparate-leitung an. Damit konnte man
zusätzliche Bauteile ein-sparen, was eine geringe Reduktion beim Gewicht
erlaub-te. Wir haben gesehen, dass wirklich die meiste Druckluft in den Steuerwagen benötigt wurde. Der Grund waren die pneumatischen Bremsen des Triebzuges. Diese wurden über ein Ventil angeschlossen und bedient.
Diese befand sich jedoch im
Führerstand, welcher wieder-um in den
Steuerwagen eingebaut wurde. Wir müssen da-her für die Betrachtung der
pneumatischen
Bremsen wie-der auf den führenden Steuerwagen zurückkehren.
Im Gegensatz zu den üblichen
Triebfahrzeugen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB wurde hier die Aus-rüstung der
pneumatischen
Bremsen vereinfacht. Daher wurde auf den Einbau einer
Rangierbremse verzichtet. Dieser Umstand sorgte jedoch dafür, dass der
Triebzug im Stillstand mit der
automatischen Bremse gesichert werden
musste. Trotzdem gab es auf dem Triebzug ein zweites
Bremssystem, das
jedoch kaum für eine Bremsung reichte.
Dieses zweite
Bremssystem
war die nur auf die vier
Triebachsen wirkende
Schleuderbremse. Diese
Bremse erzeugte in den
Bremszylindern der Triebachsen einen Druck von maximal 0.8
bar und sie war
einlösig. Damit konnte eine durchdrehende
Achse mit der Bremse abgefangen
werden. Dabei konnte der Lokführer nur alle Achsen beeinflussen. Der
Schleuderschutz bremste jedoch nur die betroffene Triebachse.
Diese Leitung wurde im normalen
Zu-stand, wie bei den anderen Zügen in Europa, mit einem Druck von fünf
bar
betrieben. Gefüllt wurde die Leitung ab einem
Bremsventil im führenden
Steuerwagen. Die Lösung, die nicht unbedingt zu er-warten war, hatte viele Vorteile. So konnten die Bremsen des Zuges auch von einem Hilfstriebfahrzeug aus an-gesteuert werden.
Der
Triebzug musste daher im
Stör-ungsfall nicht ungebremst abgeschleppt werden. Damit die üblichen
Lokomotiven verwendet werden konnten, war auf dem Triebzug ein Adapter zur
auto-matischen Kupplung vorhanden. Dieser war so ausgelegt worden, dass die
Hauptleitung verbunden wurde.
Eine Bremsung wurde eingeleitet, wenn der Druck in
der
Hauptleitung reduziert wurde. Durch diesen Druckabfall, steuerten die
Steuerventile der
Bauart Est4d um und führten eine Bremsung aus. Je weiter
der Druck in der Hauptleitung abgesenkt wurde, desto stärker fiel die
Bremsung aus. Wurde der Druck wieder erhöht, reduzierte das
Ventil die
Bremskraft. Damit war es mehrlösig und auf dem neuesten Stand.
Das
Steuerventil Est4d konnte die normale
Personenzugsbremse aktivieren. Fuhr der Zug jedoch schneller als 60 km/h
schaltete sich die
R-Bremse automatisch zu. Damit wurde die
Bremskraft bei
höherer Geschwindigkeit erhöht. Die Reduktion auf den normalen Druck
erfolgte jedoch erst, wenn der
Triebzug unter 50 km/h verzögert wurde.
Ob die R-Bremse angesteuert wurde oder nicht, konnte hier nicht
eingestellt werden.
Damit verfügte der
Triebzug über eine
Hochleistungsbremse, wie es sie schon bei den
Triebwagen
RBe 4/4 gab. Die
dabei im Zug erzeugten Drücke entsprachen jenen von anderen Fahrzeugen und
erreichte dank den vielen
Bremsklötzen einen guten Wert. Das konnte jedoch
bei schlechtem Zustand der
Schienen dazu führen, dass die
Räder
blockierten. Damit dies nicht passierte, wurde mit Hilfe des
Gleitschutzes
der Druck reduziert.
Letztlich endete das
Bremsgestänge bei den
Sohlen-haltern, die jeweils zwei
Bremssohlen erhalten hatten. Damit wurde
jede
Achse mit acht
Bremsklötzen abge-bremst. Die Bremsung wurde eingeleitet, wenn die Druckluft den Bremszylinder in Bewegung setzte. Dadurch wurde das Bremsgestänge bewegt und die Bremssohlen mit grosser Kraft gegen die Lauffläche des Rades gedrückt. So wurde dieses an der freien Drehung gehindert und der Zug verzögerte.
Wollte man die
Bremse wieder lösen, entliess man die
Druckluft und die Rückholfeder im
Bremszylinder hob die
Bremssohlen vom
Rad ab. Damit war eine normale
Klotzbremse vorhanden.
Obwohl damals bereits
Scheibenbremsen bei den
Eisenbahnen bekannt waren und die
Klotzbremse wegen dem Lärm nicht optimal
für einen noblen
TEE war, entschied man sich für diese Lösung. Der Grund
war, dass man noch nicht wusste, wie sich die Scheibenbremsen in den
langen Gefällen am Gotthard bewähren würden. Daher setzte man auf die
Klotzbremse, auch wenn damit das Fahrgeräusch deutlich erhöht wurde.
Diese
funktionierten vom Prinzip her, wie die vorher beschriebenen Modelle, der
einzige Unterschied war, dass damit nur eine
Achse abgebremst wurde. Das
hatte auch Vorteile bei der Verteilung der
Bremssohlen in diesen
Drehgestellen.
Während bei der
Laufachse, wie bei den anderen Wagen,
vier
Bremsklötze pro
Rad vorhan-den waren, wurden bei den etwas grösseren
Triebachsen sechs
Bremssohlen eingebaut. Auf den ganzen sechsteiligen Zug
verteilt, bedeutete das, dass nicht weniger als 224
Bremsbeläge vorhanden
waren. Damit hatten diese
Triebzüge eine sehr gute
Klotzbremse erhalten,
die ein Verkehren in der Schweiz nach der höchsten
Zugreihe erlaubte. Auch mit Anwendung der R-Bremse konnte die Klotzbremse nur bis auf 140 km/h sinnvoll ein-gesetzt werden. Da der Triebzug jedoch für 160 km/h ausgelegt war, musste eine Lösung gefunden werden, damit der Bremsweg aus dieser hohen Höchstgeschwindigkeit heraus verkürzt werden konnte.
Speziell war diese Regel eigentlich nur, dass der
Zug in der Schweiz diese
Höchstgeschwin-digkeit lange Zeit gar nicht ausfahren
konnte.
Gegenüber den
restlichen Zügen in der Schweiz war die Steigerung mit 35 km/h jedoch
extrem. Daher waren die Strecken in der Schweiz gar noch nicht für solch
hohe Ge-schwindigkeiten ausgelegt worden. Der TEE sollte diese jedoch im
Ausland ausfahren können. Die Lösung war, dass der Zug mit Magnetschienenbremsen ausgerüstet würde. Diese wurden an allen Laufdrehgestellen montiert. Bei den beiden Triebdrehgestellen fehlte dazu schlicht der benötigte Platz.
Die
Bremse wurde mit Hilfe von
Druckluft auf
die
Schienen gepresst. Damit wurde wegen dem Magneten in der Bremse ein
starkes Magnetfeld erzeugt. Durch diese magnetischen Kräfte wurde der
Widerstand erhöht und eine Verzögerung bewirkt.
Diese Art der
Bremse war bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB neu. Sie wurde aktiviert, wenn der Druck in der
Hauptleitung unter einen Wert von 2.5
bar sank. Dadurch war sie lediglich
aktiv, wenn die
Schnellbremse aktiviert wurde. Die Bremse bleib jedoch bis
zum Stillstand unten, so dass kurz vor dem Halt sehr hohe Verzögerungen
bewirkt wurden. Gelöst wurde die
Magnetschienenbremse erst, wenn der Druck
in der Hauptleitung auf über 2.5 bar anstieg.
Damit wäre es dem
Triebzug sogar in der Schweiz mög-lich gewesen, die
Höchstgeschwindigkeit
von
160 km/h bei den vorhandenen
Bremswegen auszufahren.
Im Ausland waren daher mit dieser Bremswirkung keine Einschränkungen zu
erwarten. Das war einfach, denn auch dort waren vergleichbare Werte noch
selten.
Jeder normale Wagen konnte mit Ausnahme des
Speisewagene mit Handbremsen gesichert werden. Dabei wirkte die
Handbremse
in diesen Wagen von der
Plattform aus auf das benachbarte
Bremsgestänge
und so auf die
Klotzbremse. Es wurden hier somit zwei
Achsen angezogen.
Vom Aufbau her entsprach diese Handbremse der bei
Reisezugwagen üblichen
Lösung. Daher konnten sie auch vom
Zugpersonal bedient werden.
Beim
Motorwagen kam jedoch eine
Feststellbremse zur
Anwendung. Diese wirkte bei jedem
Drehgestell auf eine
Triebachse. Diese
Bremse konnte nur im Stillstand und nur von aussen bedient werden, daher
war es keine normale
Handbremse. Trotzdem erreichte der
Triebzug mit
diesen Handbremsen sehr gute Werte und er konnte auf dem ganzen befahrenen
Netz mit von der
Druckluft unabhängigen Bremsmitteln gesichert werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Beide
Beide
 Von den
Von den
 Neben den Elementen der elektrischen Ausrüstung
wurden an der
Neben den Elementen der elektrischen Ausrüstung
wurden an der
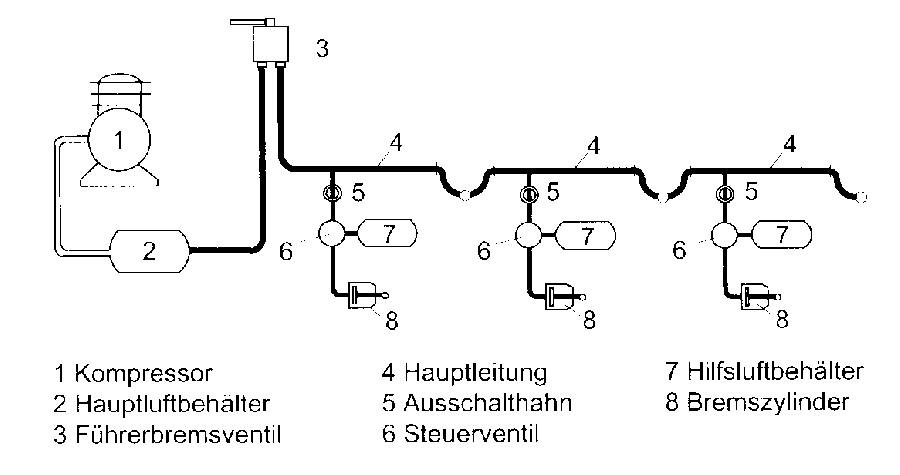 Das normale
Das normale
 Der vom
Der vom