|
Inbetriebsetzung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie schon bei den zuvor
abgelieferten
Triebwagen wurden diese Modelle als Bausatz von der
Industrie angeliefert. Dadurch entfiel die Inbetriebnahme des neuen
Fahrzeuges beim Hersteller. Erste Probleme bei der Inbetriebnahme treten
oft kurz nach der Endmontage auf. Dort wurde eine Schraube nicht richtig
befestigt und an anderer Stelle stimmte vielleicht eine Berechnung nicht.
Kleine Fehler, die grosse Auswirkungen haben könnten.
Daher führte der Hersteller nach der Endmontage zuerst
stationäre Versuche durch und schaltete den
Triebwagen zum ersten Mal auf
einem speziellen Abschnitt ein. Danach erfolgten in den meisten Fällen die
ersten Fahrversuche auf dem Gelände des Werkes. So konnte man die Probleme
lösen, bevor es auf die Strecken und somit zum Kunden ging. Das war bisher
immer so gelöst worden und eigentlich sollte sich das nicht ändern.
So kamen die Kästen und die elektrische Ausrüstung getrennt in Spiez an.
Dort sollte die Endmontage erfolgen. Das führte unweigerlich dazu, dass
die BLS-Gruppe
sämtliche Versuche durchführen musste. Sie müssen bedenken, die Pläne kamen von den Herstelltern und sie wurden nach dem Pflichtenheft erstellt. Durch die Teilung der Arbeit gab es jedoch kaum die Möglichkeit zu kontrollieren, ob überall richtig gearbeitet wurde. Stimmt die berechnete Leistung des Kompressors und konnten die Leitungen dessen Druck aufnehmen?
Für uns ergibt das jedoch
erneut die Situation, dass die ersten Versuche und Tests eines Herstellers
beleuchtet werden können. Bisher hatten wir mit Ausnahme der Nummern 746
bis 750 immer das Fahrzeug in Betrieb genommen, wenn dieses vom Hersteller
ausgeliefert wurde. Das war meistens dann, wenn die gnädigen Herren
Direktoren in Anzügen auf das Fahrzeug gewartet haben. Mit der Serie
änderten sich jedoch die Anwesenden.
Mit der Fertigstellung des
ersten
Triebwagens erfolgte im Areal der Werkstätte zuerst die Prüfung der
Steuerung, diese konnte mit Hilfe der
Batterien und daran angeschlossenen
externen
Ladegeräten auf Herz und Nieren geprüft werden. Erst als
sämtliche Funktionen und die Schutzrelais einwandfrei funktionierten,
konnte man den nächsten Schritt einleiten und so auch höhere
Spannungen
anwenden. Jedoch erfolgte nicht gleich der grosse Schritt.
Es ist sinnvoll, wenn man die
Steuerung einer Prüfung unterzieht, bevor die anderen
Spannungen
gefährliche Situationen ergeben könnten. Stellen Sie sich die Situation
vor, dass der
Triebwagen direkt mit der Hochspannung eingeschaltet wird.
Wegen einem fehlerhaft angeschlossenen Kabel kommt es im
Transformator zu
einem
Kurzschluss.
Jetzt ist es wichtig, dass dies von der Steuerung registriert wird und so
der
Hauptschalter,
oder die
Sicherungen ausgelöst werden.
Es wird nun Zeit, dass man
auch die Hochspannung in Betrieb nimmt. Da bei einer
Spannung von 15 000
Volt eine sehr grosse Gefahr ausgehen konnte, erfolgten diese ersten
Versuche meistens in einem abgesicherten Bereich. Ein auf dem neuen
Fahrzeug auftretender
Kurzschluss hatte dadurch keine Auswirkungen auf den
Betrieb. Bei den Herstellern, aber auch in den Werkstätten der
Bahngesellschaften waren entsprechende Bereiche vorhanden.
Was sich hier so schnell
liest, ist eine Aktion von mehreren Tagen. Bei einem neu gebauten Fahrzeug
kann diese Zeit durchaus auf Monate verlängert werden. Es war viel von der
Technik abhängig und mit den relativ geringen
Spann-ungen konnte nicht so
viel passieren. Jedoch hatte jede Inbetriebnahme den Punkt, an dem man
sich an den nächsten Schritt wagen musste, auch wenn das bedeuten konnte,
dass man danach wieder von vorne beginnt.
Mit dem unter
Spannung
stehenden
Triebwagen war die stationäre Inbetriebnahme abgeschlossen.
Erfolgte das bei den Herstellern kamen diese ersten Fehlschläge kaum an
die Öffentlichkeit und auch das neue Fahrzeug wird versteckt. Wir können
jedoch davon ausgehen, dass nicht viele Fahrzeuge auf Anhieb anstandslos
funktionierten und so erste Nacharbeiten unverzüglich erfolgten. Erst dann
ging es an die Öffentlichkeit.
Bei den hier vorgestellten
Triebwagen war das für die Werkstätte der BLS nicht viel anders. Jedoch
war der Vorteil, dass man schon Erfahrungen mit den anderen Modellen
hatte. Nach einer
Hauptrevision
R3 erfolgte die Inbetriebnahme im Werk auf
die gleiche Weise, denn auch jetzt musste zuerst geprüft werden, ob
wirklich alle Teile korrekt funktionierten. Jetzt waren es einfach neue
Triebwagen, die nun auf grosse Fahrt gehen konnten.
Bei den Herstellern war das nicht selten gleich
die Auslieferung an den Kunden. Bei einer Werkstätte konnte diese jedoch
erfolgen, wenn der Anstrich gar noch nicht aufgetragen wurde. Daher
kehrten die
Triebwagen meistens in die Werkstätte zurück. Auch wenn diese Triebwagen ebenfalls in den Werkstätten der BLS-Gruppe gebaut wurden, er-olgte anschliessend die Übernahme durch die Be-triebsführung. Hier unterschied sich ein neues Fahrzeug von revidierten. Bei Triebwagen aus der Revision, wusste man, dass alles korrekt funktionierte.
Bei einem neuen Fahrzeug
mussten aber gewissen Daten überprüft werden. Daher wurden auch jetzt
umfangreiche Versuchsfahrten durchgeführt. Im Jahre 1964 begann die Inbetriebnahme der neu-en Triebwagen. Diese wurden nicht angeliefert, sondern verliessen die Hauptwerkstätte in Spiez.
Daher fiel den Leuten
dieser Schritt kaum auf. Nur wer auf das Feld der
Revisionen blickte
erkannte dort das entsprechende Datum. Unterschiede zu anderen Fahrzeugen
der BLS-Gruppe
gab es nicht, da alle
Triebfahrzeuge der Betriebsgruppe in
Spiez übernommen wurden und daher immer Spiez angeschrieben wurde.
Damit konnten die ersten
Versuchsfahrten stattfinden. Auch wenn man Erfahrungen mit den
vorangehenden Modellen hatte, mussten einige Bereiche überprüft werden.
Dazu gehörte die komplett neu aufgebaute elektrische Ausrüstung. Waren die
neuen
Fahrmotoren den älteren Modellen gewachsen und konnten mit den
Triebwagen höhere Lasten gezogen werden. Viele Punkte, die geprüft wurden
und die wir nur kurz ansehen.
Bei den Versuchsfahrten wurde
mit erhöhten Lasten auf den steilen
Rampen
der Lötschbergbahn gefahren.
Dabei wurden nicht nur die Lasten gesteigert, sondern auch
unterschiedliche Geschwindigkeiten gefahren. So konnte man berechnen, wie
der
Fahrplan zu gestalten war. Dabei erkannte man, dass der
Triebwagen
auch mit 110 Tonnen
Anhängelast noch eine ausreichende Beschleunigung
erreichte und daher kräftig genug war.
Nebeneffekt war, dass der
Triebwagen dabei erwärmt wurde. So konnte gleich die Abführung der Wärme
überprüft werden. Es zeigte sich, dass bei schweren Anfahrten die Wärme
genügend abgeführt werden konnte. Jedoch zeigte sich auch, dass keine
grossen Reserven mehr vorhanden waren. Gerade der
Transformator wurde warm
und arbeitete oft an der
Leistungsgrenze, was hohe Anforderungen an die
Ventilatoren stellte.
Im Rahmen der Versuche wurden
natürlich auch die Laufeigenschaften überprüft. Das bedeutete, dass man
Geschwindigkeiten die um 10% über den zugelassenen Werten lagen, die
Strecken befuhr. Gerade bei den Kräften in den
Kurven wurde gute
Ergebnisse erzielt. Man konnte mit den
Triebwagen problemlos nach der
neuen für Geschwindigkeiten von mehr als 115 km/h vorgesehene Zugreihe R
fahren. Gerade die Kräfte waren sehr gering.
Auf geraden Abschnitten
wurden bei den Versuchen auch Geschwindigkeiten von 135 bis 140 km/h
gefahren. Auch hier sollten 10% mehr gefahren werden. Dabei zeigten die
Fahrmotoren, dass sie durchaus auch diese Geschwindigkeiten über längere
Zeit erbringen konnten. Jedoch zeigte sich auch, dass dazu die
Kühlung
zu
schwach ausgelegt wurde. Eine
Zulassung für diese Geschwindigkeiten war
daher schlicht nicht möglich.
Als der
Triebwagen immer
besser funktionierte, wurden dieser auch ab einem
Steuerwagen
bedient.
Damit konnte man die Funktion der
Fernsteuerung prüfen. Diese
funktionierte und dank den neuen Zwischenwagen konnten längere Züge
gebildet werden. Selbst der
Faltenbalg konnte in engen
Kurven gekuppelt
werden, was nicht immer der Fall war und so deutlich zeigte, dass die
engsten Stellen nicht dazu genutzt werden sollten.
Als auch der zweite
Triebwagen fertiggestellt war, konnte man die letzten Punkte prüfen. Dazu
gehörte auch die
Vielfachsteuerung. Dazu musste man zwei Triebwagen
besitzen, denn mit
Steuerwagen geht das schlicht nicht. Die Einrichtung
war problemlos und auch die Funktionen konnten über das Kabel übertragen
werden. Daher konnten die Triebwagen auch in Vielfachsteuerung verkehren.
Damit war die Vielfachsteuerung ohne Einschränkungen nutzbar.
Die
Triebwagen waren mit den
Abkürzungen der beteiligten Bahnen beschriftet und somit für diese
Bahngesellschaften bestellt worden. Das Betätigungsfeld der neuen
Triebwagen sollte sich daher auf alle Strecken der BLS-Gruppe ausdehnen.
Dabei erhielt nur die BN zwei Triebwagen dieser Baureihe, was sicherlich
der Situation in Bern geschuldet wurde. Gerade in der Hauptstadt gab es
immer wieder Probleme mit der Kapazität.
Während der
Triebwagen der
BLS als Reserve für die gesamte Baureihe ABDe 4/8 dienen sollte, setzten
sowohl die SEZ, als auch die GBS ihren Triebwagen in stark belasteten
Umläufen ein. Die Modelle der BN waren im Raum Bern anzutreffen und
entlasteten auch dort die älteren Triebwagen der Baureihe ABDe 4/8. In den
meisten Fällen benötigte man zur Verlängerung der Züge einen
Steuerwagen,
oder gar einen Zwischenwagen.
Auf den
Fahrplanwechsel im
Herbst 1964 sollte dieses Konzept umgesetzt werden. Damit war die
Inbetriebnahme der
Triebwagen abgeschlossen. Weitere Fahrzeuge dieser
Baureihe sollte es nicht mehr geben. Auch so mussten die Triebwagen mit
den Nummern 751 bis 755 zuerst zeigen, was sie konnten. Langfristige
Erfahrungen mit den
Gleichrichtern gab es nicht. Auch die letzten Strecken
war nun in der Hand der ABDe 4/8.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
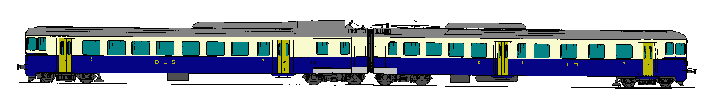 Bei den hier vorgestellten
Bei den hier vorgestellten
 Um die
Um die
 Die dynamische Inbetriebnahme
verlässt anfänglich kaum das Areal der Werkstätte. Vielmehr erfolgten
erste kurze Fahrten. Erst mit Abschluss dieser Tests, konnte man auf die
obligate
Die dynamische Inbetriebnahme
verlässt anfänglich kaum das Areal der Werkstätte. Vielmehr erfolgten
erste kurze Fahrten. Erst mit Abschluss dieser Tests, konnte man auf die
obligate 