|
Bedienung der Lokomotive |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Bedienung der
Lokomotive begann genau bei dem Zeitpunkt, wenn das
Personal bei der Lokomotive eingetroffen war. Bedient wurde die
Lokomotive von vielen Kategorien, dazu gehörten die einzelnen
Lokführer. Gerade dort galt die Lokomotive als Standard. Das bedeutete
unweigerlich, dass jeder Lokführer der Schweizerischen Bundesbahnen
SBB auf der
Diesellokomotive
geschult wurde und damit auch fahren durfte.
Eine der ersten Handlungen bei der
Lokomotive war, dass diese von der
Vorheizanlage
getrennt werden musste. Das war einfach, denn nach dem Entfernen der
Warntafel, wurden die
Lastschalter
zur Heizanlage ausgeschaltet und das Kabel ausgezogen. Damit war die
Anlage ausser Betrieb genommen und vom Ortsanschluss getrennt worden.
Wichtig war das jedoch nur, da sonst das Kabel abgerissen worden wäre.
Anschliessend begannen die Kontrollen
ausserhalb der
Lokomotive. Dazu gehörten neben den optischen
Überprüfungen des
Fahrwerks
auch die vorbereiteten Handlungen beim
Dieselmotor.
So wurde die wichtigen Füllstände des Wassers und des
Öls
kontrolliert. Anschliessend wurde bei allen Lokomotiven mit der
Handpumpe
Treibstoff
zu den
Einspritzpumpen
gepumpt. Bei den Nummern 18401 bis 18 426 wurde zudem noch
vorgeschmiert.
An der Rückwand war ein schmaler Schrank
vorhanden. Für diese Einbauten verwendete man grüne Farbe. Mit dem
braunen Boden und der weissen mit Holz verkleideten Decke, entstand
ein recht freundlicher Arbeitsplatz. Unterhalb der seitlichen Fenster befanden sich die Heizkörper. Es handelte sich um gewöhnliche Radiatoren, die mit dem Kühlwasser der Lokomotive betrieben wurden. Die Wärme konnte mit einem Regler eingestellt werden.
Auch hier erinnerte Vieles an die
Zentralheizung zu Hause. Da während dem Vorheizen das Wasser auch hier
durchfloss, war selbst im Winter der
Führer-stand
angenehm warm, wenn man ihn betrat. Wollte man die Lokomotive in Betrieb nehmen, wurde zuerst die Batterie und somit das Steuerstromnetz eingeschaltet und die Hähne zum Hauptluftbehälter geöffnet.
Dadurch hatte die Maschine die notwendige
Energie und man konnte mit den Arbeiten fortfahren. Bei Dunkelheit
konnte nun die
Beleuchtung
eingeschaltet werden. Einzig die Lampe vom
Führerstand
konnte vorher erleuchtet werden, denn man benötigte ja Licht um die
Schalter zu finden.
Bei der Druckluft war zu beachten, dass zwar
die Hähne geöffnet werden mussten, aber es keine Probleme gab, wenn
die
Druckluft
nicht vorhanden war. Das leise Fluchen des Personal blieb daher in
dieser Situation aus und die Inbetriebnahme konnte ungehindert
fortgesetzt werden.
Diesellokomotiven
benötigten daher keine Druckluft um eingeschaltet zu werden. Ein
Vorteil der Tatsache, dass nicht viele Funktionen damit gesteuert
wurden.
Dieser
Steuerschalter
hatte auf der Stellung «0» die Aufgabe, jegliche elektrische
Verbindung
zum Anlasser zu unterbinden. Der
Dieselmotor
war also in diesem Zustand ohne Funktion und die
Lokomotive war ausgeschaltet. Eine Position die zu
Beginn des Betriebs und an dessen Ende eingenommen wurde. Um den Motor zu starten, wurde der Handgriff auf die Stellung «Fahren» verbracht. diese erreichte man nicht direkt, sondern nur indem man die dazwischen angeordnete Stellung «Aus-schalten» mit dem Griff überging.
Bis hier gab es zwischen den
Lokomotiven keinen Unterschied. Jedoch unterschieden
sich die Maschinen bei der Reaktion, wenn der
Steuerschalter
weiter nach vorne geschoben wurde und so auf «Anlassen» stand.
Bei den
Lokomotiven mit den Nummern 18 401 bis 18 426 startete
der
Dieselmotor
in dem Moment, wo der Schalter in die Stellung «Anlassen» gedrückt
wurde. Dabei musste man warten, bis der Dieselmotor rund lief und
damit ein sicherer Betrieb möglich war. Anschliessend konnte der
Handgriff losgelassen werden. Dieser Griff des Dieselsteuerschalters
sprang nun automatisch wieder in die Stellung «Fahren». Der Motor war
eingeschaltet.
Etwas länger dauerte der Start bei den
restlichen Nummern. Wurde dort der Griff in die Stellung «Anlassen»
gedrückt, startete die automatische Vorschmierung. So lange diese
Schmierung
lief, musste man den Griff gegen die Kraft der
Feder
drücken. Erst nach Abschluss der Vorschmierung startete der
Dieselmotor
auf die gleiche Weise, wie bei den älteren Maschinen. In der Folge
konnte auch jetzt der
Steuerschalter
losgelassen werden.
Reichte die
Spannung
der
Batterie
jedoch nicht aus, mussten die Laschen an der Motorentrenntafel im
kurzen
Vorbau
neu angeordnet werden. Anschliessend konnte die
Lokomotive mit einem anderen
Triebfahrzeug
angeschleppt werden. Wenn der
Dieselmotor
rund lief, konnte angehalten werden. Es war nun jedoch nicht möglich,
mit der Maschine aus eigener Kraft zu fahren. Dazu mussten die Laschen
wieder in die ursprüngliche Position verbracht werden.
Dabei war das Problem nicht die Handlung bis
zum jetzigen Zeitpunkt. Um wieder mit der
Lokomotive zu fahren, mussten die Laschen angefasst
werden. Diese standen jedoch unter einer hohen
Spannung.
Daher musste der
Dieselmotor
abgestellt werden. Das hatte jedoch zu Folge, dass der Neustart wieder
über die schwachen
Batterien
erfolgen musste. Daher wurde die Lösung mit anschleppen der Maschine
nie angewendet.
Dabei wurde der Schalter mit der linken Hand
bedient. Nur so stimmten die Richtungen bei der Bewegung. Die
Lokomotive war daher eigentlich im Gegensatz zu den
neuen elektrischen Lokomotiven rechts gesteuert. Zog nun das Fahrpersonal den Fahrschalter nach hinten, legte sich die Rangierbremse an. Bei fahrender Lokomotive wurde zuerst die elektrische Bremse angesteuert.
Je weiter nach unten der Schalter gedrückt
wurde, desto kräftiger war die Verzögerung. Den Druck im
Bremszylinder
konnte an einem Manometer abgelesen werden. Lies man den Griff los,
blieb er in der Stellung, so dass er zum Lösen nach oben gehoben
werden musste. Mit dieser Handlung war direkte Bremse geprüft worden. Die Prüfung der automatischen Bremse erfolgte mit dem auf dem Pult montierten Brems-ventil.
Dabei war das
Bremsventil
nur in der Fahrrichtung vorwärts leicht zugäng-lich. Das
Führerbremsventil
stammte aus dem Hause Oerlikon Bremsen und war vom Typ
FV4a.
Damit besass die Maschine ein modernes
Ventil,
dass auch den
Hochdruckfüllstoss
erzeugen konnte. Erst wenn auch die Bremsprobe mit dem Führerbremsventil erfolgreich war, konnte die Lokomotive in Bewegung gesetzt werden. Bevor das jedoch möglich war, wurde die Beleuchtung, sofern dies nicht schon getan worden ist, richtig eingestellt.
Bei
Lokomotiven, die ständig im
Rangierdienst tätig waren, war das eigentlich nur noch eine Kontrolle,
denn die
Beleuchtung der Stirnlampen wurde bei diesen Maschinen nie
verändert.
Um die
Lokomotive zu sichern wurde mit dem
Fahrschalter
die
direkte Bremse angelegt. Anschliessend musste die
Handbremse, welche
auf dem Pult der Rückwand angeordnet wurde, gelöst werden. Die Lokomotive
war nun fahrbereit. Bevor damit jedoch losgefahren werden konnte, musste
der Fahrweg geprüft werden. Allenfalls musste sogar die Zustimmung des
Fahrdienstleiters eingeholt werden. Diese Schritte gehörten jedoch nicht
zur Inbetriebnahme.
Um damit loszufahren, musste jedoch zuerst die
Rangierbremse gelöst werden. Da diese mit dem
Fahrschalter erfolgte,
konnte, um keine gänzlich ungebremste
Lokomotive zu erhalten, im
Fahrschalter ein Knopf gedrückt werden. Damit wurde die Schleuderbremse
angelegt und die Lokomotive blieb gebremst, auch wenn der Fahrschalter nun
wieder senkrecht nach oben stand. Damit war die Maschine endgültig
fahrbereit.
Um
Zugkraft
aufzubauen musste zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden. Dazu war auf
dem Pult ein einfacher
Steuerschalter
vorhanden. Dieser wurde einfach in die gewünschte Richtung verbracht. So
lange die Fahrrichtung nicht eingestellt war, konnte der
Fahrschalter gar
nicht in die Stellung «Fahren» verbracht werden. Auch umgekehrt konnte der
Griff nur bewegt werden, wenn der Fahrschalter in der neutralen Stellung
war.
Anschliessend konnte der
Fahrschalter nach vorne bewegt
werden. Die
Lokomotive baute nun
Zugkraft auf und beschleunigte. Es war
deutlich zu hören, denn der
Dieselmotor wechselte vom Leerlauf in die der
ersten
Fahrstufe vorgegebene Drehzahl. Je weiter der Hebel nach unten
gedrückt wurde, desto höher war die verfügbare Zugkraft der Lokomotive und
die Drehzahl des Dieselmotors steigerte ich bis zu maximalen Drehzahl.
Den
Fahrmotorstrom konnte das
Lokomotivpersonal an
den
Instrumenten ablesen. Die dabei von der Steuerung geschalteten
Fahrstufen wurden nicht bemerkt, so dass stufenlos beschleunigt wurde.
Wegen der hohen verfügbaren
Zugkraft ging das selbst mit leichter
Anhängelast recht sportlich von statten. Erst bei erreichen von höheren
Geschwindigkeiten konnte der
Fahrschalter ohne Probleme ganz nach unten
gedrückt werden.
Bei den
Lokomotiven mit den Nummern 18 427 bis 18 446
wurde zusätzlich auf dem Korpus ein Feingeschwin-digkeitsmesser montiert.
Dieser erleichterte die Arbeit mit der Lokomotive im
Verschubdienst
in Ablaufanlagen, da
die Geschwindigkeit feiner eingestellt werden konnte. Wurde die an diesem
V-Messern maximale Geschwindigkeit überschritten blieb die Anzeige auf dem
maximalen Wert stehen. Schäden an dieser Anzeige gab es jedoch nicht.
Näherte man sich der gewünschten Geschwindigkeit, wurde
der
Fahrschalter einfach wieder angehoben. Dadurch reduzierte sich die
Zugkraft und die
Lokomotive beschleunige nicht mehr so stark. Erst wenn
der Hebel in der senkrechten Position war, wurde keine Zugkraft mehr
aufgebaut und die Maschine rollte nun auf Grund der kine-tischen Energie.
Die Geschwindigkeit, die gefahren werden sollte, wurde daher mit der
Zugkraft geregelt.
Um die Fahrt zu verzögern und so die Geschwindigkeit zu
reduzieren, zog man den Schalter einfach nach hinten. Dadurch wurde die
elektrische
Bremse aktiviert und verzögerte damit die
Lokomotive. Die
erzeugte
Bremskraft konnte ebenfalls an einem
Instrument abgelesen werden.
Der Blick darauf lohnte sich jedoch nur, wenn längere Gefälle befahren
wurden, denn dann musste der maximale
Strom für 45 Minuten eingehalten
werden.
Die elektrische
Bremskraft wurde weiter erhöht, wenn
man den Hebel gegen die waagerechte Stellung verschob. Reichte die zur
Verfügung stehende elektrische Bremskraft nicht mehr aus, wurde die
angeforderte Bremskraft automatisch mit der
Rangierbremse ergänzt. Wenn
der Hebel letztlich vollends in der Waagerechten war, wirkte nur noch die
Rangierbremse der
Lokomotive. Welche
Bremse genutzt wurde, entschied daher
nicht das
Lokomotiv-personal. Reichten sowohl die elektrische Bremse, als auch die Rangierbremse der Lokomotive nicht aus um eine ausreichende Verzögerung zu erzeugen, wurde die automatische Bremse benutzt. Da diese im Rangierdienst jedoch selten angeschlossen wurde, musste das Personal darüber informiert werden. Dabei wurde der Griff in die Bremsstellung verbracht. Die Steuerung schaltete nun die elektrische Bremse aus und auch die Lokomotive wurde mit der Luft gebremst.
Drückte man diese
nach oben, wirkte die pneumatische
Bremse der
Lokomotive nicht und der Zug
konnte unabhängig von der
elektri-schen
Bremse verzögert werden. Erst bei
einer
Schnellbremsung wirkte die pneumatische Bremse wieder. Etwas knifflig war es, wenn die Lokomotive von den Wagen getrennt werden musste. Dazu wurde die Fahrrichtung geändert und mit dem Fahrschalter Zugkraft gegen den mit der automatischen Bremse gebremsten Zug aufgebaut.
Damit wurden die
Puffer stärker eingedrückt und
die
Kupplung konnte gelöst werden. Da jedoch die
Zugkraft im Stillstand
nicht anstehen durfte, musste der
Fahrschalter schnell wieder gehoben
werden. Dadurch löste sich die Lokomotive und der Vorgang musste wieder-holt werden. Damit das nicht passierte. Wurde bei der Reduktion der Zugkraft die Schleuderbremse gedrückt.
Damit blieb die
Lokomotive so lange gebremst, bis die
Rangierbremse wirkte. Der Vorgang
war natürlich analog dazu auszuführen, wenn an die Wagen angefahren wurde.
Auf jeden Fall musste mit der Schleuderbremse gearbeitet werden.
Je nach Fahrrichtung nahm das
Lokomotivpersonal die passende
Seite. Der Wechsel konnte jederzeit erfolgen. Dazu musste nicht einmal am
Fahrschalter etwas verändert werden. Die rechts eingeleitete Bremsung
konnte links wieder gelöst werden. So war immer etwas Bewegung im
Führerraum, besonders dann, wenn der Fahrweg beobachtet werden musste.
Damit haben wir jedoch die Fahrt abgeschlossen und können wieder ins
Depot
zurückkehren.
Dazu zog das
Personal einfach den auf dem Pult montierten Dieselsteuerschalter auf die
Position «Ausschalten». In dieser Stellung hielt man den Hebel, bis der
Motor stillstand. An-schliessend konnte auf «0» gezogen werden. Wer zu schnell auf die Stellung «0» wechselte, konnte dem nachfolgenden Personal einen üblen Streich spielen. Durch den nun nicht sauber erfolgten Abbau des Druckes im Schmieröl sprach der Woodwardregler an.
Bei der Abrüstung wurde das nicht bemerkt, weil man
den Motor bekanntlich abgestellt hatte. Wer nun aber den
Dieselmotor
erneut starten wollte, hatte keinen Erfolg. Der Gang zur Türe mit dem
Rückstellknopf war unumgänglich.
Damit musste der Dieselsteuerschalter nur bei der
Inbetriebsetzung der
Lokomotive, oder deren Ausserbetriebnahme bedient
werden. Auf der Fahrt wurde an diesem Schalter nicht manipuliert, denn der
Dieselmotor wurde für nahezu alle Betriebszustände verwendet. Einfach
gesagt, der Dieselmotor arbeitete, wenn die Lokomotive mit eigener Kraft
am Fahren war. Zu Bedienung der Lokomotive waren die speziellen
Fahrschalter vorhanden.
Als letzte Handlung vor dem
Feierabend musste noch die
Vorheizanlage angeschlossen werden. Dazu steckte man das Kabel ein. Mit
den
Lastschaltern wurde die Anlage eingeschaltet. Mit der Hand musste
anschliessend die korrekte Drehrichtung der Pumpe geprüft werden. Als
allerletzte Handlung wurde noch die Vorheiztafel gesteckt. Anschliessend
konnte das
Lokomotivpersonal zum Feierabend schreiten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Schliesslich
konnte man die
Schliesslich
konnte man die 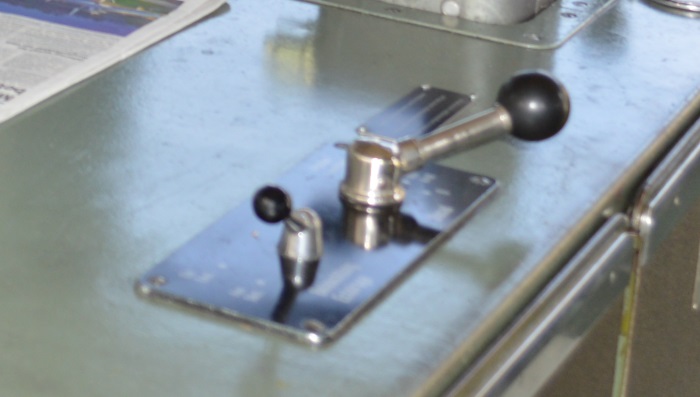 Um
den
Um
den
 Bedient
wurde die
Bedient
wurde die  Die von der Maschine gefahrene Geschwindigkeit wurde
auf beiden Seiten an den
Die von der Maschine gefahrene Geschwindigkeit wurde
auf beiden Seiten an den
