|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie auf jeder
Lokomotive
wurde auch auf der Baureihe Bm 4/4
Druckluft
benötigt. Seit die Eisenbahnen mit
Druckluftbremsen
arbeiten, wird auch und erhöhten Druck stehende Luft benötigt. Mit den
Jahren wurden auch andere Verbraucher an die Druckluft angeschlossen, so
dass diese immer wichtiger wurde. So konnten elektrische Lokomotive ohne
einen ausreichenden Vorrat von Druckluft gar nicht mehr eingeschaltet
werden.
Die Erzeugung derselben erfolgte dabei mit wenigen Ausnahmen immer auf
den
Triebfahrzeugen.
Dort war meistens auch die dazu benötigte Energie vorhanden.
Anfänglich waren das mit Dampf betriebene
Luftpumpen.
Später wurden motorisch angetriebene
Luftpresser,
beziehungsweise
Kompressoren
für die Erzeugung benutzt. Mit der Baureihe Bm 4/4 änderte sich dabei
nichts. Wobei eine neue Lösung für die Erzeugung gewählt wurde.
Diese stammte direkt vom Dieselmotor und wurde mechanisch von der Antriebswelle des Motors abge-nommen.
Bei den
Lokomotiven
mit den Nummern 18 401 bis 426 verwendete man dazu Keilriemen. Die
restlichen Maschinen erhielten jedoch Zahnriemen. Bei den Lokomotiven mit den Nummern 18 401 bis 18 426 lief der Kompressor immer mit. Er wurde deshalb mit einer Leerlaufvorrichtung ergänzt. Diese sorgte dafür, dass die Förderung von Druckluft ein-gestellt wurde, wenn der Vorrat ausreichte.
Dazu wurden die Saugventile des
Kompressors
bei Erreichen des Enddruckes abgehoben. Die angesaugte Luft, gelangte
daher durch die offenen
Ventile
wieder ins Freie. Bei einem Druck von acht
bar
wurden die Ventile wieder geschlossen.
Für die
Lokomotiven
mit den Nummern 18 427 bis 18 446 wurde eine andere Lösung gewählt.
Hier wurde der
Kompressor
nicht mehr direkt an der Antriebswelle angeschlossen. Stattdessen
baute man eine elektrische
Kupplung
ein. Diese wurde bei Erreichen des Enddruckes elektrisch gelöst, so
dass der Kompressor seine Arbeit wegen der fehlenden Bewegung
einstellte. Die massgebenden Drücke für die Schaltung blieben jedoch
gleich.
Beim
Kompressor
selber handelte es sich um ein Modell aus dem Hause MFO. Es wurde ein
Kolbenkompressor
vom Typ 2 A 320 m verwendet. Die
Druckluft
wurde in zwei Kammern verdichtet und danach in die Leitung geleitet.
Die zwei Schritte erhöhten den Druck auf zehn
bar.
Dazu wurde zuerst eine Verdichtung im
Niederdruckzylinder
erzeugt und anschliessend diese Luft im
Hochdruckzylinder
auf den maximalen Enddruck verdichtet.
Dabei beschränkte das
Überdruckventil
den maximalen Druck in der Leitung auf einen Wert von 12
bar.
Damit lag dieser Druck grundsätzlich über dem
Kompressor.
Dadurch wurde verhin-dert, dass der Kompressor sinnlos Luft ins Freie
schöpfte. In den Hauptluftbehältern, die bei dieser Lokomotive aus nicht weniger als sieben einzelnen Kammern be-standen, wurde die vom Kompressor geschöpfte Luft gespeichert.
Dadurch stieg der Druck in der Leitung an und erreichte schliesslich
den regulären Druck von zehn
bar.
Die vielen Behälter waren nötig, damit das geforderte Volumen von
2 300 Litern mit dem vorhandenen Platz auf der
Lokomotive
bereitgestellt werden konnte.
Von den
Hauptluftbehältern
gelangte die
Druckluft
in die
Speiseleitung.
Ein weiterer
Absperrhahn
erlaubte es die Hauptluftbehälter vom restlichen System abzutrennen.
So konnte die Druckluft bei remisierter
Lokomotive
gespeichert werden. Das ist besonders, denn die Lokomotive konnte, wie
das auch bei der Reihe
Bm 6/6
der Fall war, ohne Druckluft in Betrieb gesetzt werden. Daher fehlte
auch hier die bekannte
Handluftpumpe.
Die
Speiseleitung
wurde mit einem veränderlichen Druck zwischen acht und zehn
bar
betrieben. Sie versorgte die angeschlossenen Verbraucher mit
Druckluft.
Dazu gehörten die
Bremsen
und die
Pfeife
der
Lokomotive.
Dabei wurde die Pfeife auf dem Dach montiert und sie konnte mit
unterschiedlichen Stufen betrieben werden. Damit konnte auch diese
Diesellokomotive
die üblichen akustischen Signale der Schweiz erzeugen.
Obwohl man hier von der
Speiseleitung
sprach und der Druck den normalen Werten entsprach, wurde diese
Leitung nicht zum
Stossbalken
geführt. Es war daher eine auf die
Lokomotive
beschränkte Leitung. Damals erachtete man die zum Stossbalken geführte
Speiseleitung nur bei
Reisezügen
und bei
Vielfachsteuerungen
als sinnvolle Ergänzung. Beide Bedingungen musste die Baureihe Bm 4/4
nicht erfüllen, so dass man darauf verzichtete.
Ebenso, wie die auf dem Dach des
Führerhauses
montierte normale
Lokpfeife
und die
Bremsen,
war auch die
Apparateleitung
der
Lokomotive
an der
Speiseleitung
angeschlossen worden. Da die Apparateleitung mit einem Druck von sechs
bar
arbeitete, wurde der Druck über ein Reduzierventil angepasst. Die
Folge davon war, dass in der Apparateleitung ein stabiler und von den
Hauptluftbehältern
unabhängiger Druck entstand.
An dieser als
Apparateleitung
bezeichneten Luftleitung wurden Verbraucher angeschlossen, die für die
korrekte Funktion einen gleichbleibenden Druck von sechs
bar
benötigten. Dazu gehörten ausschliesslich die Bauteile der
elektrischen Ausrüstung, da nur so korrekte Funktionen sichergestellt
werden konnten. Der Grund für diese Leitung war daher der Aufbau der
Diesellokomotive
als
Dieselelektrischen
Lokomotive.
Dazu gehörten die Schleuder- und die Rangierbremse. Beide Bremsen galten als direkt wirkende Bremsen. Dabei baute die Schleuderbremse lediglich einen Druck von 0.8 bar auf.
Bei der
Rangierbremse
wurde hinge-gen ein maximaler Druck von 3.9
bar
aufgebaut.
Da beide vorgestellten
Bremsen
nicht in jedem Fall zuverlässig funktion-ierten, wurden sie lediglich
auf der
Lokomotive
zur Verfügung gestellt. Damit auch angehängte Wagen von der Lokomotive
aus gebremst werden konnten, musste ein dritte
Bremseinrichtung
eingebaut werden. Dazu verwendete man eine indirekt wirkende Bremse, die
auch unter der Bezeichnung
automatische Bremse
bekannt geworden ist.
Die
automatische Bremse
der
Bauart
Oerlikon Bremsen arbeitete mit einer als
Hauptleitung
bezeichneten Leitung. Diese Hauptleitung verfügte über einen normalen
Betriebsdruck von fünf
bar.
Die Leitung wurde durch den Zug verbunden und stand daher auch auf den
Wagen zur Verfügung. Daher wurde sie an die beiden
Stossbalken
geführt und stand dort in jeweils zwei
Luftschläuchen
mit beim Stossbalken montierten
Absperrhähnen
bereit.
Bei diesem Steuerventil handelte es sich um ein Modell von Oerlikon
Bremsen und hörte auf die Bezeichnung Lst 1. Dieses Steuerventil wurde
auch bei anderen
Lokomotiven
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB verwendet. Es handelte sich beim Steuerventil der Bauart Lst 1 um ein mehrlösiges Bremsventil, das auch die Hochleistungsbremse in Form einer R-Bremse zur Verfügung stellen konnte. Trotz der Möglichkeit wurde auf der Lokomotive der Baureihe Bm 4/4 diese Bremse nicht umgesetzt.
Der Grund für den Verzicht auf diese
Bremse
war, dass die
Höchstgeschwindigkeit
mit 75 km/h nicht hoch genug war, dass man diese
R-Bremse
benötigt hätte. Daher standen auf der Lokomotive lediglich die Personenzugsbremse und die G-Bremse zur Verfügung. Dabei konnte mit der normalerweise wirkenden P-Bremse ein maximaler Druck von 3.9 bar erzeugt werden.
Zusammen mit der mechanischen
Bremse
wurde so ein
Bremsgewicht
von 59 Tonnen erreicht. Damit berechnete sich bei der
Bremsrechnung
ein
Bremsverhältnis
von 82%. Für eine Bremse ohne
R-Bremse
ein ansprechender Wert.
Bei der
Güterzugsbremse,
die mit dem gleichen Steuerventil angesteuert wurde, wurden bei
gleichem Druck von 3.9
bar
andere Werte angegeben. So durfte hier lediglich ein
Bremsgewicht
von 51 Tonnen angerechnet werden. Das Bremsverhältnis sank auf 70%.
Speziell war, dass die effektive
Bremskraft mit der
P-Bremse
identisch war. Die geringeren Werte wurden nur vorgesehen, weil die
G-Bremse
eine deutlich längere Ansprechzeit hat.
Die
Druckluft
vom Steuerventil wurde über ein Wechselventil zu den
Bremszylindern
geführt. Das Wechselventil war notwendig, weil dort die beiden direkt
wirkenden
Bremsen
angeschlossen wurden. Dank dieser Lösung war garantiert, dass immer
der höchste Druck zu den Bremszylindern geführt wurde. Dadurch konnte
die
Lokomotive
auch bei ausgelöster
automatischer Bremse
mit der
Rangierbremse
abgebremst werden.
Damit man bei der Maschine doch noch mechanische
Bremsen
einbauen konnte, griff man zu einer speziellen Lösung, die bereits bei
den
Traktoren
angewendet wurde und nun auch auf eine
Lokomotive
erweitert wurde. Damit die quer verlaufenden Gestänge und Trapeze einer herkömmlichen Bremse weggelassen werden konnten, musste man die Einrichtung auf die beiden Seiten aufteilen.
Das hatte zur Folge, dass bei der Reihe Bm 4/4 insgesamt vier
Bremszylinder
eingebaut werden mussten. Diese unterschieden sich nicht und sie
wurden mit Hilfe von
Druckluft
ausgestossen. Eine aussen montierte Rückholfeder zog den
Zylinder
wieder in die Ausgangslage.
Es war daher keine
Federspeicherbremse
vorhanden. Eine Lösung, die man damals bei den
Lokomotiven
schlicht noch nicht kannte. Die Lösung mit vier
Bremszylindern
ergab aber auch, dass jeweils eine Seite von zwei
Triebachsen
mit einem kurzen
Bremsgestänge
verbunden wurden. Somit mussten immer zwei Bremszylinder abgetrennt
werden, wenn man eine
Achse
ungebremst haben wollte. Dadurch wurden aber zwei Achsen verloren.
Durch die Tatsache, dass alle Bauteile aussen montiert wurden, war das
vorhandene
Bremsgestänge
sehr gut zu erkennen. Ins Detail auf die einzelnen Bauteile eingehen
werde ich nicht. Es muss jedoch erwähnt werden, dass dadurch auch der
automatische
Bremsgestängesteller
der Marke Stopex gut zu erkennen war. Im Unterhalt erleichterte das
natürlich die Arbeit wesentlich, denn man musste nicht unter die
Lokomotive
kriechen.
Damit die Bremskräfte vom Zylinder besser auf die Lauffläche des Rades übertragen werden konnten, wurden spezielle Bremssohlen mit Sohlenhalter verwendet.
Dadurch wurde jedes
Rad
mit vier
Bremssohlen, die zu zweit in einem
Sohlenhalter
montiert wurden, abgebremst. Die
Lokomotive
hatte daher 32 Brems-sohlen erhalten. Bei den montierten Bremssohlen handelte es sich um die Modelle, die bei den Triebwagen der Reihe RBe 4/4 und bei der Lokomotive Bm 6/6 verwendet wurden. Sie bestanden aus Grauguss und waren damit wei-cher als die Lauffläche des Rades. Dadurch wurde die Reibung durch Abnützung der Bremssohle aufgebaut.
Die dabei entstehende Wärme wurde durch die
Bremssohle
abgeführt. Negativ war lediglich auf Aufrauhung der
Bandage.
Da beim
Bremszylinder
keine
Federspeicherbremse
vorhanden war und weil die
Druckluft
mit der Zeit aus den Bremszylindern entweichen konnte, war es nicht
möglich, die
Lokomotive
damit längere Zeit sicher abzustellen. Damit dies ermöglicht wurde,
musste man eine von der Druckluft unabhängige
Bremse
einbauen. Dazu diente auch bei dieser Lokomotive eine vom
Führerstand
aus bedienbare
Handbremse.
Mit der Spindel wurde über eine Kette, ein
Bremsgestänge
des
Drehgestells
unter dem
Führerhaus
bewegt. Damit waren zwei
Achsen
zur Hälfte gebremst. Da zwei Hälften eine ganze Achse ergaben, war
eine Achse mit der
Handbremse
gebremst worden. Das dabei angegebene
Bremsgewicht
betrug wegen der Kette lediglich fünf Tonnen. Das war sehr wenig und
führte dazu, dass selbst bei geringen Steigungen die Handbremse nicht
ausreichend bemessen war. Das Bremsverhältnis von sieben Prozent reichte gerade dazu aus, um die Lokomotive in einem Depot, oder in einem ebenen Bahnhof gegen entlaufen zu sichern. Das war ausreichend, denn auch bei Bauarbeiten auf der Strecke war die Lokomotiven meistens an Wagen gekuppelt. Kam es trotzdem zur Situation, dass die Handbremse nicht ausreichte, konnten die auf der Lokomotive mitgeführten Hemmschuhe zur Sicherung der Maschine benutzt werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Während
man bei den elektrischen
Während
man bei den elektrischen  Die
vom
Die
vom 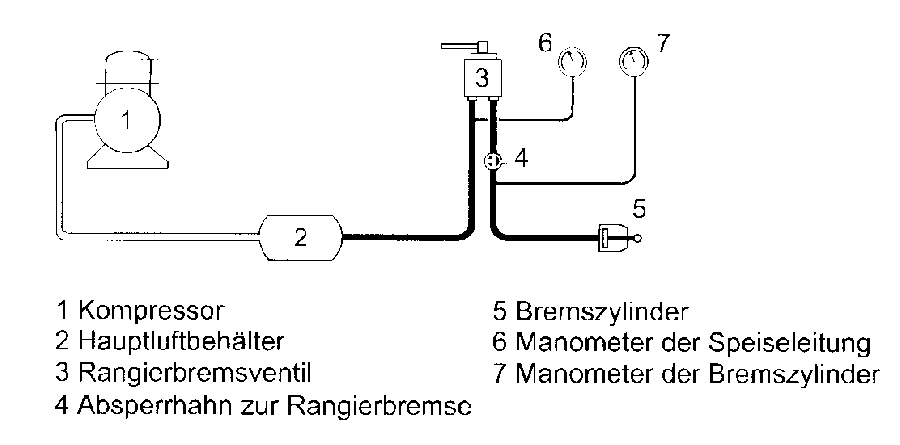 Wichtigster
Verbraucher der
Wichtigster
Verbraucher der 
 An
dem mit
An
dem mit  Das
Das