|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wie bei
Triebzügen
sehr oft der Fall, existierte hier keine Unterteilung in Neben- und
Hilfsbetriebe mehr. Dennoch wollen wir uns zuerst die
Nebenbetriebe
ansehen. Eine eigentliche
Zugsammelschiene
gab es nicht, da deren Versorgung das Problem war. Bei den Bahnen mit den
vier hier installierten
Stromsystemen,
ergaben sich auch so viele
Spannungen
bei den Zugsammelschienen. Daher war es sinnvoll gleich auch diese zu
verzichten.
Diese Betriebsform war jedoch nur bei einem
Defekt vorgesehen und in diesem Fall, fuhren keine Rei-senden mehr mit.
Der Verzicht auf die
Nebenbe-triebe
war daher kein Problem. Somit benötigen wir gute
Hilfsbetriebe. Mit dem Verzicht auf eine klassische Zugsammel-schiene mussten die normalerweise dort angeschlos-senen Baugruppen an den Hilfsbetrieben ange-schlossen werden. Betroffen waren davon die Klima-anlagen der Abteile. Der Anschluss von
Klimageräten
wurde bei
Trieb-zügen
immer wieder unterschiedlich gelöst. Daher lohnt es sich, wenn wir etwas
genauer auf den Anschluss dieser Verbraucher bei den ETR 610 sehen. Klimaanlagen bestanden in der Regel aus zwei getrennten Baugruppen. Das waren die Lüfter und die Kompressoren für das Kühlmittel. Diese wurden seit der Einführung der Umrichtertechnik an Dreh-strom und somit immer wieder an den Hilfsbetrieben angeschlossen. Sowohl beim
Lüfter,
als auch beim
Kompressor
be-nötigte man Motoren und dank dieser Lösung konn-ten diese auf dem Markt
günstig bezogen werden. Der zweite Bereich der
Klimageräte
waren die Heizregister. Diese bestanden aus einfachen
Widerständen.
Sie wurden sehr oft einfach mit
Wechselstrom
versorgt, weil dieser nicht so aufwendig aufbereitet werden musste. Bei
den ETR 610 ging dies jedoch nicht, da sonst die
Heizung
bei
Gleichstrom
ausgefallen wäre. Der Anschluss direkt an 3000
Volt
war auch nicht besonders ratsam, da so hohe
Spannungen
isoliert werden mussten.
Es erfolgte ein Anschluss an zwei
Leitungen. Damit war wieder ein normaler
Wechselstrom
vorhanden, der aber immer verfügbar war. Später werden wir diese
Eigenschaft des
Drehstromes
noch einmal nu-tzen. Um die im Triebzug verbauten Klimaanlagen abzu-schliessen, müssen wir noch die beiden Führerstände ansehen. Diese besassen eigene Geräte und sie konn-ten den Bedürfnissen angepasst werden. Traditionell waren diese Anlagen aber immer
an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen worden. Die Trennung war erforderlich, damit der
Führerraum
nicht mit Rauch gefüllt wurde, wenn im Abteil dahinter ein Brand
entstanden war. Für die Versorgung der
Hilfsbetriebe
müssen wir wie-der zu einem
Zwischenkreis
zurückkehren. Welchen wir dabei nehmen, spielte keine Rolle, denn die hier
vorgestellte Schaltung war bei jedem
Umrichter
vorhanden. So war gesichert, dass die Hilfsbetriebe immer zur Verfügung
standen. Ein Punkt der bei Störung sehr wichtig war, denn auch ein
Totalausfall der Hilfsbetriebe war gemäss
Ausschreibung
nicht zugelassen. Da der
Zwischenkreis
offen ausgeführt wurde, musste für die
Hilfsbetriebe
kein vollwertiger
Umrichter
verwendet werden. Es wurde einfach ein
Wechselrichter für die
Hilfsbetriebe angeschlossen. Dieser Wechselrichter war ebenfalls mit
IGBT
aufgebaut worden und er lieferte eine
Spannung
von 3x 400
Volt
bei einer
Frequenz von 50
Hertz. Zudem war eine Schaltung zu einem Mittelpunkt
vorhanden. Bezeichnet wurde er als Sternpunkt.
Die Steckdosen führten daher nur
Strom, wenn die
Hilfsbetriebe
aktiv waren. Wurde der
Triebzug
ausge-schaltet, fielen auch
die in den Wagen verteilten Steckdosen aus. Entsprechende Hinweise machten
daher die Nutzer darauf aufmerksam. Die von diesen vier Bordnetzumrichtern erzeugte Spannung wurde nach den Sicherungen einer gemein-samen und durch den Zug geführten Zugsammel-schiene zugeführt. An dieser vierpoligen
Leitung wurden schliesslich alle Verbraucher angeschlossen und das
erfolgte durch den
Triebzug
verteilt, weil ja die Bauteile auch so verbaut
werden mussten. Einzig Wagen drei bekam keine Teile, da dort der
Speiseraum mit der schwe-ren Küche eingebaut wurde. Auch die Küche war an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen. Dort konnten somit übliche Geräte für den Haushalt
verwendet werden. Wie wichtig aber der Verzicht auf weitere Bauteile war,
erkennt man, wenn man weiss, dass ein Kühlschrank bereits ausreichte um
für Problemen mit der
Achslast bei diesem Wagen zu sorgen. Daher war der
falsch platzierte Kühlschrank bei der Einleitung kein Witz gewesen und das
Thema kommt noch einmal. Es wird Zeit, dass wir uns den klassischen
Verbrauchern der
Hilfsbetriebe zuwenden. Ein wichtiger Teil war auch hier
die
Kühlung
der beanspruchten Teile. Wie bei anderen Baureihen wurden zur
Einsparung des Gewichtes Bauteile geschwächt ausgeführt. In der Folge
erwärmten sich diese im Betrieb so, dass sie künstlich gekühlt werden
mussten. Dazu gehörten die
Stromrichter und der
Transformator.
Dieses
Öl umgab die
Wicklungen und verbesserte so die
Isolation. Gleichzeitig wurde aber auch die Wärme von den Leitern
abgeführt und diese so gekühlt. Die dabei auftretenden thermischen Effekte
wurde mit einer künstlichen Zirkulation unterschützt. Die dazu verbaute
Ölpumpe war an den
Hilfsbetrieben angeschlossen worden und sie beförderte
das
Transformatoröl zu einem speziellen
Ölkühler, wo es abgekühlt wurde. Der
Ölkühler wiederum wurde durch einen künstlichen
Luftstrom gekühlt. Dieser wurde von einem
Ventilator erzeugt. Dabei wurde
die Luft unter dem Fahrzeug angezogen und nach dem
Kühler wieder ins
Freie entlassen. Diese Lösung verhinderte lange und vor allem schwere
Kanäle durch den Wagenkasten. Erneut ist zu erkennen, dass um jedes
Kilogramm gekämpft wurde, denn der
Neigezug hatte auch so ein ansehnliches
Gewicht. Weiter mussten auch die
Stromrichter gekühlt werden.
Hier wurde auf eine
Kühlung
mit Wasser gesetzt. Der Vorteil der
IGBT war,
dass sie auch mit diesem nicht brennbaren Medium gekühlt werden konnten.
Zudem war das
Kühlmittel
auch sehr gut bei der Aufnahme der abgegebenen Wärme.
Einzig die schlechten Eigenschaften bei der
Isolation verhinderten, dass
auch bei den
Transformatoren
auf diese Kühlmittel gesetzt wurde.
In diesem
Kühler wurde die Wärme entzogen. Dazu war auch jetzt
eine künstliche
Ventilation vorhanden. Damit gab es bis auf die Art des
Kühlmittels keinen Unterschied zu den zuvor vorge-stellten
Transformatoren. Alle Massnahmen, die wir bisher zur Verminderung des Ge-wichtes kennen gelernt haben, ging bei den Motoren nicht mehr. Bei den Fahrmotoren konnte diese Lösung nicht umgesetzt werden. Die unten am
Kasten montierten Motoren wurden mit einer passiven
Kühlung
versehen. Ein
an der Antriebswelle montiertes Lüfterrad drückte dabei etwas Luft durch
den Motor und nahm so die dort entstehende Wärme auf. Diese Eigenventilation wurde bei Fahrmotoren immer wieder an-gewendet. Deren Nachteil, das sie erst bei schneller Fahrt optimal arbeiten konnte, durfte bei einem Neigezug vernach-lässigt werden. Wenn die Belastung der Motoren kritisch wurde, setzte die
Ventilation ein
und damit auch die
Kühlung. Eine leichte Lösung, die bei den meisten
Fahrmotoren von Neigezügen angewendet wurde. Die ETR 610 bildeten daher
keine Ausnahme, denn auch die
ICE-T,
ICN
und ETR 470
waren so aufgebaut worden. Nicht nur die
Kühlungen waren an den
Hilfsbetrieben
angeschlossen worden. Es gab auch die üblichen Baugruppen. Dazu gehörten
die
Kompressoren. Diese waren über
Lastschalter angeschlossen worden und
die Regelung wurde von der Steuerung übernommen. Damit ergeben sich aber
auch andere Lösungen bei mangelndem Luftvorrat. Dazu müsste man nur die
Hilfsbetriebe ab einer externen Quelle versorgen.
Daher war es kein Problem,
dass beim
Neigezug nur diese montiert wurden.
Unterhaltsanlagen, die noch eine alte
Anlage besassen, mussten daher um ein Zwischenstück bemüht sein. Dort konnte ein passendes Kabel angeschlossen und dieses mit einer normalen Steckdose des Landes-netzes verbunden werden. So war es möglich die Hilfsbetriebe und damit die Kompressoren, aber auch die Klimaanlagen ab einer externen Quelle zu versorgen. Ging das jedoch nicht,
wurden die
Stromabnehmer einfach mit den
Hilfsluftkompressor gehoben und der
Zug eingeschaltet. Ein Betrieb ohne
Fahrleitung war nicht vorgesehen. Bleibt zum Schluss noch die Ladung der auf dem Fahrzeug verbauten Batterien. Diese Batterieladung war so ausgelegt worden, dass sie das Bordnetz versorgen und die Batterien laden konnte. Eine alte Regelung, die immer wieder verstärkt wurde und die grundsätzlich
über die
Hilfsbetriebe versorgt wurde. Dazu waren im Zug zahlreiche
Batterieladegeräte verbaut worden. Diese konnten jedoch nicht geschaltet
werden. Auch jetzt war also eine
Redundanz vorhanden, die
verhindern sollte, dass es zu einem Totalausfall kommen sollte. Gerade das
Thema Redundanz war wichtig, da der Besteller bei der
Ausschreibung mit diesen Einheiten
verhindern wollte, dass es zum gleichen Debakel kam, wie bei der Reihe
ETR 470. Die Erkennung von Störungen war deshalb besonders wichtig. Nur sind
wir damit auch im Bereich der Steuerung und bei einem neuen Kapitel
angelangt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2023 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Die
sonst am Ende des Fahrzeuges vorhandenen Steckdosen waren nicht vorhanden.
Wurde der
Die
sonst am Ende des Fahrzeuges vorhandenen Steckdosen waren nicht vorhanden.
Wurde der
 Es
blieb daher nur die Lösung, dass auch die Heiz-register an den
Es
blieb daher nur die Lösung, dass auch die Heiz-register an den
 Dieser Sternpunkt wurde für die im Zug
verteilten Steckdosen benötigt. Dank dem Anschluss an den Sternpunkt und
einen Leiter, konnte so eine
Dieser Sternpunkt wurde für die im Zug
verteilten Steckdosen benötigt. Dank dem Anschluss an den Sternpunkt und
einen Leiter, konnte so eine
 Gerade beim
Gerade beim
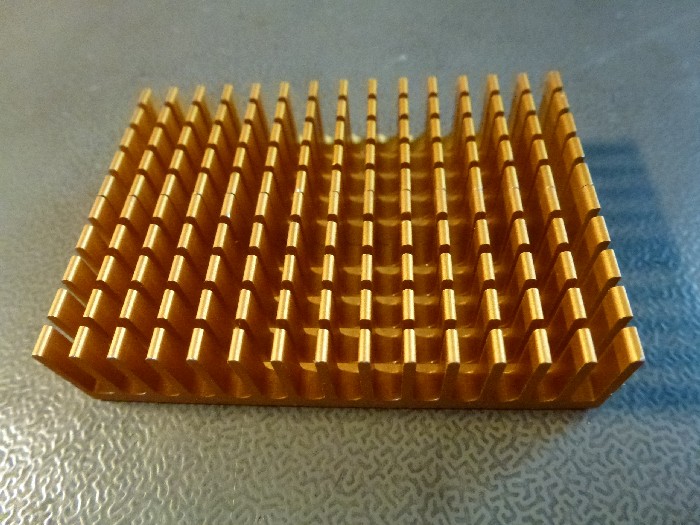 Wie bei den
Wie bei den
 Seitlich am
Seitlich am