|
Umbauten und Änderungen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Nach der Betrachtung der Konstruktion konnte
eigentlich erwartet werden, dass die Baureihe Re 450 gut funktionierte.
Viele wichtige Teile stammten von der KTU Re 4/4 und waren daher erprobt.
Wirklich verändert wurde eigentlich nur der
Antrieb,
wo die Konstrukteure neue Gummielemente eingebaut hatten. Beim Bau konnte
niemand ahnen, dass gerade diese für den grössten Ärger zu Beginn des
Einsatzes führen sollten.
Eine normale
Unterhaltsanlage
war dazu nicht in der Lage, daher ging es zur Garantiearbeit zurück an den
Hersteller. Soweit war die Welt noch in Ordnung. Doch das sollte nicht
lange dauern.
Als nur kurze Zeit später eine weitere
Lokomotive
mit defekten
Antrieben
auftauchte und diese nur wenige Tage später von einer weiteren Maschine
begleitet wurde zeigte sich ein Problem. Die Baureihe Re 450 hatte ein
grosses Problem, das verhinderte, dass die Lokomotive in den Betrieb gehen
konnte. Die Folge davon war, dass die Verfügbarkeit auf einen miserablen
Wert gesunken war. Das Problem musste behoben werden und das war die
Aufgabe der Hersteller.
Es standen neben den Schäden auch noch
andere Garantiearbeiten an. Doch die
Antriebe
bereiteten grosse Sorgen. Die anfänglichen Schuldzuweisungen an den
Lieferanten waren dabei auch nicht zielführend. Es mussten neue Elemente
benutzt werden und wichtiger war, dass man herausfand, was die Ursache für
diese Schäden war. Kannte man diese, konnten eventuell Massnahmen
getroffen werden, die zur Vermeidung führten.
Nur führte das dazu, dass Schläge auf den
Antrieb
über-tragen wurden. Mit den Gummielementen wollte man den Motor davor
schützen. Die Elemente wurden jedoch dabei so schnell zerstört, dass der
Einsatz darunter litt. Die Sanierung der Antriebe war wichtig und musste schnell erfolgreich abgeschlossen werden. Die Mass-nahmen umfassten neue Gummielemente, die kräftiger waren und eine neue Einstellung für den Schleuderschutz, der verhindern sollte, dass die Zahl der Schläge zu hoch wurde.
Daher sollte nicht mehr so oft mit dem
Makroschlupf
beschleunigt werden. Dankbar waren dabei sicherlich auch die Anwohner, die
von den Geräuschen belästigt wurden.
Die Sanierung der
Antriebe
konnte nicht in den Hallen des Herstellers ausgeführt werden. Dazu fehlte
schlicht der Platz, denn es wurden auch andere
Lokomotiven
gebaut. Daher musste eine Alternative gesucht werden. Auch bei den
Staatsbahnen
gab es angeblich keine
Kapazitäten.
Aus diesem Grund wurden die defekten Modelle zur SOB nach Samstagern
überstellt. Die Rückfahrt konnte dabei oft wieder in eigener Kraft
erfolgen.
Ab 1993 war die Sanierung der
Antriebe
in vollem Gange und die Abklärungen waren auch abgeschlossen worden. Neben
den Problemen mit dem Antrieb, gab es auch Schäden an den
Laufflächen
und was noch schlimmer war, auch an den
Schienen.
Gerade im Raum Stadelhofen und Stettbach waren diese besonders schlimm.
Orte, an denen immer eine schnelle Beschleunigung erfolgte und welche
durch Wasser genässte Schienen hatten.
Erst mit Abschluss der Sanierung, konnte
hier eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Die Baureihe Re 450
begann immer besser zu funktionieren. Trotzdem sollte es nicht lange ruhig
bleiben. Diesmal meldeten sich die Lokführer zu Wort. Die neue
Klimaanlage
funktionierte mehr schlecht als recht. Das ging oft so weit, dass im
Sommer geheizt wurde. Abschalten konnte man das Ding, aber dann mussten
die Fenster auf.
Daher musste mit viel
Leistung
gearbeitet werden. Nur ein neues Modell konnte in diesem Punkt zu ein-er
Abschaffung sorgen. Sprüche, wie die Reisenden hätten auch keine
Klimaanlage
waren jedoch nicht zielführend. Als Muster für die neuen Klimaanlagen war die Lo-komotive mit der Nummer 450 105. Sie erzielte schnell gute Ergebnisse, so dass diese Arbeiten auch den anderen Führerständen ausgeführt werden konnten.
Ein weiteres Problem aus dem Bau war damit
nach wenigen Jahren behoben worden. Die Reihe Re 450 begann nach sehr viel
Aufwand endlich zuverlässig zu funktionieren. Die erhofften Einsparungen
konn-ten endlich umgesetzt werden. Der zuverlässige Einsatz über die Jahre zeigte, dass die Lösung gut war. Jedoch standen nun auch die ersten Revisionen an.
Diese und die Tatsache, dass die
Pendelzüge
nicht mehr den aktuellen Gesetzen entsprachen, führten dazu, dass ein
umfassendes Programm ins Leben gerufen wurden. Dieses mit Anpassungen der
Züge im Raum Zürich erdachte Projekt wurden aus diesem Grund als LION
geführt und es war umfangreich.
Die Planung sah dabei vor, dass bei den Wagen neu
Klimaanlagen verbaut werden sollten. Zudem war vorgesehen, den Wagen
zweiter
Wagenklasse aus zu reihen und durch ein neues Modell zu ersetzen.
Bei diesen sollte es behinderten Personen möglich sein, aber den neuen
Perron ohne Hilfe in den Zug zu gelangen. Insbesondere Benutzer von
Rollstühlen konnte keine Treppen befahren. Das Problem sollte mit dem
neuen Wagen behoben werden.
Dabei nehme ich die Reihenfolge der
Vorstellung. Im mechanischen Bereich wurde eine
Revision
R3 ausgeführt und
diese umfasste auch einen neuen Anstrich für die Bau-teile. Oft kamen damit
neue Design. Die Farbgebung wurde nicht verändert. Vielmehr führte man nur eine Vereinfachung durch. Die bei der Ausliefer-ung auf den Sicken noch vorhandenen weissen Striche gab es nicht mehr.
Damit bekam die
Reihe Re 450 eine blaue Erscheinung, die zudem nicht mehr so verspielt
wirkte, wie vorher. Die Anpassung an die Regeln der Schweizerischen
Bundes-bahnen SBB konnte nicht erfolgen, da immer noch der ZVV mitreden
durfte. Die Anschriften wurden nur leicht verändert. Neu war an der Front ein Emblem vorhanden. Dieses bildete das Signet der Schweizerischen Bundesbahnen SBB und es war verchromt worden.
An der
Front
war daher erstmals auch der Besitzer zu erkennen. Die
Staatsbahnen setzten
daher wieder mehr auf eine klare Erkennbarkeit auch an den Fronten. Der
Lokomotive, aber auch dem
Steuerwagen, bekam das noch recht gut.
Anpassungen gab es auch bei den Nummern. Diese
wurden nach den neusten Regeln erstellt. Wobei hier die ersten Maschinen
wieder in den Unterhalt mussten, damit sie die neuen Nummern abholen
konnten. Neu wurden diese nach den Regeln der
TSI erstellt und damit
ergänzt. Die
Lokomotive hatte dabei die neue Nummer erhalten, die wir uns
am Beispiel der 450 000 ansehen. Neu lautete die Nummer 91 85 4450 000-5
CH-SBB.
Neue
Stromrichter hätten die Kosten zu sehr erhöht. Doch
sehen wir uns die umfangreichen Arbeiten bei der
Be-leuchtung und bei der
Steuerung an. Hier mussten die Arbeiten teilweise auch neue Vorgaben
erfüllen. Die Beleuchtung an der Front wurde verändert. Die bis-herigen Halogenlampen waren gemäss der Landesregier-ung in wenigen Jahren nicht mehr zugelassen. Zudem waren sie oft defekt.
Daher wurden
neue Lampen eingebaut, die zur
Beleuch-tung LED benutzten. So konnte ein
helles Licht erzeugt werden, dass jedoch einen kälteren Farbton hatte. Der
grosse Vorteil war, dass die LED länger leuchten konnten, als die
Lokomotive fahren.
Ein Mangel aus der Ablieferung wurde auch behoben.
Das Spitzensignal erfolgte dank der neuen oberen Lampe nun korrekt. Die
Idee mit dem Linientransparent war nicht so gut. Besonders auch, wenn die
Anzeige neu mit dunklem Grund und neuer gelber Schrift erfolgte. Die
dritte Lampe führte aber dazu, dass die Maschinen aus dem Projekt LION
leicht zu erkennen waren. Sie sehen, dass nicht alle Ideen wirklich gut
waren.
Angepasst wurden auch die
Zugsicherungen. So war das
ZUB 121 nicht mehr zeitgemäss und wurde durch die Variante ZUB 262
ersetzt. An den Anzeigen war dies jedoch nicht zu erkennen. Jedoch war es
damit auch möglich, dass ZUB mit Hilfe von
ETM die neuen
Balisen auslesen
konnte. Die
Meldungen der Balisen wurden dabei in Anzeigen für ZUB 262,
aber auch für die Signale der alten Zugsicherung
Integra-Signum
aufbereitet.
Es zeigte sich erstmals,
dass die Wünschte der
Infrastruktur schier un-überwindbare Kosten
verursachen konnten. Die Zeche für solche Ansinnen, mussten auch bei den
Bahnen der Kunde bezahlen. Die Reihe Re 450 sollte deshalb weiterhin nur
mit Signalen verkehren können. Das Funkgerät war schon vorgängig auf den aktuellen Stand gebracht worden. Wie beim alten Gerät konnten die Zugdaten für ZUB 262 am Funkgerät eingegeben werden. Jedoch wurde nun ein digitaler Funk generiert.
Mit dem Modell für
GSM-R konnten sogar ganz normale Telefonate
ge-führt werden. Auch die
Lokomotive war davon zu erreichen. Man muss-te
einfach die Nummer kennen, denn die brauchte man auch für den
Funk. Die UIC-Leitung wurde auf 18 Pole umgerüstet. Die zusätzlichen Adern konnten für die neue Notbremsanforderung genutzt werden. Diese NBA führte nur im Bereich der Haltestellen zu einer Zwangsbremsung.
Auf der Strecke wurde dem Lokführer nur eine
Meldung
übermittelt. Er konnte den Zug jedoch noch normal an einem dazu geeigneten
Halteort fahren. Gerade bei der
S-Bahn Zürich mit den vielen
Tunnel ein
grosser Vorteil.
Weitaus die grössten Veränderungen gab es jedoch bei
den Wagen. Das unmittelbar bei der
Lokomotive eingereihte Modell wurde aus
dem Verband entfernt. An dieser Stelle sollte der von der Industrie
gelieferte neue Wagen mit niederflurigen Einstiegen eingereiht werden. So
sollten die
Pendelzüge
wieder den Gesetzen der Schweiz entsprechen. Mit
dem neuen Wagen wurde jedoch aus dem Pendelzug ein normaler
Triebzug.
Dabei
wurden die bisherigen Türen in einer roten Farbe gestrichen. Weitere
Anpassungen gab es jedoch nicht, da die Arbeiten eher den Innenraum
umfassten, denn bei diesem wurde die
Heizung verändert und auch sonst
Arbeiten ausgeführt.
Neu waren auch die Wagen mit einer
Klimaanlage
versehen worden. Diese arbeitete wie die bisherige
Lüftung, konnte nun
aber die Temperatur der Luft regulieren. Eine Massnahme, die einfach dem
aktuellen Zeitgeist entsprach, denn der Reisende erwartete auch bei einer
S-Bahn eine Klimaanlage. Mit den Arbeiten wurde diesem Umstand Rechnung
getragen. Doch auch andere Arbeiten mussten dringend ausgeführt werden.
So wurde die
Notbremse an die neue
NBA angepasst und
auch der Brandschutz in den Wagen erneuert. Gerade in diesem Bereich waren
in den letzten Jahren sehr grosse Fortschritte erreicht worden, die nun
auch in diesen Fahrzeugen umgesetzt werden sollten. In Sachen Brandschutz
und Notbremse waren die Wagen damit wieder auf dem aktuellen Stand und das
war wegen den langen
Tunneln bei der
S-Bahn Zürich sehr wichtig.
Weitere Verbesserungen beim Komfort gab es nicht
mehr. So blieb die Bestuhlung erhalten und auch die anderen Arbeiten
betrafen eigentlich nur die von der
Lokomotive her erfolgten Anpassungen.
Mit anderen Worten, es wurde ein neues System für die Durchsagen und
Anzeigen eingebaut. Damit war es nun möglich die Anzeigen in Echtzeit
anzupassen. Besonders wichtig, wenn die Anschlüsse nicht mehr erreicht
werden konnten.
Die Fahrzeuge
kehrten daher getrennt wieder nach Zürich zurück, wo der neue
Triebzug
formiert und eingestellt wurde. Eine Massnahme, die dank den
Kupplungen im
Zug möglich war. Bei der Formation der neuen Triebzüge wurden die Lokomotive, die revidierten Wagen und der neu von der Industrie gelieferte Wagen NDW zu einem Zug verbunden. Dabei war die Reihenfolge immer NDW, AB und Bt.
Es blieb daher bei den drei Wagen und dem 100 Meter langen Zug.
Wichtig war, dass nun im NDW die Rechner für die Diagnose vorhanden waren.
Der
Pendelzug
war daher Geschichte und er wurde auch offiziell als
Triebzug geführt. Uns bleibt nur noch die Frage, was mit den überzähligen Wagen geschehen sollte. Diese wurden bekanntlich auch revidiert. Sie sollten zu neuen Zügen formiert werden.
Da aber die Anzahl
Re 450 nicht ausreichte, wurden dazu Maschinen der Reihe
Re 420 genommen.
Diese arbeiteten dabei immer zu zweit von beiden Seiten des Zuges. So
konnten die Wagen noch während der HVZ eingesetzt werden und die
S-Bahn
Zürich hatte dringend benötigte
Doppelstockwagen.
Auch wenn es nicht direkt zu den hier vorgestellten
Maschinen gehört. Die Reihe Re 420 für das Projekt LION wurden im IW
Bellinzona hergerichtet und dabei erfolgten Anpassungen an die neuen
Doppelstockwagen, denn diese besassen eine
EP-Bremse und die wurde auch
von den neuen
Triebfahrzeugen genutzt. Die Züge der HVZ waren deshalb gut
zu erkennen. Zwei Re 420 und dazwischen sechs Wagen aus den Zügen mit Re
450.
Dort wurde der neue Wagen NDW jedoch als zusätz-liches Fahrzeug benutzt, so
dass bei der SZU etwas längere Modelle eingesetzt wurden. Eine Mass-nahme,
die zeigte, dass bei einer
Privatbahn andere Regeln galten, als bei einer
Staatsbahn.
Das Projekt LION konnte im Jahre 2017 beendet
werden. Damit war auch der letzte
Pendelzug
mit
Lokomotive Re 450
verschwunden. Die Einheiten blieben nun fest zusammen und wurden daher
auch als
Triebzüge geführt. Es bleibt eigentlich nur der Hinweis, dass wir
bei den Nummern der einzelnen Fahrzeuge die alte Regel immer noch erkennen
konnten, denn der neue Triebzug erhielt weiterhin keine eigene
Betriebsnummer.
Wir können die Umbauten und Änderungen bei der
Lokomotive Re 450 beenden. Auch das Projekt LION konnte an der Tatsache
nicht viel ändern, dass die Baureihe nach den grossen Schwierigkeiten beim
Start gut und zuverlässig funktionierte. Das zeigt sich auch hier, denn es
wurden die Kinderkrankheiten und die dringend erforderliche Modernisierung
behandelt. Die weiteren kleineren Arbeiten werden wir uns beim Einsatz
noch ansehen.
Damit haben wir den Aufbau und die Anpassungen der
Fahrzeuge abgeschlossen. Die Baureihe Re 450 als
Lokomotive ausgeliefert
und nun zu einem
Triebkopf des neuen
Triebzuges mutiert, hatte noch eine
lange Karriere vor sich, denn der Umbau sollte den Einsatz um weitere 20
Jahren verlängern. Für uns wird es aber nun Zeit wieder zu den Anfängen zu
gehen. Die neue gebauten Lokomotiven mussten zuerst in Betrieb gesetzt
werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
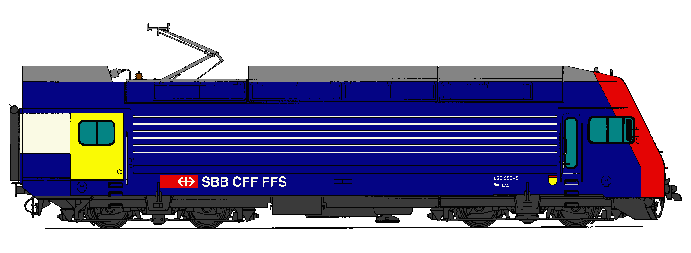 Es
begann, als die erste
Es
begann, als die erste
 Bei
den Abklärungen zeigte sich schnell, dass die
Bei
den Abklärungen zeigte sich schnell, dass die
 In
den langen
In
den langen
 Beginnen wir auch hier bei der
Beginnen wir auch hier bei der
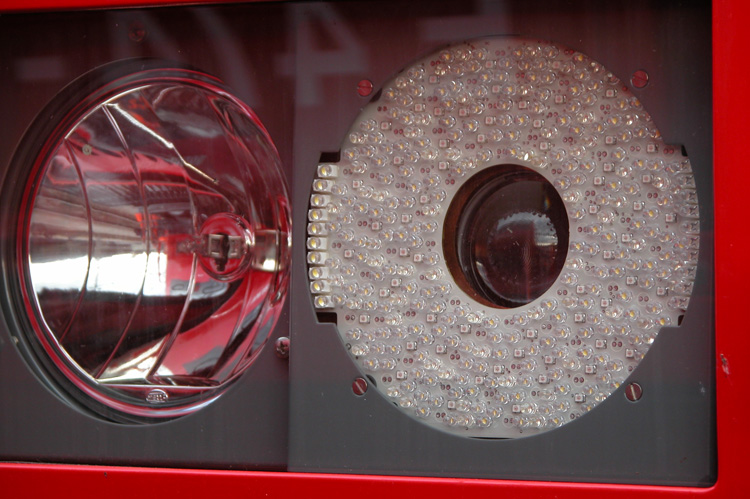 Weitaus grösser waren die Arbeiten bei der
Weitaus grösser waren die Arbeiten bei der
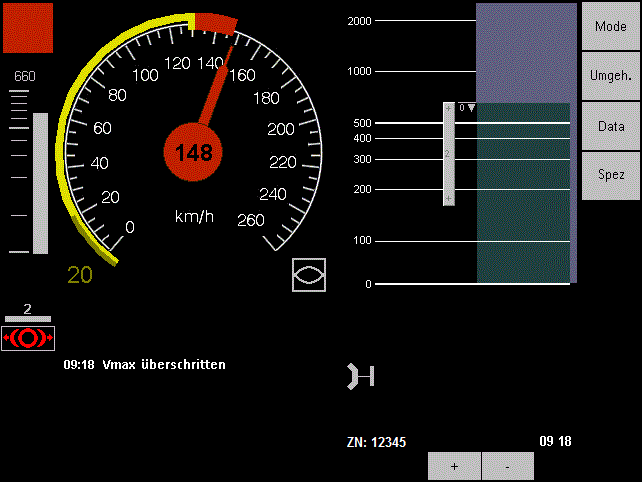 Auf
eine Ausrüstung mit
Auf
eine Ausrüstung mit
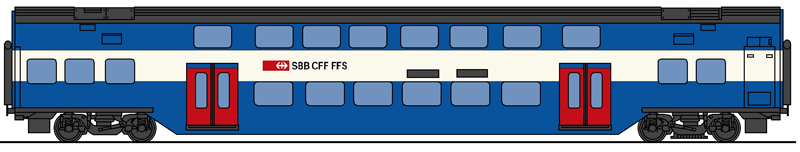 Die nicht mehr benötigten Wagen wurden dem Programm
der anderen alten Modellen zugeführt. So sollten alle
Die nicht mehr benötigten Wagen wurden dem Programm
der anderen alten Modellen zugeführt. So sollten alle  Die Arbeiten wurden von den
Die Arbeiten wurden von den
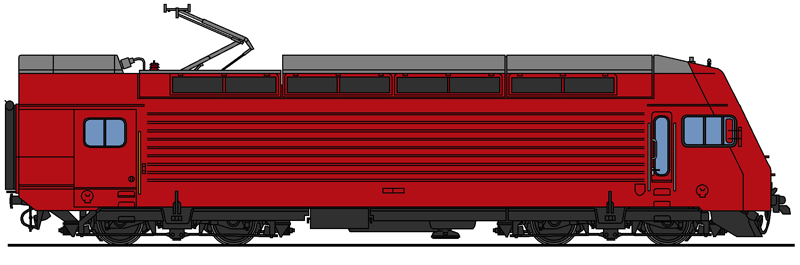 Auch wenn wir bisher nur von den Fahrzeugen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB gesprochen haben. Die beiden bei der SZU
verkehrenden Ein-heiten, wurden ebenfalls in dieses Programm aufge-nommen.
Auch wenn wir bisher nur von den Fahrzeugen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB gesprochen haben. Die beiden bei der SZU
verkehrenden Ein-heiten, wurden ebenfalls in dieses Programm aufge-nommen.