|
Bedienung des Triebwagens |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um die Bedienung des
Triebwagens zu betrachten,
begleiten wir einen Lokführer, wie er das Fahrzeug am Morgen an seinem
Standplatz übernahm und damit eine Fahrt durchführte. Dadurch lernen wir
alle für die Bedienung erforderlichen Befehle und Handlungen kennen. Damit
es nicht zu leicht wird, gehen wir davon aus, dass der Triebwagen in einem
Depot steht und ausgeschaltet war. So selten, wie Sie denken war das gar
nicht.
Nur schon der Weg in das Fahrzeug war nicht leicht. Die
Türen wurden mit Hilfe von
Druckluft geöffnet und im Betrieb durch die
Steuerung verriegelt. Da beides in diesem Fall nicht vorhanden war,
konnten die Türen nicht geöffnet werden. Um in den
Triebwagen zu gelangen
war es erforderlich, dass die Türen manuell geöffnet wurden. Dazu musste
mit der Hand zwischen die Gummidichtungen gegriffen werden. Anschliessend
konnten die Türen aufgerissen werden.
Bis zu diesem Punkt standen von der
Beleuchtung nur wenige Lampen zur
Verfügung, so dass eigentlich nur die technischen Bereiche erhellt wurden.
So war gesichert, dass die Beleuchtung die
Batterien nicht entleerte. Die weitere Inbetriebnahme konnte schliesslich im Führerstand erfolgen. Welchen man benutzte war nur insofern wichtig, dass damit die spätere Fahrrichtung definiert wurde. Dabei galt der Grundsatz, dass immer der vordere Führerstand benutzt wurde.
Zwar konnte man mit dem
Fahrzeug auch rückwärtsfahren, je-doch konnte in diesem Fall der Fahrweg
nur unzureichend beob-achtet werden. Daher war diese Fahrt nur mit
Rangierpersonal möglich. Betrachten wir den Führerstand und somit den Arbeitsplatz des Lokführers genauer. Damit lernen wir auch gleich die Bedienung kennen. Der eigentliche Arbeitsplatz des Lokführers war verhält-nismässig eng gebaut worden.
Man
konnte nur den vorhandenen Platz nutzen und dieser wurde durch die
Übergangstüre in der Frontpartie beschränkt. Dadurch entstand auf der
rechten Seite des
Triebwagens eine
Führerkabine.
Beengend wirkte dabei auch
die Möglichkeit, diesen Arbeitsplatz von den Fahrgästen abzugrenzen. Dies
war nötig, damit nicht unerwünschte Handlungen durch die Reisenden
vorgenommen werden konnten. Immerhin stand dem Lokführer eine
Sitzgelegenheit zur Verfügung. Diese durfte auch während der Fahrt genutzt
werden. Ein Punkt, der bei den
Triebwagen schon sehr früh umgesetzt wurde
und allmählich auch auf den
Lokomotiven angewendet wurde.
Vor sich fand der Lokführer
die Bedienelemente vor. Dabei war natürlich der
Steuerkontroller in der
Mitte dominierend angeordnet worden. Bevor damit jedoch Fahrbefehle
erteilt werden konnten, musste der
Triebwagen eingeschaltet werden. Dazu
diente man, wie bei anderen Fahrzeugen auch, die
Steuerschalter. Diese
sorgten letztlich dafür, dass die
Batterien entlastet wurden, weil der
Triebwagen unter
Spannung gesetzt worden war.
Dank diesem Kasten, der vor wenigen Jahren eingeführt wurde, waren
zumindest die
Steuerschalter kleiner geworden und be-nötigten daher weniger
Platz. Zudem konnten diese Schalter nun auch an schmalen Stellen montiert
werden, was gerade bei eng-en
Führerständen genutzt wurde.
Jedoch war es dank dem
Schlüssel, der diesen Verriegelungs-kasten frei gab, auch möglich die
Steuerschalter zu blockieren. Dadurch war es unbefugten Personen nicht
möglich im unbesetzten
Führerstand Manipulationen vorzunehmen. Nur mit dem
Schlüssel war dies möglich. Der Schlüssel war nur einmal vorhanden und
musste bei jedem Wechsel des Führerstandes mitgenommen werden. Was in
einer Tasche der Hosen leicht möglich war.
Deshalb waren in diesem Verriegelungskasten alle
notwendigen
Steuerschalter zusammengefasst worden. Dazu gehörte, die
Inbetriebnahme der Steuerung, das heben des
Stromabnehmers und das
Einschalten des
Hauptschalters. Durch die angebrachten Symbole wusste das
Personal was für einen Schalter betätigt wurde und welche Reaktion zu
erwarten war. Die Schulung für das
Lokomotivpersonal konnte so vereinfacht
werden.
Die Anordnung der Bedienelemente und der Anzeigen war
geordnet erfolgt. So hatte der Lokführer die auf der Fahrt wichtigen
Informationen direkt in seinem Blickfeld. Das erlaubte, einen kurzen
Kontrollblick, ohne dass dabei die befahrende Strecke lange aus dem
Sichtfeld war. Eine Lösung, die nicht nur die Sicherheit erhöhte, sondern
auch die Bedienung des
Triebwagens wesentlich vereinfachte. Jedoch wird es
nun Zeit, dass die Fahrt vorbereitet wurde.
Nachdem der
Triebwagen mit Hilfe der
Steuerschalter in
Betrieb genommen wurde, konnte sich der Lokführer den pneumatischen
Bremsen zuwenden. Diese Vorgehensweise war geregelt und unterschied sich
bei den einzelnen
Triebfahrzeugen nicht. Damit wusste der Lokführer, dass
er im Notfall den Triebwagen anhalten konnte. Daher wollen auch wir uns
nun den Bremsen zuwenden. Denn die Inbetriebnahme war mit dem
Verriegelungskasten klar vorgegeben.
Die pneumatischen
Bremsen des
Triebwagens wurden, wie
es der Name schon sagt, mit
Druckluft betrieben. Diese wurde im
Kompressor
erzeugt und in den
Hauptluftbehältern gespeichert. Über die
Apparateleitung konnte diese Druckluft nun von den beiden
Bremssystemen
genutzt werden. Somit führte eine einfache Anschlussleitung zu den beiden
im
Führerstand montierten
Bremsventilen des Triebwagens.
Einfach war der Anschluss bei der direkten
Rangierbremse. Diese stand nun bereit und mit dem
Ventil konnte
Druckluft
in die Leitung gepresst werden. Den Aufbau des Druckes konnte man im
Führerstand anhand eines Manometers ablesen. Dabei war jedoch nur ein
Bremszylinder zu erkennen. Die weiteren im Fahrzeug verteilten
Bremsen
konnte man daher nicht erkennen. Gerade bei der zweiten Hälfte hätte das
zu Problemen führen können.
Damit die
Druckluft auch bei der indirekten
Bremse
genutzt werden konnte, musste der Lokführer das
Führerbremsventil bedienen
und die Zuleitung dazu öffnen. Dabei musste die Reihenfolge der Handlungen
klar eingehalten werden, da es sonst zu schweren Problemen mit grossen
Schäden kommen konnte. Daher lassen wir den
Absperrhahn vorerst noch zu
und beginnen mit der Bedienung des Führerbremsventils der
Bauart
Westinghouse.
Die neueren Lösungen mit
druckregulierten
Führerbremsventilen, wie sie bei den Schwei-zerischen
Bundesbahnen SBB schon sehr erfolgreich verwendet wurden, fanden bei der
BLS keine Freunde. Wurde die Bremse in Betrieb genommen musste der Bediengriff zuerst von der Füllstellung auf die Position «Fahren» verbracht werden. Erst jetzt durfte die Zuleitung geöffnet werden.
Die
Druckluft strömte über das
Ventil in die
Hauptleitung, die sich allmählich
auf fünf
bar füllte. War das Ventil jedoch in der Stellung «Füllen» gab es
keine Druckregelung, so dass die
Bremsen überladen wurden und nicht mehr
funktionierten. Damit wurden allenfalls angezogene pneumatische Bremsen gelöst. Dieser Vorgang war abgeschlossen, wenn die Hauptleitung den Enddruck erreicht hatte und am Manometer die gelöste Bremse des ersten Drehgestelles angezeigt wurde.
Damit war aber nur eine pneumatische
Rückmeldung einer
Achse vorhanden. Rückschlüsse auf die anderen
Bremszylinder und somit auf die anderen Achsen, sowie für die
Anhängelast
gab es deshalb nicht. Mit den bei diesem Ventil benötigten Handlungen, wurde schliesslich die korrekte Funktion der Bremsen geprüft. Diese Kontrolle war vorgeschrieben und musste nach jeder Besetzung des Führerstandes durchgeführt werden.
Nur so war gesichert, dass der
Triebwagen auch sicher
gestoppt werden konnte. Die korrekte Funktion der
Westinghousebremse war
vorhanden, wenn die
Bremsklötze angelegt wurden und wieder gelöst werden
konnten.
Die
Rangierbremse wurde zum Abschluss der
Bremsproben
angezogen und so der
Triebwagen gesichert. Der Triebwagen war nun
fahrbereit und die
Sicherung mit der
Handbremse konnte gelöst werden. Der
Zug konnte nicht davon rollen, da er nun mit der pneumatischen
Bremse
gehalten wurde. Ein völlig gelöstes Fahrzeug gab es daher nie. Die
Handbremse wurde erst gelöst, wenn sich der Lokführer von der korrekten
Funktion der Bremsen überzeugt hatte.
Dazu löste er die Bremsen, stellte die korrekte Fahr-richtung ein und schaltete mit dem Steuerkontroller die erste Fahrstufe zu.
Soweit war das bei sämtlichen
elektrischen Fahr-zeugen der Fall. Die Bedienung unterschied sich daher nicht
gross von anderen Fahrzeugen. Um Zugkraft aufzubauen musste der Steuerkont-roller aus der Mitte im Uhrzeigersinn um eine Position verschoben werden. Damit war die erste Stufe zugeschaltet. Je weiter der Steuerkontroller im Uhrzeigersinn be-wegt wurde, desto höher war die gewählte Fahr-stufe und somit die Zugkraft.
Die Einhaltung der maximalen
Zugkräfte war jedoch
Aufgabe des
Lokomotivpersonals. Eine Begrenzung war lediglich mit den
Relais
vorhanden, die jedoch den
Hauptschalter ausschalteten. Wegen der verwendeten Hüpfersteuerung, konnte man bei diesen Triebwagen nicht von zuschalten sprechen. Der Befehl des Lokführers wurde unver-züglich umgesetzt. Verbrachte man den Steuerkontroller von der Mitte in die Position der Fahrstufe drei, war diese sofort zugeschaltet. Der Lokführer musste daher an den Anzeigen kontrollieren, dass die notwendigen Strö-me an den Fahrmotoren nicht überschritten wurden.
Drehte man den
Steuerkontroller in die entgegengesetzte
Richtung, wurde die
Zugkraft reduziert und beim Erreichen der mittleren
Stellung ausgeschaltet. Die
Hüpfer reagierten daher unverzüglich, so dass
man keine
Trennhüpfer benötigte um die Zugkraft schlagartig abzuschalten.
Die normalen Hüpfer der
Hüpfersteuerung übernahmen diese Aufgabe. So war
eine schnelle und zuverlässig funktionierende Steuerung vorhanden.
Um gefährdete Personen zu warnen, oder um vor
Bahnübergängen das obligate Achtungssignal zu geben, war über dem
Führerstand eine mit
Druckluft betriebene
Pfeife montiert worden. Diese
wurde vom Lokführer mit einem Druckknopf im
Steuerkontroller aktiviert. Je
nach Stärke des Druckes auf den Knopf ergab es einen anderen Klang. Die
bekannten Klangfolgen waren daher von Geschick des Lokführers abhängig.
Verzögert werden konnte der
Triebwagen mit der
pneumatischen
Bremse. Diese Bremse stand in jedem Fall zur Verfügung und
wurde deshalb vor der Fahrt geprüft. Im Betrieb wurde jedoch die
elektrische
Widerstandsbremse des Triebwagens aktiviert. Dazu wurde der
Steuerkontroller einfach aus der Mittelposition gegen den Uhrzeigersinn
verdreht. Die Wendeschalter gruppierten nun die
Fahrmotoren so um, dass
der elektrische Bremsbetrieb möglich wurde.
Die Regelung der
elektrischen
Bremse erfolgte auf die
gleiche Weise, wie die Regelung der
Zugkraft. Das heisst, mit dem
Steuerkontroller konnte die
Bremskraft erhöht oder reduziert werden. Wobei
jetzt in umgekehrter Richtung gearbeitet werden musste. Je weiter man sich
mit der Anzeige des Steuerkontrollers aus der Mitte entfernte, desto
stärker war die Beschleunigung, oder die Verzögerung des
Triebwagens.
Jedoch war mit der
elektrischen
Bremse keine Bremsung
bis zum Stillstand möglich, so dass die elektrische Bremse vor dem Halt
abgeschaltet werden musste. Der Zug konnte nun mit der pneumatischen
Bremse angehalten werden. Dazu benutzte der Lokführer beide Hände und
konnte die pneumatische Bremse parallel zur elektrischen Bremse bedienen.
Die Verzögerung blieb somit in etwa im gleichen Rahmen.
Die Türe wurde, sofern vom Lokführer eine Freigabe
erfolgt war, durch die Steuerung mit Hilfe von
Druckluft geöffnet. Die
geöffneten Türen blieben jedoch offen, so dass nicht jeder Reisende den
Schalter betätigen musste. War die Abfahrzeit erreicht, wurde der Zug durch den Zugführer abgefertigt. Das konnte mit einem an der Seite vorhandenen Schalter erfolgen. Damit konnte der Zugführer dem Lokführer ein Signal übermitteln.
Dieses Signal war die
Zustimmung zur Abfahrt und galt daher als
Abfahrer-laubnis. Diese Lösung
erleichterte den Vorgang bei der Abfahrt eines Zuges in engen
Kurven und
wurde vom Personal häufig genutzt. Nach einer Wartezeit schloss der Lokführer mit einem elektrischen Signal die Türen. Dazu wurde ein Befehl zur Türe gesandt und die pneumatische Regel-ung dazu bewegt, den Schliesszylinder mit Druckluft zu versorgen.
Die Türen wurden nun geschlossen und konnten nur gegen die
Kraft der
Druckluft geöffnet werden. Eine Überwachung in Form eines
Einklemm-schutzes gab es jedoch nicht, die Türe wurde einfach zugeknallt.
Die weiteren Handlungen des Lokführers wiederholten
sich nun. Eine im
Triebwagen eingebaute
Lautsprecheranlage erlaubte dem
Zugführer die Ansage des nächsten Haltes. Die Anlage besass daneben jedoch
auch ein Abspielgerät. So konnten die Reisenden auch mit Musik berieselt
werden. Gerade bei den Ausflügen nach Stresa, war diese Form der
Unterhaltung beliebt. Im
Regionalverkehr wurde jedoch eher das Mikrophon
benutzt.
Bleibt eigentlich nur noch die Ankunft in einem
Depot.
Um den
Triebwagen auszuschalten, wurden die bei der Einschaltung erwähnten
Handlungen in umgekehrter Richtung ausgeführt. Natürlich war es jetzt
nicht mehr nötig, die Funktion der pneumatischen
Bremsen zu prüfen, denn
die Fahrt war beendet und der Triebwagen in einem Nachtlager. Jedoch
konnte es nun auch in den Unterhalt gehen, wo Veränderungen vorgenommen
wurden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Bevor die eigentliche Inbetriebnahme beginnen konnte,
musste der
Bevor die eigentliche Inbetriebnahme beginnen konnte,
musste der
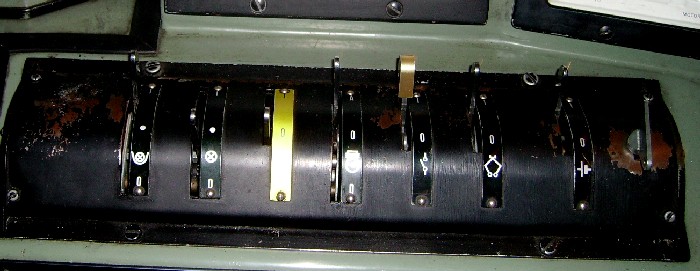 Wie bei den zuvor abgelieferten
Wie bei den zuvor abgelieferten
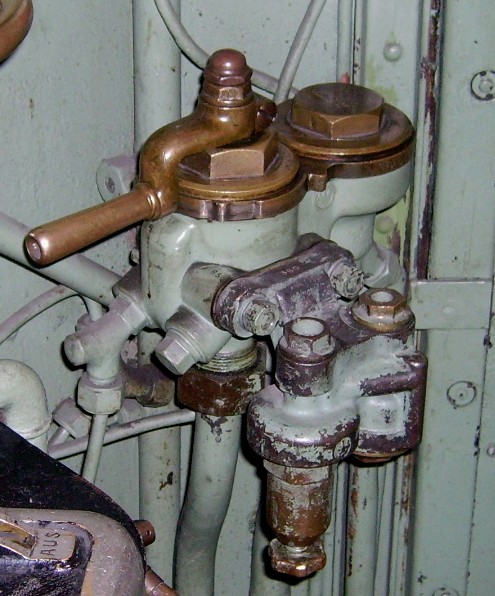 Beim
Beim
 Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt
erfüllt und der Lokführer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten
hatte, den
Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt
erfüllt und der Lokführer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten
hatte, den
 Mit der Wahl der entsprechenden
Mit der Wahl der entsprechenden
 Gehen wir davon aus, der der
Gehen wir davon aus, der der