|
Neben- und Hilfsbetriebe |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Wenn wir mit den Nebenbetrieben des
Triebwagens
beginnen, müssen wir wieder zum
Transformator
zurückkehren. Dabei interessiert uns wieder die
Primärwicklung.
Diese hatte eine einfache
Anzapfung
bekommen. In der
Spule
wurde diese so positioniert, dass eine
Spannung
von 1000
Volt
abgegriffen werden konnte. Die
Wechselspannung
hatte zudem die von der
Fahrleitung
stammende
Frequenz
von 16 2/3 Hz behalten.
Die Schaltung der Nebenbetriebe erfolgte daher wie bisher gegen
die Erde und so war die
Zugsammelschiene
mit der bisherigen
Heizleitung
kombinierbar. Der neue Begriff war die Folge der Lüftung in den Abteilen
und so vom Dauerbetrieb. Geschaltet wurde diese Zugsammelschiene mit einem üb-lichen Heizhüpfer. Diese war als normaler Schalter konzi-piert und wurde mit den üblichen Messeinrichtungen ergänzt.
Diese bestand dabei lediglich aus einem
Relais,
das den maximal erlaubten
Strom überwachte. Stieg der Strom in der
Zugsammelschiene
auf einen Wert von mehr als 400
Ampère,
löste das Relais aus und der
Hauptschalter
wurde sofort ausgeschaltet.
Nun teilte sich die Leitung. Eine davon wurde zu den
Fahrgasträumen
geführt. Dort waren die Heizregister und die
Lüfter
angeschlossen worden. Gerade diese Lüfter waren der Grund für die Änderung
der Bezeichnung, denn diese liefen dauernd. Diese bezogen in der Stunde
über die
Lüftungsgitter
rund 2 700 m3 Luft. Und
bliesen diese in die Abteile. Der Luftaustausch im Abteil wurde daher mit
dem 60zigfachen Wert ausgeführt.
So erfolgte im Sommer eine merkliche Abkühlung der Bereiche. Im
Winter, wurden die Heizregister zugeschaltet und so die Frischluft, bevor
sie in die Abteile gelangen konnte, zusätzlich erwärmt. Der
Triebwagen
RBDe 4/4 hatte damit eine zeitgemässe Versorgung der
Fahrgasträume
erhalten. Der Verzicht auf eine
Klimaanlage
wirkte sich daher nicht so stark aus, wie man meinen könnte. Damit können
wir zur anderen Leitung wechseln.
Auf der Seite mit dem
Personenübergang
wurde zusätzlich auf der linken Seite ein übliches
Heizkabel
montiert.
So war die
Front
frei von diesem Kabel. Damit im Notfall die
Zugsammelschiene
auch ab einer allfälligen
Hilfslokomotive
versorgt werden konnte, war im
Gepäckraum
ein
Hilfsheizkabel
vorhanden. Zur Sicher-heit musste nun aber verhindert werden, dass sich
der Heizhüpfer des
Triebwagens
schliessen konnte. Genau diese Schaltung wurde auch verwendet, wenn der
Pendelzug
ab einer stationären
Vorheizanlage
versorgt wurde. Zum Abschluss der Nebenbetriebe kann gesagt werden, dass diese mit Ausnahme der Bezeichnung gegenüber anderen Fahrzeugen keine Änderung erhalten hatte. Es war daher kein Problem, diesem Triebwagen auch Personenwagen aus dem vorhandenen Bestand einzureihen.
Dies wurde im Betrieb des Fahrzeuges oft vorgenommen, wenn
Verstärkungswagen mitgeführt wurden. Damit musste einfach beachtet werden,
dass die
Zugsammelschiene
immer eingeschaltet wurde.
Nicht einschalten musste man hingegen die
Hilfsbetriebe.
Diese standen automatisch zur Verfügung, wenn der
Triebwagen
eingeschaltet wurde und in der
Fahrleitung
Spannung
vorhanden war. Für die Versorgung wählte man bei den Hilfsbetrieben eine
eigene
Wicklung
und diese wurde nicht mehr, wie bisher ohne
Anzapfung
ausgeführt. Neu waren in der
Sekundärspule
zwei Anzapfungen vorhanden, die es daher erlaubten die Hilfsbetriebe mit
unterschiedlichen Spannungen zu versorgen.
Daher wurde auf diese Einrichtung verzichtet und für die Testläufe
musste der
Triebwagen
eingeschaltet werden. Ein Umstand, der hier jedoch keine zu grossen
Probleme bereiten sollte. Dadurch können wir die Hilfsbetriebe nicht mehr so ein-fach betrachten, denn wir müssen nun die einzelnen Spannungsbereiche und die dort angeschlossenen Ver-braucher unterscheiden. Dabei beginne ich die Betrach-tung mit der höchsten vorhandenen Spannung.
Der Grund dafür ist, dass daran die meisten Verbraucher
angeschlossen wurden. Die
Spannung
lag hier bei 400
Volt,
so dass mehr
Leistung
bei vergleichbarem Gewicht mög-lich wurde.
Bei dieser
Spannung
wurde erneut eine Aufteilung vorgenommen. Dabei gab es Bereiche mit, oder
ohne Regelung. Bauteile ohne Regelung wurden direkt an der
Spule
angeschlossen und liefen mit einer festen Spannung. Dazu gehörten
lediglich die Motoren zu den beiden
Ölpumpen.
Diese wälzten die
Kühlmittel
von
Transformator,
beziehungsweise
Stromrichter
um. Daher müssen wir uns mit deren
Kühlung
nun befassen.
Gekühlt wurden der
Transformator,
aber auch der
Stromrichter
mit
Transformatoröl.
Dieses
Öl
war nicht mit dem umweltschädlichen
PCB
durchsetzt worden und es hatte gute Eigenschaften. Im Bereich der
Spulen
und Halbleiter wurde das
Kühlmittel
durch deren Belastung erwärmt. Die
Ölpumpen
hatten dabei lediglich die Aufgabe, dieses Kühlmittel in Bewegung zu
halten und es so den Ölkühlern zuzuführen. Dort erfolgte schliesslich die
Abkühlung mit Hilfe der
Ventilation.
Wenn wir bisher beim
Transformatoröl
von der
Kühlung
gesprochen haben, muss erwähnt werden, dass dieses zudem die
Isolation
verbesserte.
Dieser Umstand wurde zum Beispiel bei den
Glättungsdrosseln und bei den Kommutierungsdrosseln genutzt. Diese
gehörten zu den
Fahrmotoren,
wurden aber zur besseren Kühlung im Gehäuse des
Transformators
eingebaut. Damit musste dort für eine ausreichende Isolation zur
Hochspannung gesorgt werden.
Das war jedoch mit dem normalen
Wechselstrom
schlicht nicht möglich. Daher wurden die
Ventilatoren
über einen
Stromrichter
angeschlossen. Dieser
Hilfsbetrie-bestromrichter
erlaubte eine regulierbare Spannung. Diese Lösung für die Ventilatoren ermöglichte eine neuartige bedarfsabhängige Ventilation. So konnte dank des Wellenstroms, die Leistung der Lüftung ähnlich der Fahrmotoren reguliert werden. Damit sollte bei den Hilfsbetrieben Energie gespart werden.
Nebeneffekt war, dass die Lüftung etwas leiser arbeitete, als die
bisherigen Lös-ungen. Daher konnte man auch auf die sonst übliche
Depotsteckdose verzichten, denn die Regelung war von der Geschwindigkeit
unabhängig. Um den Bedarf bei der Ventilation zu bestimmen, wurde bei den zu kühlenden Bau-teilen Messsonden eingebaut. Stellte eine dieser Sonden einen erhöhten Wert fest, wurde über die Steuerung der Stromrichter so angesteuert, dass mehr Kühlluft zugeführt wurden.
Die
Kühlung
wurde damit verbessert und das Bauteil optimal auf Temperatur ge-halten.
Fiel die Temperatur unter den eingestellten Wert, wurde die Kühlung
wie-der abgeschwächt. Da man davon ausging, dass der stehende Triebwagen keine Leistung bezog und daher kein Anstieg bei den Temperaturen zu erwarten war, wurde auf die Möglich-keit, die Ventilation im Stillstand abzustellen, verzichtet.
Die
Ventilatoren
liefen dabei einfach auf der schwächsten Stufe. War jedoch der Bedarf
vorhanden, konnte auch im Stillstand die volle
Leistung
abgerufen werden. Ein Umstand, der dem Schutz des Fahrzeuges diente.
Insgesamt waren drei
Ventilatoren
vorhanden. Dabei war je einer für ein
Drehge-stell
verantwortlich. Dabei wurde die angesaugte und gereinigte Luft durch
Kanäle zu den
Fahrmotoren
geführt. Dort strömte sie durch die
Wicklungen,
kühlte und reinigte diese dabei. Anschliessend wurde diese erwärmte Luft
unter dem Fahrzeug wieder an die Umwelt abgegeben. Ein Aufbau, den von den
vorhandenen
Triebfahrzeugen
übernommen wurde.
Der dritte
Ventilator war für die Ölkühler bestimmt.
Dabei bezog auch er die Luft durch die
Lüftungsgitter
und presste diese durch die
Kühler
wieder ins Freie. Dank der Reinigung dieser Luft, verschmutzten die
Lamellen des Kühlers nicht so stark. Das war für eine optimale Rückkühlung
des sich sowohl im
Transformator,
als auch im
Stromrichter
befindliche
Transformatoröls.
Nur so konnte diese optimierte Ventilation auch korrekt arbeiten.
Zudem benötigte man diese
Spannung
für die
Heizungen
und Steckdosen im
Führerstand.
Selbst die
Fensterheizung
wurde hier angeschlossen. Daher war es nur logisch, dass man zu besser
Verteilung der Belastungen den
Kompressor
hier anschloss. Diese Lösung führt beim Verhalten des Triebwagens zu einem deutlichen Unterschied zum Modell der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB. Dort wurde der Kompressor ebenfalls am Hilfs-betriebestromrichter angeschlossen.
In der Folge stieg die
Leistung
der
Ventilation
an, wenn der
Kom-pressor
arbeitete. Das war deutlich zu hören. Dieser Effekt war hier jedoch nicht
zu beobachten, da der Kompressor mit
Wech-selstrom
betrieben wurde. Angeschlossen wurde der Kompressor mit einem einfachen Schütz. Diese Lösung erlaubte es, den Kompressor auch einzu-schalten, wenn keine ausreichende Menge Druckluft vorhanden war.
Um den
Stromabnehmer
in diesem Fall zu heben und den
Haupt-schalter
einzuschalten, war ein
Hilfsluftkompressor,
der ab der
Spannung
der Steuerung betrieben wurde, vorhanden. War das Fahrzeug eingeschaltet,
arbeitete der
Kompressor
normal.
Die Steckdosen und Heizkörper im
Führerraum
wurden auch hier eingebaut, da der Bereich des Lokführers andere
Bedingungen besass, als die Abteile für die Reisenden. Das galt auch für
die
Heizung der
Frontscheiben.
Diese musste in der kalten Jahreszeit und bei Fahrten durch lange
Tunnel
eingeschaltet werden. Durch die Wahl der
Spannung
konnten in diesem Bereich auch Bauteile von anderen Baureihen verwendet
werden.
Daher waren an diesem Bereich der
Spannung
keine wei-teren Verbraucher angeschlossen worden. Was jedoch nicht
bedeutet, dass wir die
Hilfsbetriebe
des
Triebwagens
bereits abschliessen können, denn noch fehlte die
Batte-rieladung. Das für diesen Zweck benötigte Batterieladegerät war bis-her ein sehr schweres an den Hilfsbetrieben angeschlos-senes Gerät. Damit man hier Gewicht einsparen konnte, wurde für die Batterieladung eine eigene Anzapfung vorgesehen.
Diese hatte bereits eine geringere
Spannung,
so dass auf die Transformation verzichtet werden konnte. Das be-deutete
unweigerlich, dass das Bauteil deutlich leichter wurde und dabei erst noch
mehr
Leistung
vorhanden war. Man konnte so zwar viel Gewicht einsparen, erkaufte sich die Einsparung jedoch bei einem speziellen Bauteil, das als Ersatz vorhanden sein musste.
Da aber solche Geräte nur selten ausfielen, war der Nach-teil
gering. Doch gerade die Ladung der
Batterien
zeigte, dass im elektrischen Teil sehr viel Gewicht eingespart werden
musste. Daher lohnt es sich sicherlich, wenn wir das Fahrzeug erneut auf
die Waage stellen.
Mit den Betriebsstoffen erreichte der
Triebwagen
ein Leergewicht von 70 Tonnen. War er voll besetzt und das
Gepäckabteil
gut ausgelastet, wurde ein Gewicht von nahezu 80 Tonnen erreicht. Damit
war das Fahrzeug nicht besonders leicht ausgefallen. Jedoch konnte die
maximal zugelassene
Achslast
von 20 Tonnen eingehalten werden. Benötigt wurden daher Strecken mit der
Klasse C. Das war jedoch kein Problem, da mittlerweile die meisten diese
Bedingung erfüllten.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
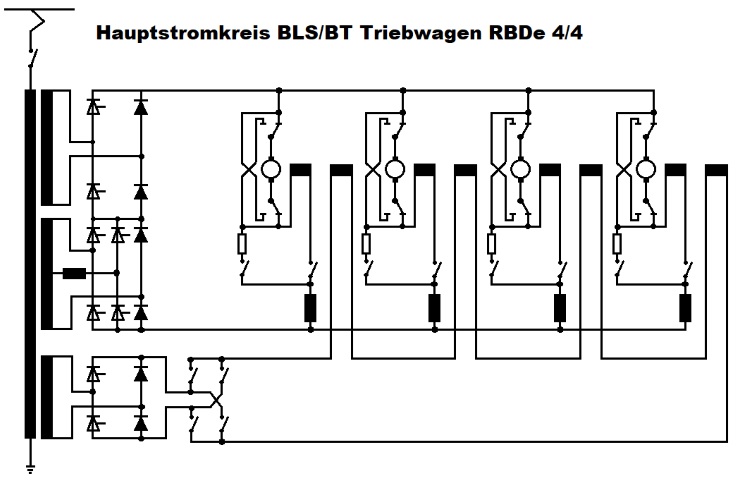 Die
Leitung, die an dieser
Die
Leitung, die an dieser  Mit
der zweiten Leitung ab dem Heizhüpfer, wurde die
Mit
der zweiten Leitung ab dem Heizhüpfer, wurde die 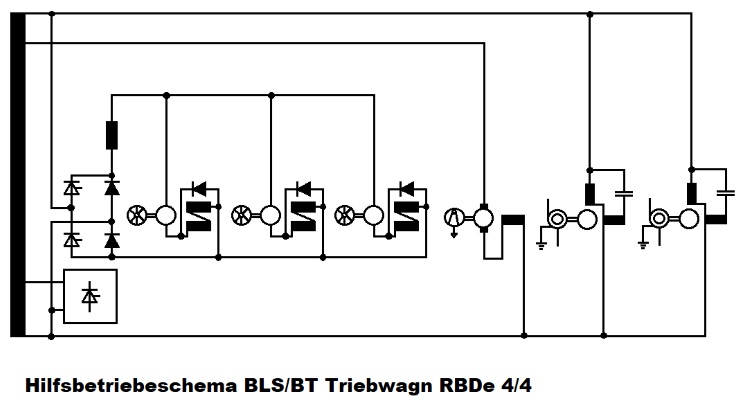 Der
Vorteil hier war, dass die Bauteile mit angepassten
Der
Vorteil hier war, dass die Bauteile mit angepassten 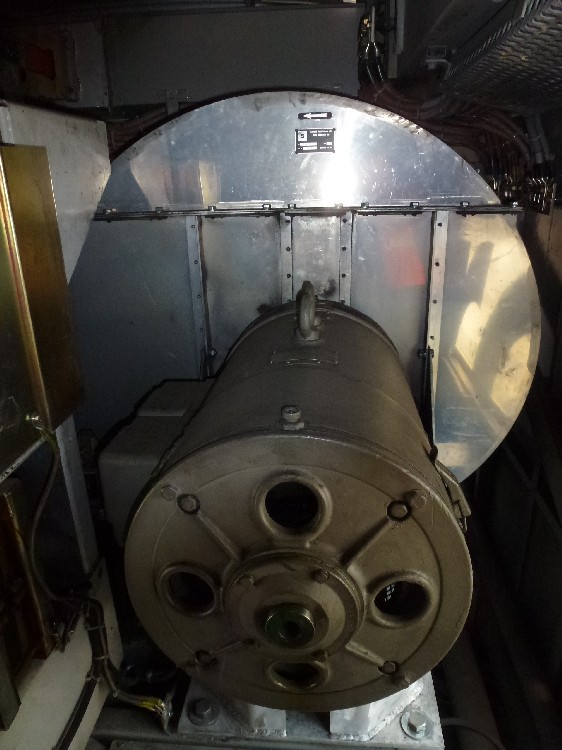 Der
zweite Bereich dieser
Der
zweite Bereich dieser
 Mit
einer auf 230
Mit
einer auf 230
 Die
bisher an den
Die
bisher an den