|
Änderungen und Umbauten |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Obwohl die
Triebwagen
sehr lange im Einsatz standen, so gut war deren Start gar nicht. Sie
mussten daher schnell verbessert werden. Ein Vorgang, der sich natürlich
oft über Jahre hinwegziehen konnte. Trotz der Probleme, kann aber gesagt
werden, dass es keinen grundsätzlichen Umbau des ganzen Fahrzeuges gab. Es
wurde zwar an allen Ecken verbessert und verändert, aber einen Umbau im
herkömmlichen Sinn werden wir nicht finden.
Die harten Holzbänke verschwanden somit und es kamen neu im Sommer
sehr heisse Sitze zum Einbau. Namen, wie Eier-kocher, zeugen von
unangenehmen Verhältnissen für die Reis-enden. Viele hätten wohl gerne die
alten Bänke gewünscht.
Damit waren die ersten
Triebwagen
betroffen, denn bei den letzten Modellen wurden diese Sitz schon während
dem Bau verbaut. Es war hier jedoch eine Anpassung, die wegen den neusten
Leichtstahlwagen
erfolgte. Dort hatten die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschlossen,
dass auch die dritte
Wagenklasse
über Polster verfügen sollte. Aus diesem Grund wurden die älteren Wagen
und die Triebwagen ebenfalls damit ausgerüstet.
Gleich bei den ersten Inbetriebnahmen der
Triebwagen
zeigte sich, dass das Anfahren infolge der groben Abstufungen der
einzelnen
Fahrstufen
sehr ruppig vor sich ging und dass das pulsierende
Drehmoment
der
Fahrmotoren
über die in Drehrichtung starren
Antriebe
starke Vibrationen im Kasten bewirkte. Hinzu kam, dass dieser Effekt durch
die schnelle Schaltfolge der
Hüpfersteuerung
verstärkt wurde.
Neben dem mangelnden
Fahrkomfort
für die Fahrgäste waren auch Schäden an den
Antrieben
zu befürchten. Oft hörte man, dass diese
Triebwagen
deutlich schlechter seien, als die alten Modelle mit den sehr geringen
Anzahl Stufen. Mehr Sorgen machte sich jedoch das Personal, denn solche
Vibrationen konnten sich doch nur negativ auf die Konstruktion auswirken.
Schwere Schäden wurden befürchtet, daher musste eine Verbesserung her.
Da sich die
Anzapfungen
des
Transformators
nicht mehr ändern liessen, wurde zur zusätzlichen Dämpfung der
Stufensprünge ein
Widerstand
zwischen
Hüpfer
und
Fahrmotoren
eingebaut. Die bisherigen
Überschaltdrosselspulen
wurden dabei teilweise durch diese Widerstände ersetzt. Daher sprach man
in dieser Beziehung auch von den
Überschaltwiderständen.
Die ohmschen Effekte waren dabei dynamischer, als die Induktiven Lösungen
der ursprünglichen Konstruktion.
Zur Verhinderung der Übertragung der Vibrationen des
Fahrmotors
erhielten die grossen
Zahnräder
der
Antriebe
eine zusätzliche
Federung.
So war das Fahrzeug bereits kurz nach Ablieferung optimiert worden und
genügte nun den Anforderungen. Zwar waren immer noch leichte Vibrationen
zu spüren. Diese waren aber längsten kein Problem mehr. Ich muss erwähnen,
dass
Triebwagen
immer etwas unruhiger waren, als Wagen.
Reihte man einen
Leichtstahlwagen
in den Zug passten die Kabel nicht und da-her gab es auch keine
Vielfachsteuerung. Somit war der Entscheid diese Lös-ung
einzubauen schlicht falsch. Das Debakel
Ae 4/6 sass bei den
Staatsbahnen
wirklich in den Gliedern. Kurz nach dem Bau der ersten Triebwagen wurde das Vielfachsteuersystem vom Typ Vst I auf den neuen bei der Lokomotive Re 4/4 eingeführten Typ III umgestellt.
Das bedeutete, dass die bereits eingesetzten Fahrzeuge umgebaut
werden mussten. Die noch nicht gebauten oder ausgelieferten Modelle wurden
daher bereits im Werk auf diesen Typ umgebaut. Es gab daher
Triebwagen,
die nie über das System I aus der Beschreibung verfügten. Jetzt war eine freizügige Kombination mit den neuen Leichtstahlwagen möglich. Damit konnten auch längere Pendelzüge problemlos gebildet werden. Jedoch gab es nun ein betriebliches Problem. Denn
es wäre eine Kombination mit der
Lokomotive
Re 4/4
leicht möglich gewesen. Damit nicht aus Versehen, die zwei
unterschiedlichen Typen kombiniert werden konnten. Bezeichnete man das
System der
Triebwagen
einfach als Typ
Vst IIIb.
Auch die
Widerstandsbremse
der
Triebwagen
war nicht mit der Lösung der
Re 4/4
kompatibel. Neuste Erkenntnisse ergaben zudem, dass die
Rekuperationsbremsen
auch auf den
Nebenstrecken
problemlos eingesetzt werden konnten. Die Ursache für die Probleme bei den
ersten Lösungen lagen nicht am Verkehr der Strecken, sondern an den
Kraftwerken,
die ebenfalls eine Rekuperation zulassen mussten. Der Triebwagen wurde
jedoch nie umgebaut.
Da nun aber das Muster aus den
Einheitswagen
genommen wurde, sollten diese
Steuerwagen
ein geändertes Aussehen bekommen. Damit das ging, war eine Umstellung der
Systeme vorhanden.
Die
Drehgestelle der
Triebwagen
waren auch nicht optimal geraten. Sorge bereitete den Unterhaltsdiensten
die sehr grosse Abnützung der
Spurkränze.
Diese erforderten einen erhöhten Unterhalt für den Triebwagen, was
unnötige Kosten verursachte. Zudem stimmten mit der Abnützung auch die
Winkel nicht mehr. Der Triebwagen drohte daher immer wieder zu entgleisen
und musste in der Folge repariert werden. Vorerst verkehrte er daher nach
der
Zugreihe A.
Mit dem Einbau einer wirksamen
Spurkranzschmierung
begegnete man diesem Problem aber und der
Triebwagen
hatte eine weitaus geringere Abnützung der
Spurkränze
erhalten. Zudem wurden damit auch die Kräfte im
Gleis
reduziert. Das führte dazu, dass der Triebwagen nun auch nach der
Zugreihe R
verkehren konnte. Wegen der
Höchstgeschwindigkeit
von 110 km/h konnte keine Umbezeichnung erfolgen.
Die Mängel der ersten Stunde waren damit jedoch behoben. Man kann
diese schon fast als Garantiearbeiten bezeichnen, denn viele Mängel waren
schon sehr schnell aufgetreten und stellten den Erbauern, aber auch der
Besteller kein gutes Zeugnis aus. Dabei darf man nicht darüber
hinwegsehen, dass erstmals ein solches Fahrzeug für die Schweizerischen
Bundesbahnen SBB gebaut wurde und man daher keinerlei Erfahrung hatte.
Die, wie bei der Lokomotive
Re 4/4,
an den
Drehgestellen montierten
Bahnräumer
bewährten sich vor allem im Winter nicht. Dabei sammelte sich hinter dem
Bahnräumer aufgewirbelter Schnee. Durch die Kräfte presste sich dieser zu
Eisbrocken zusammen. Dies wiederum führte dazu, dass das
Bremsgestänge
nur noch schwer gängig war. Wurde gebremst, war die Wirkung schlecht und
der Druck musste erhöht werden. Nun brach das Eis weg und fiel ins
Gleis.
Sie wirkten dabei sehr wuchtig und mussten sogar beim Einstieg
angepasst werden. Das Bild des sonst gelungenen
Triebwagens
wurde damit nicht verbes-sert. Im Gegenteil die neuen Modelle passten
nicht so recht zum Fahrzeug. Es zeigte sich in der Folge aber, dass einfachere Bahnräumer, die am Kasten montiert werden, auch Verbesserungen bewirkten. In der Folge kamen nur noch Modelle ohne die seitliche Verschalung zur Anwendung.
Zwar bildete sich auch hinter diesen die Eisklumpen. Jedoch wurden
diese durch die Bewegungen des
Drehgestells sehr früh gelockert. Es
fiel immer noch Eis vom
Triebwagen,
jedoch wesentlich kleinere Brocken.
Ab dem Jahr 1958 wurden diverse Umbauten bei den
Antrieben
vorgenommen. Diese Umbauten waren aber nicht die Folge von schweren
Fehlern, sondern sollten die uneinheitliche
Bauart
ausmerzen. Dabei funktionierten die Lamellenantriebe von der SAAS etwas
besser, so dass die mit Scheibenantrieb ausgerüsteten Fahrzeuge, neue
Modelle nach dem Baumuster der SAAS erhalten haben. In der Folge hatten
alle
Triebwagen
den gleichen Antrieb.
Ähnlich war es auch bei den
Drehgestellen selber. Die von
SWP gebauten Drehgestelle wurden den üblichen Drehgestellen angepasst.
Dadurch konnte der Unterhalt vereinfacht und vergünstigt werden. Die
Drehgestelle der
Triebwagen
konnten bei Bedarf auch ausgetauscht werden, was die Vorhaltung von
Ersatzteilen vereinfachte. So entstand ein einheitlicher Park Triebwagen.
Diese Massnahme vereinfachte den Unterhalt.
Nach einer Übergangsphase wurden die
Triebwagen
letztlich als BDe 4/4 geführt. Die Aktion mit dem Pinsel beschränkte sich
nun jedoch nicht mehr nur auf die Bezeichnung und die Nummer. Diesmal
wurden auch die Bahnanschriften verändert. An den Seiten sollten nur noch
zwei Sprachen berücksichtigt werden. Dabei wurde wirklich nur die
italienische Version gestrichen. Das sollte sich jedoch später rächen, als
das Tessin wieder berücksichtigt wurde.
Die Änderung beinhaltete den Wechsel des Ventils in den Führerständen und das Entfernen der beiden Schlauch-paare an den Stossbalken.
Das
Bremsventil
wurde durch das ein-facher zu bedienende Modell aus dem Hause Oerlikon
Bremsen ersetzt. In der Folge konnte nur noch der
Trieb-wagen
damit gebremst werden. Die Massnahme verstand nicht das ge-samte Personal, war die Regulier-bremse bei Vielfachsteuerungen von grossem Vorteil gewesen.
Gerade die Tatsache, dass diese Leitungen bei den neu entstehenden
Lokomotiven der Baureihe
Re 4/4 II wieder vorhanden waren, verblüffte viele
Fachleute. Jedoch sollten
Triebwagen
diese Leitung nie mehr erhalten, da sie in erster Linie in
Pendelzügen
verkehrten und dort der Verzicht nicht so auffiel.
Bei den Gittern waren die eingebauten
Filtermatten
kaum wirksam. Das wirkte sich verheerend auf die
Ventilatoren
aus. Schob der
Triebwagen
einen Zug, lief er in einer Wolke aus aufgewirbeltem Staub. Dieser
gelangte in die Kanäle und setzte sich dort fest. Bei Regen und
insbesondere im Winter drang zudem viel Feuchtigkeit in die Kanäle. Das
verklebte den Staub zusätzlich und sorgte in den
Fahrmotoren
hin und wieder für einen lauten Knall.
Um den Verunreinigungen der Luftkanäle zu den
Ventilatoren
im
Triebwagen
zu begegnen, wurden ab 1962 die Öffnungen durch neue bessere Düsengitter
ersetzt. Dadurch drang deutlich weniger Feuchtigkeit und Schmutz in die
Kanäle. Die blieben in der Folge sauber, der Weg war frei und die Motoren
freuten sich über die trockene Luft. Die Probleme mit Schäden an den
Motoren konnten so schnell eingedämmt werden.
Dadurch verlängerte sich der entsprechende Aufbau und der Platz
für den nie montierten zweiten
Strom-abnehmer
wurde auch für die
Widerstände
benötigt. Eine leicht bessere Bremswirkung war damit auch zu erzielen,
auch wenn diese nicht so wichtig war. Ebenfalls umgebaut wurde die Batterieladung. Anstelle der bisherigen Umformergruppe wurde ein statisches Batterieladegerät eingebaut. Dieses Ladegerät hatte den Vorteil, dass es keine Vibrationen mehr erzeugte und viel leiser arbeitete, als die Umformergruppe.
Man konnte so auf die aufwändige Montage mit
Silentblöcken
verzichten. Gerade bei einem
Trieb-wagen
war das von besonderem Vorteil und verbesserte den Komfort leicht.
Um den Reisenden verbesserte
Leistungen
zu bieten und um die Sicherheit zu verbessern, wurden die
Triebwagen
mit einer verbesserten ferngesteuerten Türschliessung und einer
Lautsprecheranlage
versehen. Während der Lokführer die Türschliessung nun alleine nur anhand
einer optischen Kontrolle durchführen konnte, wurden die Durchsagen durch
den
Zugführer
ausgeführt. Neu war auch die Abfertigung mit an den Wagen montierten
Schaltern.
Die Türen wurden mit einem
Einklemmschutz
versehen. So konnte verhindert werden, dass ein Schliessbefehl vom
Führerstand
aus für einen Reisenden gefährlich werden konnte. Auch das Gepäcktor war
neu in der Türsteuerung enthalten und ein Schliessbefehl schloss das Tor
automatisch. Damit der Lokführer die Türen auch besser beobachten konnte,
wurden bei einigen
Triebwagen
beidseitig
Rückspiegel
montiert.
Bedient wurde die
Lautsprecheranlage
bei den meisten
Triebwagen
durch den
Zugführer
im
Gepäckabteil.
Jedoch wurden die Nummern 1622 bis 1624, 1629 und 1629 sowie die Nummer
1651 mit Mikrofonen in den
Führerständen
versehen. So konnten diese Triebwagen ab 1980 für den einmännigen Betrieb
auf den Strecken Vevey – Puidoux, Olten – Läufelfingen – Sissach und
Vallorbe – Le Brassus eingesetzt werden.
Bei den
Triebwagen,
die für die extrem steile Strecke Vevey – Puidoux verwendet wurden, wurde
zudem noch eine weitere Einrichtung eingebaut. Diese leitete beim
überschreiten einer Geschwindigkeit von 70 km/h automatisch eine
Schnellbremsung
ein. Dadurch konnte verhindert werden, dass der Triebwagen schneller auf
dieser Strecke verkehren konnte. Der
Überdrehzahlschutz
wurde jedoch nicht angepasst, so dass dieser immer noch 121 km/h
überwachte.
Da diese Einrichtung aber auch auf anderen Strecken aktiviert war,
durften diese
Triebwagen
nur noch mit 70 km/h verkehren. Um wieder mit 110 km/h zu fahren, musste
die Einrichtung ausgeschaltet werden. Dabei sollte jedoch vor einem
Einsatz auf dieser Strecke wieder daran gedacht werden, dass die
Einrichtung aktiviert werden musste. Jedoch war das selten der Fall und
die Triebwagen tuckerten mit 70 km/h in den Unterhalt.
Ein immer wieder von den Lokführern beanstandeter Mangel war die
Zugluft im
Führerstand,
die bei den Stirntüren auftrat. Diese war bei allen
Triebwagen
und
Lokomotiven mit Fronttüren ein Problem. Im Rahmen
der
R3
wurde deshalb die Türe auf der Seite
Gepäckraum
verschlossen. Diese verschlossenen Türen waren nur an den Triebwagen
1621, 1623, 1629
und 1631 ausgeführt worden. Diese Massnahme, die 1988 eingeführt wurde,
erreichte daher nicht mehr alle Triebwagen.
Gegen Ende des Einsatzes wurden die
Triebwagen
noch in untergeordneten Diensten eingesetzt. Dazu gehörten die
Personaltransporte. Da dort jedoch nicht mehr alle Sitz benötigt wurden,
gab es einen Stellplatz für Kisten. Das
Gepäckabteil
wurde daher nicht mehr genutzt. Ein Umstand, der aber dem Betrieb
geschuldet wurde, denn die Triebwagen waren damit auf dem letzten Einsatz
und wurden nicht mehr verbessert.
Eine Ausnahme soll zum Schluss noch schnell erklärt werden. Die
Nummer 1646 wurde zur Beförderung des Schulzuges umgestaltet. Der
Triebwagen
erhielt dabei eine geänderte Bestuhlung und an der Stelle einer Türe wurde
eine
Klimaanlage
eingebaut. Damit sollte dieses Fahrzeug der einzige Triebwagen der
Baureihe BDe 4/4 sein, der je ein klimatisiertes
Personenabteil
bekommen hatte. Doch dazu mehr im Betriebseinsatz.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
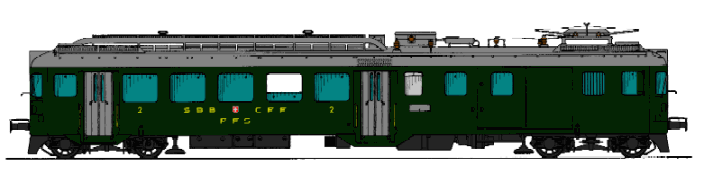 Schnell
erfolgten die ersten Verbesserungen bei den Sitzplätzen und dabei bei den
Fahrgästen. Die Plätze in der dritten
Schnell
erfolgten die ersten Verbesserungen bei den Sitzplätzen und dabei bei den
Fahrgästen. Die Plätze in der dritten
 Probleme
gab es auch mit der
Probleme
gab es auch mit der
 Da
nicht für alle
Da
nicht für alle
 Um
hier eine Verbesserung zu erzielen, wurde der
Um
hier eine Verbesserung zu erzielen, wurde der
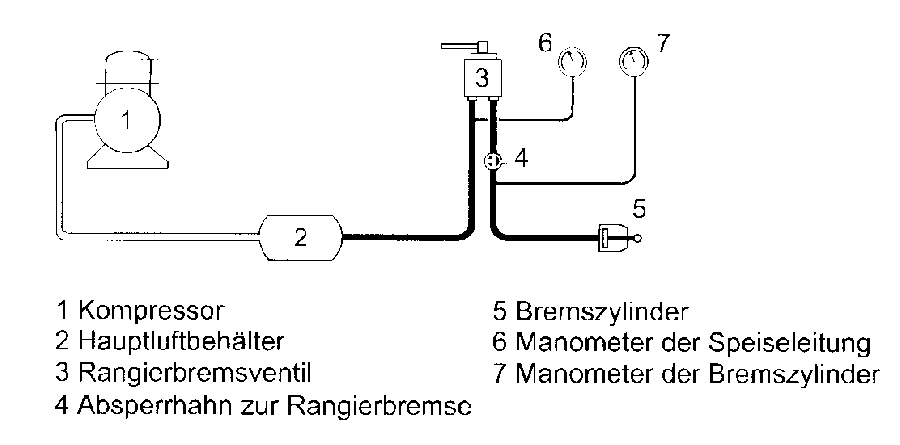 1962
wurde, wie bei den anderen Fahrzeugen, auch hier die
1962
wurde, wie bei den anderen Fahrzeugen, auch hier die  Im
elektrischen Teil des
Im
elektrischen Teil des