|
Bedienung des Triebzuges |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bedient wurde der Zug von zwei grundlegend
unterschiedlichen Personen. Dazu gehörte der Lokomotivführer, der dazu
verantwortlich war, dass sich der
Triebzug in Bewegung setzte. Es war
seine Aufgabe den Zug in Betrieb zu nehmen, diesen während der Fahrt zu
bedienen und nach der Fahrt den Triebzug auch wieder abzustellen.
Allfällige Störungen behandelte er mit Hilfe der Diagnose und allenfalls
mit Hilfe einer Hotline.
Dazu gehörte
zum Beispiel die Bedienung der Anzeigen und die Regelung der klimatischen
Verhältnisse im einzelnen Wa-gen. Allfällige Störungen an diesen
Einrichtungen behob er autonom. Theoretisch war es dem Lokführer möglich, den Zug auch ohne das Zugpersonal zu bedienen. Jedoch war das nicht vorgesehen, so dass der Triebzug im planmässigen Einsatz nicht im kondukteurlosen Betrieb verkehren sollte. Da wir dies auch bei der Beschreibung tun wollen, be-trachten wir
die Bedienung des «Giruno» von beiden Beru-fen aus. Beginnen werden wir
dabei mit dem Lokomotiv-führer, der in den meisten Fällen als erster auf
dem abge-stellten Zug war. Betrieblich abgestellt wurde auch der «Giruno» im einge-schalteten, beziehungsweise parkierten Zustand. Dazu war eine Parkstellung vorhanden, die beim unbesetzten Zug ge-wisse Funktionen automatisch überwachte. Dazu gehörte auch die
Spannung der
Fahrleitung und
der technische Zustand des Zuges. Nur wenn eine Störung verhinderte, dass
der Zug eingeschaltet bleiben konnte, wurde dieser ausgeschaltet. Da wir jedoch grundlegend beginnen wollen, ist der
Triebzug ausgeschaltet. Das konnte zum Beispiel passieren, weil am
Wochenende, wo der Triebzug nicht benötigt wurde, die
Fahrleitung
ausgeschaltet wurde. Das muss nicht einmal eine Störung sein, denn bei
Arbeiten an der Fahrleitung kann es sein, dass ein
Bahnhof grundsätzlich
ausgeschaltet werden muss. Fahrzeuge in diesem Bereich müssen dann
ausgeschaltet wurden. Der Lokführer gelangte über einen seiner Einstiege in
den Zug. Diese Türen waren mit einem speziellen Schloss versehen. Dieses
konnte nur vom
Lokomotivpersonal, das den passenden Schlüssel besass, geöffnet
werden. Damit war gesichert, dass der
Führerstand nicht von unbefugten
Personen betreten werden konnte. Jedoch war so auch ein Zugang möglich,
wenn die Steuerung gänzlich deaktiviert war und so keine Funktionen
bereitstanden.
Davor befand sich ein rund um diesen Sitz aufgebautes
Pult. Wegen den vielen Monitoren wirkte dieses Pult, das von frü-heren
Baureihen abgeleitet wurde, sehr modern. Wer einen
RABe 523 bedienten
konnte, fand sich hier zu recht. Dabei konnte der Lokführer sich auf der Fahrt in einem ergo-nomisch gestalteten Stuhl hinsetzen. Diese Sitzgelegenheit konnte so eingestellt werden, so dass auch auf längeren Strecken eine entspannte Fahrt möglich wurde. Diese Massnahme diente in erster Linie
auch der Erhöhung der Sicherheit, da der Lokführer so nicht so schnell
ermü-dete. Ein Vorteil, der besonders auf langen ununterbrochen Fahrten
einen Vorteil darstellte. Vor dem Sitz war das Führerpult angeordnet worden. Es be-stand aus dem Tisch mit Bedienhebeln und einer darüber an-geordneten Konsole mit mehreren Monitoren. Das Pult war in einer dunkelgrauen Farbe
gehalten, halbrund um den Sitz angeordnet und wirkte zum modernen Zug
pas-send. Für die Beine war eine Nische vorhanden in der eine Leiste
vorhanden war. Diese diente der
Sicherheitssteuerung und wurde, wie die
Nische, mit Riffelblech ausgeführt. Nachdem sich der Lokführer hingesetzt hatte, konnte
er das
Führerpult aktivieren. Die Steuerung nahm die Arbeit auf und die
spätere Fahrrichtung wurde angewählt. Das klappte auch, wenn der
Triebzug
ausgeschaltet und damit die Hähne zu im Zug vorhandenen
Hauptluftbehältern
geschlossen waren. Diese wurden durch die Steuerung geöffnet und so stand
nun auch die
Druckluft bereit. Das heisst, der Zug konnte nun in Betrieb
gesetzt werden. Wer sich an älteren Fahrzeugen orientierte, vermisste
jedoch die dazu erforderlichen Schalter. Diese gab es nicht, da sämtliche
gewünschten Funktionen am ganz rechts angeordneten Monitor abgerufen
werden konnten. Der Vorteil dieser Lösung war, dass man nur jene Symbole
bereitstellen musste, die auch benötigt wurden. Bedienfehler wurden
dadurch verringert und ein sicherer Betrieb ermöglicht.
Daher wurde er letztmals in einem anderen
Land abge-rüstet, als er wieder eingeschaltet werden sollte. Daher
war diese Kontrolle erforderlich um die richtigen
Sicher-heitseinrichtungen
zu aktivieren. Mit der Aktivierung der entsprechenden Funktion, wurde der Triebzug aufgerüstet. Dabei wurde alle Schritte ausge-führt und die entsprechenden Funktionen gleichzeitig über-wacht. Das bedeute zum
Beispiel, dass der
Hauptschalter erst ein-geschaltet wurde, wenn vom
gehobenen
Stromabnehmer
Spannung übertragen wurde. Fehlte diese, wurde der
Ein-schaltvorgang abgebrochen und vom Lokführer eine man-uelle Handlung
verlangt. Kontrollieren konnte der Lokführer den Vorgang am
Bildschirm der Diagnose, wo auch die
Spannung der
Fahrleitung angezeigt
wurde. Dieser Befand sich unmittelbar links vom zuvor erwähnten Monitor.
Allenfalls vorhandene Störungen wurden auch dort angezeigt. Dabei gab es
unterschiedliche Störungen. Bei unkritischen Störungen erfolgte lediglich
eine Anzeige. Kritische Störungen mussten jedoch vom Lokführer bestätigt
werden. Da sehr viele Aufgaben von der Steuerung übernommen
wurden, war die Inbetriebnahme keine umfangreiche Arbeit. Die Kontrollen
der
Bremsen konnten mit Hilfe einer speziellen Maske vorgenommen werden.
Sofern keine spezielle
Beleuchtung am Zug vorgesehen war, wurde
automatisch das für eine Zugfahrt erforderliche Bild erzeugt. Davon
abweichende Bilder musste jedoch das
Lokomotivpersonal einstellen.
Dieses DMI war in zwei Teile aufgeteilt worden und stammte, wie die Einrichtung für ETCS, von Siemens. Hier wurden auch für die Fahrt benötigte Daten eingegeben. In der entsprechenden Routine gab der Lokführer seine
Personalnummer, die Nummer des Zuges und die Funktion ein. Letztere waren
für den
Funk. In der Maske für die Eingaben der Zugdaten, gab das System automatisch die für den Zug passenden Daten vor. Diese mussten manuell nur korrigiert werden, wenn es davon Abweichungen gab. Das war zum
Beispiel der Fall, wenn nicht alle
Brem-sen funktionstüchtig waren.
Ansonsten konnten die Daten quittiert werden und wurden anschliessend
automatisch den jeweiligen
Zugsicherungen ange-passt abgespeichert. Ohne diese Daten konnte lediglich der Modus «Shunt-ing» gewählt werden. Die anderen Fahrten erfolgten grundsätzlich mit Zugdaten. Welche Methode letzt-lich für die Fahrt gewählt werden musste, gab der Lokführer vor. Wir hier haben uns für eine
Zugfahrt
mit Aussensignal im Level 1 LS entschieden. Daher wurde die entsprechende
Betriebsart eingegeben und bestätigt. Der Abschluss erfolgte mit einer
externen Taste. Damit war der Zug bereits fahrbereit. Selbst die
Anmeldung am
Funk erfolgte automatisch. Sie sehen, dass nicht viele
Aufgaben dazu erforderlich waren. Eine Lösung, die möglich wurde, weil es
sich bei einem
Triebzug um eine geschlossene
Komposition handelte. In der
Schweiz war damit auch die Fahrt möglich, da die Daten zum
Fahrplan dem
Lokführer auf einem eigenen persönlichen Gerät angezeigt wurden.
Die Fahrplandaten
wurden dort mit Hilfe einer Funk-verbindung übertragen und standen nach den
be-nötigten Handlungen ebenfalls bereit. Damit war der Zug auch in diesen
Ländern für die Fahrt bereit und hätte eigentlich losfahren können. Da wir jedoch mit einem Zug starten, kommt nun der Zugführer hinzu. Dieser stellte an seinem Arbeitsplatz die Anzeigen ein. Damit wurden auch gleich die re-gulären Ansagen aktiviert. Im Gegensatz zum
Nahverkehr, war bei diesen Zügen dazu das
Zugpersonal erforderlich. Die
Steuerung war jedoch so ausgelegt, dass die Ansagen für das entsprechende
Land korrekt erfolgten und der
Zug-führer von vielen Aufgaben befreit
wurde. Wir sind nun mit dem Zug für die Fahrt bereit. Erst wenn das Signal eine Fahrt zuliess, stellte der Lok-führer die Fahrrichtung mit einem kleinen Griff auf seiner rechten Seite ein. Es war durchaus auch
möglich, mit dem Zug rückwärts zu fahren. Jedoch liess
ETCS diese Fahrten
nur im Mode «Shunting» zu, so dass wir nur vorwärtsfahren können. Daher
wurde der Griff in die entsprechende Richtung gestellt. Erst wenn die Türen am Zug korrekt geschlossen waren,
konnte die Fahrt begonnen werden. Die entsprechenden Handlungen zur
Verriegelung und zur Freigabe wurden vom Lokführer übernommen. Dazu
standen ihm auf der linken Seite zwei gelbe und in der Mitte der beiden
eine rote Taste zur Verfügung. Erst wenn die rote Taste nicht mehr
leuchtete, konnte die Fahrt begonnen werden. Auch auf der Diagnose konnte
der Lokführer die Türen kontrollieren.
Verstellt werden
konnte die Geschwindigkeit in Schritten von fünf Kilometern pro Stunde.
Damit waren alle Punkte für die Fahrt vorbereitet und diese konnte
begonnen werden. Mit dem Fahrschalter, den der Lokführer mit der rechten Hand bediente, baute der Triebzug Zugkraft auf. Je nach Position des Hebels war diese grösser oder kleiner. Die Beschleunigung setzte ein und wurde bis zum Erreichen der eingestellten Geschwindigkeit beibehalten. Der Lokführer konnte die
Zugkraft jedoch jederzeit auch so regulieren,
dass damit die gefahrene Geschwindigkeit geregelt wurde. Dazu wurde
einfach die
Höchstgeschwindigkeit vorge-geben. Um den Zug wieder zu verzögern, wurde die Zugkraft zurück-genommen und der Griff über die Mitte gezogen. Damit schal-tete sich die elektrische Bremse zu und begann den Zug zu verzögern. Reichte deren
Kraft für die verlangte Verzögerung nicht aus, wurden durch den
Bremsrechner die pneumatischen
EP-Bremsen an den
Laufachsen aktiviert.
Wurde jedoch der Hebel ganz nach hinten gezogen, setzte die
Schnellbremse
ein. Blieb die Reaktion der Bremse aus, konnte der Lokführer mit der linken Hand den Bremshebel auf der linken Seite nach hinten ziehen. Damit wurde die
automatische Bremse aktiviert und der Zug
verzögerte alleine mit den pneumatischen
Bremsen des Zuges. Da diese
Lösung jedoch nur im Notfall angewendet wurde, bezeichnete man dieses
Ventil auch als
Notbremsventil. Befand sich dieses in der hintersten
Bremsstellung, war ebenfalls die
Schnellbremse aktiv. Sofern auch die Bremsung mit dieser
Bremse nicht
wirkte, konnte der Zug mit einem der vorhandenen NOT-AUS-Schalter
angehalten werden. Wurde dieser gedrückt, entleerte sich die
Hauptleitung
und die
Zugkraft wurde abgeschaltet. Da nun eine mechanische Lösung
wirkte, war die Bremsung gesichert und der
Triebzug wurde angehalten. Die
Hauptleitung konnte jedoch erst wieder gefüllt werden, wenn der Taster
entriegelt wurde. Wurde ein regulärer Halt eingelegt, musste der
Lokführer die Türen wieder freigeben. Das erfolgte indem er die gelbe
Taste auf der richtigen Seite drückte. Geöffnet werden konnten die Türen
jedoch erst, wenn der Zug angehalten hatte. War eine Türe offen, begann im
Führerstand die gelbe Taste zu blinken und die rote Taste leuchtete. Die
ruhende gelbe Taste zeigt geschlossene Türen an, jedoch waren die
Trittbretter noch ausgefahren. Befand sich der
Triebzug im
Endbahnhof konnte der Zug
in die
Parkstellung verbracht werden. Anschliessend wurde der
Führertisch
deaktiviert und es konnte auf die andere Seite gegangen werden. Dort
wurden schliesslich wieder die Handlungen der Inbetriebnahme erforderlich.
Wobei jetzt zu unserem ersten Mal, die Parkstellung aufgehoben werden
musste. Anschliessend unterschieden sich die Handlungen jedoch nicht mehr. Um den Zug länger abzustellen, wurde ebenfalls die
Parkstellung aktiviert. Sobald der
Führertisch deaktiviert wurde, waren
die Überwachungen aktiv. Bei Ausfall der
Spannung in der
Fahrleitung
schaltete der Zug aus. Kam die
Fahrleitungsspannung innerhalb der in der
Steuerung vorgesehenen Zeit wieder, schaltet der
Triebzug automatisch
wieder ein. Erst wenn die Zeit überschritten wurde, remisierte sich der
Zug automatisch.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Ergänzt wurde das
Ergänzt wurde das
 Verschaffen wir uns im
Verschaffen wir uns im
 Bevor erste Schaltungen ausgeführt werden konnten,
muss-te kontrolliert werden, ob der
Bevor erste Schaltungen ausgeführt werden konnten,
muss-te kontrolliert werden, ob der
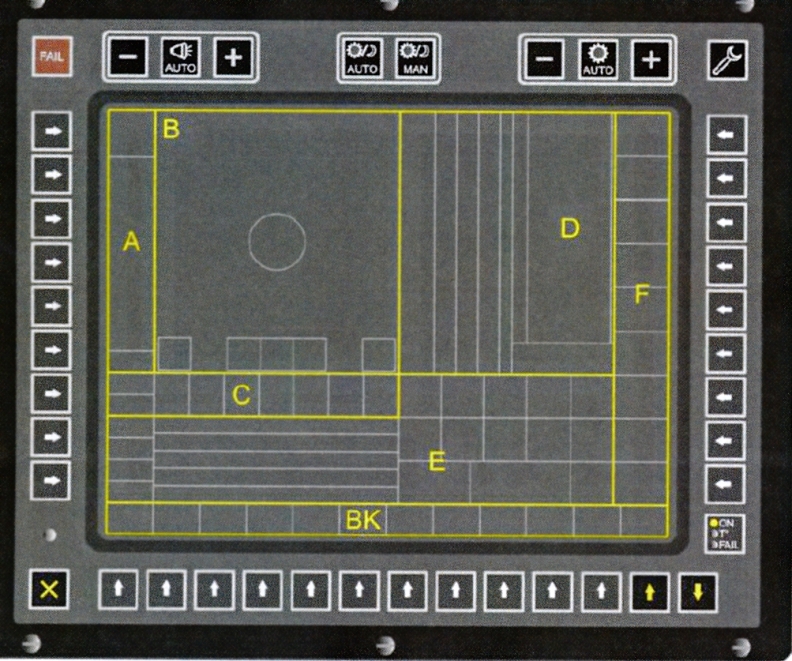 Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgte auf dem
Die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgte auf dem
 Bei Fahrten in Deutschland, aber auch in Österreich,
wurden die benötigten Daten jedoch auf dem Fahr-zeug angezeigt. Dazu war
links vom
Bei Fahrten in Deutschland, aber auch in Österreich,
wurden die benötigten Daten jedoch auf dem Fahr-zeug angezeigt. Dazu war
links vom  Mit einem kleinen
Mit einem kleinen