|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Sowohl für die
Beleuchtung,
als auch für die Steuerung des Fahrzeuges musste ein von der Versorgung ab
der
Fahrleitung
unabhängiges Netz geschaffen werden. Dazu wurden schon immer spezielle
Bordnetze
verwendet. Auch in diesem Punkt konnten kaum grosse Neuerungen umgesetzt
werden. Trotzdem müssen wir uns ansehen, wie dieses
Steuerstromnetz
versorgt wurde. Dabei werden wir durchaus bekannte Bauteile vorfinden.
Dieser war so geschützt, dass ein Defekt
bei der
Batterie
und ein damit verbundener Brand derselben, nicht auf das rest-liche
Fahrzeug übertragen wurden. Es war daher ein guter Schutz auch in diesem
Bereich vorhanden. Da alle drei Batteriemodule identisch aufgebaut wurden, können wir uns daher auf eine Einheit beschränken. Dabei bestand das Modul immer aus den Batterien und dem zuge-hörigen Ladegerät. Zudem war auch ein
Hauptschalter
vorhanden, der es er-laubte, das komplette Modul von restlichen
Bordnetz
zu tren-nen. Das war nötig, bei einem Defekt an den verbauten
Batterien.
Der
Triebzug
konnte so noch im Notbetrieb be-wegt werden. In einem Batteriemodul wurden drei
Bleibatterien
mit 36
Volt
eingebaut. Es handelte sich dabei jedoch nicht um die üblichen bisher bei
den Bahnen in Europa verwendeten Lösungen. Daher lohnt es sich, wenn wir
uns diese Bleibatterien etwas genauer ansehen. Insbesondere die Tatsache,
dass solche Behälter hier in einem geschlossenen Container verbaut wurden,
war eher überraschend. Bisher wurden belüftete
Batteriekasten
verwendet. Die
Bleibatterien,
die hier verbauten wurden, hatten zwischen den Bleiplatten ein Gel, an
Stelle der gefährlichen Säure erhalten. Durch diese Lösung konnten die
Zellen verschlossen werden. Es konnte so kein Wasserstoff mehr austreten.
Dank dieser Lösung konnte auch der Aufwand für die Wartung verringert
werden. Jedoch hatten auch diese Bleibatterien nur eine beschränkte
Lebensdauer und mussten daher ausgetauscht werden.
Daher wurde das Batteriemodul mit
Schienen
versehen. Es konnte so aus dem Fahrzeug gezogen werden. Danach waren die
Batterien
für die Hebewerkzeuge zugänglich und konnten so in einer Werkstatt
ausgetauscht werden. Da in einem Batteriemodul drei Bleibatterien verbaut wurden, konnte die Kapazität auf 660 Ah gesteigert werden. Jedoch interessiert uns mehr die Schaltung. Da gab es zu den bisherigen Lösungen jedoch keine Neuerung. Die drei Behälter wurden deshalb in Reihe
geschaltet. Dadurch wurde die
Spannung
für das
Bordnetz
auf einen Wert von 110
Volt
Gleichstrom
gesteigert. Jedoch kam diese Spannung nicht überall vor. In den Wagen gab es am Bordnetz angeschlossene Verbraucher, die nur mit einer Spannung von 24 Volt betrieben werden konnten. Aus diesem Grund besass jeder Wagen ein solches Netz, das von einem DC/DC-Wandler aus dem regulären Bordnetz versorgt wurde. Damit haben wir die
Spannung
festgelegt, aber das letzte Problem nicht gelöst, denn auch trotz der
hohen
Kapazität,
die
Batterien
mussten geladen werden. Aus diesem Grund wurde bei jedem
Batteriemodul auch gleich das benötigte
Ladegerät
ein-gebaut. Diese
Batterieladung
wurde von den
Hilfsbetrieben
mit
Spannung
versorgt und es wandelte die Spannung so um, dass die
Bleibatterien
wieder geladen werden konnten. Dazu musste die Spannung einfach etwas
höher sein. Dadurch wurden die Steuerung und die
Beleuchtung
ab dem Ladegerät versorgt. Die
Beleuchtungen
bei einem
Triebzug
waren schon immer umfangreicher, als dies bei
Lokomotiven
üblich war. So wurden die Lampen der
Fahrgasträume
ebenfalls ab diesem
Bordnetz
mit
Spannung
versorgt. Sie blieb daher auch erhalten, wenn der Zug ausgeschaltet wurde.
Das war bei der Fahrt bei
Fahrleitungsschutzstrecken
zwingend erforderlich. Aber auch hier muss gesagt werden, dass nicht so
viel verändert werden konnte. Unabhängig von der
Beleuchtung
der
Fahrgasträume
konnte die Ausleuchtung der
Führerstände
geschaltet werden. Das war erforderlich, damit hier auch Licht vorhanden
war, wenn in den Abteilen die Lampen gelöscht waren. Aber auch im
Führerstand wurden Sparlampen eingesetzt. Diese Ausführung hatte sich vor
Jahren gegenüber den alten
Glühbirnen
durchgesetzt. Es zeigte, dass hier bei der Beleuchtung kaum grosse
Veränderungen erfolgten.
Wurden diese
LED anders angesteuert und mit weiteren in jeder Lampe vorhandenen
Modellen ergänzt, konnten auch die anderen in den einzelnen Ländern
erforderlichen Farben erzeugt werden. Dabei wurde das
Zugschlusssignal nach den internationalen Normen gezeigt. Das
beutete, dass die beiden unteren Lampen rot angesteuert wurden. Womit wir
jedoch bereits bei der Anordnung der Stirnlampen angelangt sind. Für das Spitzensignal des
Triebzuges
wurden bis zu drei Lampen benötigt. Diese mussten gemäss den Vorschriften
der einzelnen Länder in Form eines A angeordnet werden. Daher wurden zwei
identische Lampen unten auf gleicher Höhe und eine dritte mittig über dem
Fenster des
Führerständes
angeordnet. Dabei konnte auch die obere Lampe andere Farben, als das
übliche weisse Licht zeigen. Dies wurde für die Warnsignale benötigt.
Da in anderen Ländern sogar blinkende
Lampen un-ten erforderlich waren, wurden diese so ausgelegt, dass auch
diese speziellen Warnsignale gezeigt wer-den konnten. Damit verfügte der
Zug über sämtliche
Signalbilder
der befahrenen Länder. Längst wurden an der Stelle der klassischen Steuer-ung, Systeme verwendet, die mit der Leittechnik angeboten wurden. Diese arbeiten üblicherweise mit Bussystemen, die als Fahrzeugdatenbus be-zeichnet wurden. Die
Leittechnik
übernahm dabei die komplette An-steuerung der Bauteile der
Traktionsausrüstung und viele andere Funktionen. Der Lokführer bediente
deshalb eigentlich nur noch einen Computer und hatten keinen direkten
Zugriff auf das Fahrzeug. Es war wegen der Redundanz erforderlich, dass auch
der
Fahrzeugdatenbus
eine doppelte Absicherung hatte. Die einzelnen
Stationen konnten daher jederzeit angesprochen werden. Die dabei
erforderlichen Signale wurden bei diesen Lösungen mit
Lichtwellenleiter
übertragen. Diese boten den Vorteil, dass sie nicht so anfällig waren auf
magnetische Störungen. Diese konnten vom Fahrzeug, jedoch auch von den
Mobiltelefonen erzeugt werden.
Trat dort eine Störung auf, wurde diese erkannt und an die
Diagnose ge-sendet. Anschliessend erfolgte die entsprechende Ausgabe an das
Personal. Wobei dort auf die Besatzung Rücksicht genommen wurde. Störungen, die den Bereich des Komforts betrafen, wurden von der Leit-technik in jedem Wagen ausgegeben und konnten so vom Zugpersonal abge-arbeitet werden. Lediglich die Meldungen, die auch für den Lokführer wichtig waren, wurden auch an dessen Arbeitsplatz ausgegeben. Dazu gehörte auch die
Feuerlöschanlage im Zug, da nun ein
ausserord-entlicher Halt erforderlich wurde. Jedoch eine gestörte
Beleuchtung, wurde nicht dem Lokführer gemeldet. Die Diagnose eines Zuges war nur so gut, wie sie vom Personal bearbeitet werden kann. Daher wurden bei der Anzeige der Störung auch gleich deren Behebung angeboten. Die Störung konnte daher mit
einfachen Handlungen auch während der Fahrt abgearbeitet werden. Es musste
deshalb nicht zwingend ausserordentlich angehalten werden. War dies jedoch
erforderlich, meldete dies die
Leittechnik dem Lokführer. Eine Wertung der auftretenden Störungen führte dazu,
dass das Personal nicht mit zu vielen Informationen gestört wurde. So
konnten Störung ohne Anforderung einer Handlung angezeigt werden.
Störungen, die jedoch zwingend eine Handlung erforderlich machten, wurden
mit anderer Farbe bei der Diagnose hervorgehoben. Das Personal handelte
daher entsprechend der Farbe für die Störung. Vorhandene Probleme blieben
jedoch erhalten.
Ein Vorteil, der
bei den immer kürzeren Zeiten für den Unter-halt von grosser Bedeutung war.
Reparaturen sollten in diesen Zeitfenstern erledigt werden können. Wenn wir schon beim Personal sind, kommen wir zur Kon-trolle des Lokführers. Hier hatten sich schon seit Jahren Sy-steme durchgesetzt, die dazu vorgesehen wurden, das Fahr-personal und dessen Fahrfähigkeit zu überwachen. Diese bestanden aus einer
Sicherheitseinrichtung, die schnell wirkte und einer
Wachsamkeitskontrolle, die erst nach einer etwas längeren Zeit aktiv wurde
und die kontrollierte, ob das Personal noch reagierte. Verwendet wurden dazu die
Sicherheitssteuerung und
die
Sifa. Beide Systeme waren hier vorhanden und die Unterschiede waren
nur gering. Dabei wurde die SIFA in allen Ländern ausser der Schweiz
verwendet. In der Schweiz war daher die bekannte Lösung aktiv, auch wenn
wir schnell feststellen werden, dass diese nicht mit den älteren Baureihen
vergleichbar war. Der Unterschied fand sich jedoch nicht nur beim
Schnellgang. Der
Schnellgang und damit das
Sicherheitselement
wurde aktiv, wenn der
Triebzug
schneller als 0.5 km/h fuhr und wenn das
Pedal im besetzten
Führerstand nicht niedergedrückt wurde. Während der
Dauer von zwei Sekunden passierte vorerst nichts. Bei der
Sicherheitssteuerung war bei tiefen Geschwindigkeiten jedoch ein Weg von
50 Meter, der überwacht wurde. Genau diese Distanzkontrolle gab es bei der
Sifa nicht, ansonsten war alles identisch.
Wurde das
Pedal nach weiteren zwei
Sekunden, oder 50 Metern, nicht korrekt bedient, sprach die Einrichtung
mit einer
Fahrsperre und der verlangten
Zwangsbremsung an. Der
Triebzug
kam
so zum Stillstand. Daher sprach der Schnellgang nach vier Sekunden, oder 100 Metern (Nur Schweiz) an. Der Lokführer konnte die getroffenen Massnahmen jedoch wieder aufheben. Dazu musste er nur das Pedal drücken und den entsprechenden Leuchtmelder drücken. Es war daher eine dop-pelte Rückstellung nach den neusten gesetzlichen Vorgaben vorhanden. Bei der
Wachsamkeitskontrolle, die als
Langsamgang
bezeichnet wurde, gab es zwischen der
Sicherheitssteuerung und der
Sifa
bei der Wirkung keinen Unterschied mehr. Lediglich die Rückstellung
erfolgte beim Betrieb in der Schweiz auch mit zusätzlichen Elementen.
Jedoch war nun keine Distanzmessung mehr vorhanden, so dass
ausschliesslich mit den Zeiten gearbeitet wurde und dabei werden Sie
vermutlich eine Überraschung erleben. Der
Langsamgang wurde aktiviert, wenn das
Pedal
niedergedrückt wurde. In der Schweiz musste zusätzlich auch keine Handlung
ausgeführt werden. Damit begann die Zeit von 45.5 Sekunden zu laufen. War
diese erreicht, wurde ein
Leuchtmelder aktiviert und nach 48 Sekunden,
also nur 2.5 Sekunden später, die akustische
Warnung in Form eines
Tieftones aktiviert. Der Lokführer hatte nun wieder Zeit zu reagieren.
Die
Rückstellung erfolgte nun mit dem Loslassen des
Pedals und der Bedienung
des
Leuchtmelders. In der Schweiz konnte zum Melder auch eine der
definierten Handlungen ausgeführt werden. In Italien galten diese Werte
jedoch nur bei
ETCS Fahrten. Wurde in Italien ohne ETCS gefahren, galten beim Langsam-gang verkürzte Zeiten. Daher begann die Lampe nach 25 Sekunden zu leuchten, die akustische Warnung kam nach 27.5 Sekunden und bereits nach 30 Sekunden erfolgte die Zwangs-bremsung. Doch damit nicht genug, denn bei
der FS gab es noch eine Wegfahrsperre, die ebenfalls mit dem
Pedal bedient
wurde. Es konnte erst losgefahren werden, wenn das Pedal gehoben und
erneut gedrückt wurde. In allen Ländern ermöglichte die Sicherheitseinrichtung dem Lokführer auch eine Erleichterung der Bedienung. Dazu musste lediglich das Pedal zwei Mal kurz angehoben werden. Mit diesem Doppelklick wurde die Längenmessung aktiviert. Diese berechnete
nun die Zeit, bis der Zugschluss die Stelle passiert hatte. War das
erfolgt, wurde ein akustisches Signal ausgelöst. Die Zugslänge wurde dabei
von den
Zugdaten der
Zugsicherung genommen. Neben den Aufgaben der Steuerung, der Diagnose und
der Kon-trolle des Lokführers übernahm der
Fahrzeugdatenbus
des
Triebzuges
auch die Bereitstellung der einzelnen
Zugsicherungssysteme. Diese waren in
den einzelnen Ländern so unterschiedlich ausgeführt worden, dass sie sich
gegenseitig beeinflussen konnten. Daher wurden mit der Wahl der
Länderkonfiguration auch gleich die dabei erforderlichen Systeme der
Zugsicherung aktiv geschaltet.
Daher
mussten die
Meldungen in diesem Fall mit
ETM übermittelt wer-den. Jedoch
war auch ETM auf dem Zug nicht mehr eingebaut worden. In der Schweiz
verkehrte der
Triebzug RABe 501 daher ausschliesslich mit
ETCS. Da der Erbauer damals noch keine eigenen Systeme für ETCS anbot, wur-de die entsprechende Ausrüstung bei einem entsprechenden Anbieter eingekauft. Dabei wurde der bei diesem Triebzug der Hersteller Siemens berücksichtigt. Dieses System war für die neuen Ausrüstungen der Strecken
ausgelegt worden. Zur Anzeige waren in den
Führerständen die
entsprechenden Monitore im direkten Blickfeld montiert worden. In allen
Ländern wurde hier die Geschwindigkeit angezeigt. Auf Strecken, die mit der herkömmlichen Signalisation
ausgerüstet wa-ren, wurde mit
Level 1 Limited Supervision gefahren. Dabei
übernahm
ETCS die Funktion der konventionellen
Zugsicherung
vollumfänglich. Die-se arbeitete dabei grundsätzlich mit den
Meldungen und
den Handlungen von
ETCS. Dabei wurde jedoch auch die
Höchstgeschwindigkeit
des Zuges durch die
Leittechnik auf einen Wert von 160 km/h beschränkt. In der Schweiz konnte die
Höchstgeschwindigkeit bis
250 km/h jedoch nur gefahren werden, wenn der
Triebzug auf Strecken mit
ETCS
Level 2 eingesetzt wurde. Daher wurde auch dieses bei der Ausrüstung
berücksichtigt. Es muss erwähnt werden, dass die Baugruppen von ETCS nicht
nur in der Schweiz, sondern auch in den anderen Ländern zur Verfügung
standen. Das war erforderlich, weil dort zum Teil ebenfalls mit ETCS Level
2 gearbeitet wurde.
Die
Leittechnik war zudem dafür besorgt,
dass die erforderlichen
Zugdaten automatisch eingetragen wurden. Damit
war es theoretisch möglich, ohne Halt das System zu wechseln. Eine Ähnliche Lösung gab es auch beim Wechsel nach Italien. Dort wurde neben ETCS Level 2 auch die Zugsicherung SCMT eingebaut. Wie bei den anderen Systemen wurde dieses im Hintergrund durch die Leittechnik mit den benötigten Daten versehen. Bei einem Länderwechsel
nach Italien standen diese daher sofort bereit. Damit konnte der Halt zum
Systemwechsel in Chiasso grundsätzlich ent-fallen. Für die
Vielfachsteuerung von bis zu zwei
Triebzügen
wurde der
Zugdaten-bus geschaffen. Grundsätzlich war es jedoch möglich auch
mehr Fahrzeuge an den
Zugbus anzuschliessen. Jedoch war dies wegen der
Länge der Züge nicht sinnvoll, denn zwei Züge erreichten bereits 400
Meter. Durch die
Bahnsteige in den einzelnen Ländern war eine Beschränkung
auf diese Länge jedoch erforderlich, so dass nur zwei Züge freigeschaltet
wurden. Die Aufgabe des
Zugdatenbusses bestand eigentlich nur
darin, die beiden
Fahrzeugdatenbusse über die
Kupplung so zu verbinden,
dass die Informationen dieser Systeme auf die angeschlossenen Fahrzeuge
übertragen wurden. So konnten Störung im ferngesteuerten Zug auf das
besetzte Fahrzeug übertragen werden. Das Personal war daher an der Spitze
über die Probleme im zweiten
Triebzug jederzeit ausreichend informiert. Es bleibt hier eigentlich noch zu erwähnen, dass
Vielfachsteuerung mit Hilfe der
Leittechnik einfacher aufgebaut werden
konnte. Die Signale mussten nur auf den
Zugdatenbus übertragen werden,
damit es nicht zum direkten Kontakt des
Fahrzeugdatenbusses kam. Es
handelte sich daher in diesem Fall immer noch um zwei autonom arbeitende
Fahrzeuge. Wichtig war das bei der
Verbindung, aber auch bei der Trennung.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Versorgt
wurde das
Versorgt
wurde das
 Da
jede
Da
jede
 Anders
sah es bei der
Anders
sah es bei der
 Gerade
die Warnsignale der einzelnen Länder unter-schieden sich. So war in
Deutschland kein entspre-chendes Bild nötig. In der Schweiz mussten die
drei Stirnlampen jedoch rot beleuchtet werden.
Gerade
die Warnsignale der einzelnen Länder unter-schieden sich. So war in
Deutschland kein entspre-chendes Bild nötig. In der Schweiz mussten die
drei Stirnlampen jedoch rot beleuchtet werden. Da die Technik nicht mehr mit den herkömmlichen
Methoden bearbeitet werden konnte, musste zur Unterstützung des Personals
ein
Da die Technik nicht mehr mit den herkömmlichen
Methoden bearbeitet werden konnte, musste zur Unterstützung des Personals
ein
 Befand sich das Fahrzeug im Unterhalt, konnte ein
tragbarer Computer an die
Befand sich das Fahrzeug im Unterhalt, konnte ein
tragbarer Computer an die
 Nach dieser Wegstrecke, beziehungsweise nach der
vorgegebenen Zeit bei der
Nach dieser Wegstrecke, beziehungsweise nach der
vorgegebenen Zeit bei der  Wurde das
Wurde das
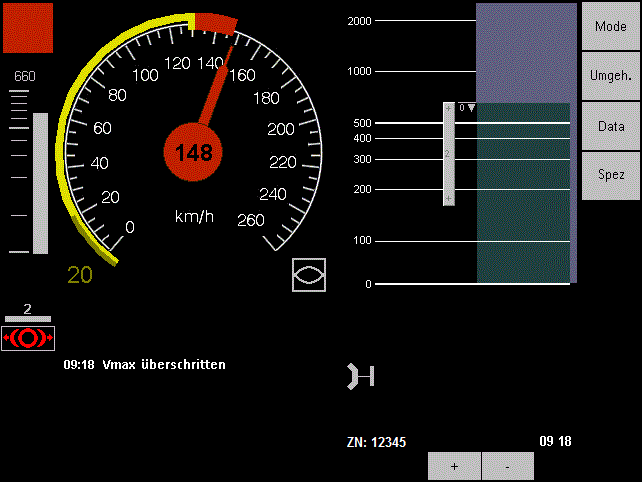 In der Schweiz wurden die
In der Schweiz wurden die
 Für den Einsatz in Deutschland, aber auch in
Österreich, waren die
Für den Einsatz in Deutschland, aber auch in
Österreich, waren die