|
Betriebseinsatz Teil 1 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Bei der vorher betrachteten
Inbetriebsetzung
wurden auch die
Zulassungen
bewirkt. Diese war natürlich für die Schweiz erforderlich und wurde damals
noch von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB in hoheitlicher Form
erteilt. Die langen Verfahren, waren daher damals noch nicht der Fall. Es
zeigt, sich, dass Behörden selten zu einer Beschleunigung beitrugen. Hier
war die Zulassung für die Schweiz daher kein Problem.
Dort war die
Fahrleitung
nach den Normen der Schweiz aufgebaut worden und daher war der Einsatz
kein Problem. Damals war aber noch kein Einsatz geplant. So richtig aufgeweckt wurden die Leute der Nachbarschaft in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1990. Ein lauter Knall war vom nahen Bahnhof zu hören. Die dadurch aufgeschreckten Leute konnten jedoch kein grosser Vorfall entdecken.
Alarmiert, waren jedoch die technischen
Dienste der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die erkannten dann den
umfangreichen Schaden an der neu gebauten
Lokomotive
der Reihe Re 450. Die Abklärungen ergaben, dass ein Spannungswandler explodiert war. Diese Bauteile wurden so zahlreich verbaut, dass man kaum von einem grösseren Problem ausgehen konnte.
Bei der zur Reparatur geschickten
Lokomotive
wurde dann ein neues Modell eingebaut. In den Unterlagen wurde dann
einfach ein Fehler in der Fabrikation notiert. Da sich die Sache auch
nicht häufte, kann davon ausgegangen werden, dass diese Annahme stimmt.
Trotzdem wurde aus Sicherheitsgründen das
Gepäckabteil gesperrt. Der Wandler hatte dieses so umgestaltet, dass eine
Person darin schwerste Verletzungen erlitten hätte. Auch wenn anfänglich
keine Serie zu befürchten war, die Sicherheit wurde gross geschrieben. Es
war bekanntlich nur in der Schweiz vorgesehen, dass mit einer
S-Bahn auch
Gepäck mitgeführt wurde. Eine Praxis, die sich aber schnell ändern sollte.
Schlimmer sah es beim
Triebfahrzeug aus. Dieses kämpfte immer
noch mit Kinderkrankheiten und musste zur Behebung dieser unter die
Garantie fallenden Probleme beim Hersteller vor-sprechen. So fehlten diese
für den Verkehr.
Der Start für die neue
S-Bahn verlief mit den
Fahrplanwechsel im Frühjahr 1990 gar nicht nach den Wünschen der Planer.
Die neuen
Lokomotiven fehlten und auch sonst standen viele Sachen nicht
bereit. Dazu gehört auch die Zugbeeinflussung
ZUB 121, die auf den
Triebfahrzeugen noch ausgeschaltet war. Das grosse Problem waren aber die
Maschinen der Baureihe Re 450. Es musste daher improvisiert werden und
dabei griff man zum alten Material.
Einige Strecken wurden von den
Triebwagen
RBe 4/4
übernommen, die oft mit bis zu zwei
Pendelzügen verkehrten. Da aber deren
Anzahl im Raum Zürich auch nicht üppig war, mussten auch
Lokomotiven
aushelfen. Bei der Baureihe Re 4/4 II wurde deshalb das seit Jahren
bestehende Verbot für Pendelzüge aufgehoben. So konnten auch sie
eingesetzt werden. Doch da waren noch die neuen Wagen und die sollten auch
verkehren.
Zur Bespannung der
Doppelstockwagen griffen die
verantwortlichen Stellen zur Reihe Ae 6/6. Zwar handelte es sich dabei um
eine eher gemütliche Maschine, aber sie hatte die erforderliche
Zugkraft.
Damit konnte auch die
Zugreihe A kompensiert werden. Jedoch war klar, dass
es sich hier nur um einen kurzen Einsatz handeln sollte, denn mit
verfügbaren Re 450 wurden auch die Wagen benötigt um
Pendelzüge zu bilden.
So konnten die Wagen davon genutzt werden. Oft mussten aber
die Strecken mit zwei Einheiten gefahren werden, was den Bestand immer
noch sehr knapp erscheinen liess. Die anderen Züge blieben daher vorerst
im Einsatz.
Lange konnte der Betrieb nicht gut gehen. Im
September 1990 kam es in Pfäffikon SZ zu einer
Entgleisung. Diese schob
man dem geänderten Abfahrverhalten der
S-Bahn in die Schuhe. Diese
Einheiten fuhren nach dem die Türen geschlossen waren, ohne einen
Abfahrbefehl weiter. Damit konnte schnell das rote Signal übersehen
werden. Da
ZUB 121 immer noch nicht bereit stand, konnte dieses den
Vorfall nicht wirksam verhindern.
Es sollte auch nicht lange gehen, bis die ersten Re
450 mit Grafiti verkehrten. Dabei hatte man gehofft, dass die gesickten
Wände diese Schmierereien verhindern würden. Der Aufwand für die
Entfernung war damals noch sehr gross, denn die heute üblichen Schutzlacke
gab es damals noch nicht. Wurde der Anstrich zu sehr angegriffen, blieb
nur ein neuer Farbauftrag übrig. Die Kosten trug dann meistens das Opfer
und nicht der Täter.
Auch das Jahr 1991 brachte für die neuen
Lokomotiven
nicht viele guten Punkte. So tauchte die erste Maschine mit zerschlissenen
Gummielementen in der Werkstatt auf. Diese mussten ersetzt werden und der
Werkführer stellte dabei nur fest, dass dazu die halbe Lokomotive zerlegt
werden muss. Das Ziel sollte daher die nahe
Hauptwerkstätte sein. Dort
wurden die Elemente ersetzt und die Maschine wieder auf Reisen geschickt.
Daher machte man das, was man gut konnte und das war die Schuld
von sich zu weisen. Der Lieferant der Elemente wurde zum Buhmann. Der
Lokomotive half das indes weniger und immer mehr mussten abgestellt
werden. Zu Klärung schickte man die Lokomotive mit der Nummer 450 000 auf Reisen. Sie hatte die grösste Strecke absol-viert und daher wurde erwartet, dass die Probleme hier auch auftreten sollten.
Die
Fahrten erfolgten bei der Beschleunigung oft im
Makroschlupf, was die
Fachleute wohlwollend sahen. Ab und zu rumpelte es unter dem
Versuchsobjekt etwas, aber das sah man nicht als grosses Problem an, denn
noch hielt der
Antrieb.
Auch die Nummer 450 003 wurde kurze Zeit später für
die Abklärungen herangezogen. Das Problem war aber, dass im Bereich der
S-Bahn der Platz für solche Fahrten fehlte. Ausweichen auf andere Strecken
war nicht leicht, da diese kaum für
Doppelstockwagen geeignet waren. Das
alles hielt die Generaldirektion nicht davon ab, einen Ausflug mit dem
neuen
Pendelzug zu machen. Strecken die kaum geeignet waren inklusive.
Der Anruf des
Bahnwärters im
Depot war wie eine
Explosion. Die neue
Lokomotive hatte nicht nur Probleme mit dem
Antrieb,
sie sorgte auch für Schäden an den Anlagen. Insbesondere im Bereich um
Dübendorf und Stettbach waren die Schäden gut zu erkennen. Es musste eine
Lösung her, denn mit dem Wechsel der Elemente war es nicht mehr getan,
denn wer die
Schienen killte, musste über kurz oder lang mit einem
Fahrverbot rechnen.
Nun suchte man intensiv nach der Ursache und fand diese
schliesslich beim Schleuderverhalten der
Lo-komotive Re 450. Mit anderen
Einstellungen beim
Schleuderschutz konnten die Probleme bei den
An-trieben
und den
Schienen behoben werden. Der Betrieb stabilisierte sich im Verlauf des Jahres 1992 etwas. Zwar wurden immer noch die alten Modelle eingesetzt, aber die Reihe Re 450 nährte sich langsam bei der Verfügbarkeit zu den Vor-gaben.
Das weckte neue Ideen und da kam eine Anfrage aus dem östlichen
Nachbarland gelegen. Die Öster-reichischen Bundesbahnen ÖBB hatten
Interesse an Stockwagen und daher wurde angefragt, ob damit Versuche
möglich wären. So machte sich die Nummer 450 050 am 09. No-vember 1992 auf die lange Reise nach Wien. Diese umfasste an der Grenze einen Aufenthalt.
Während dieser Zeit wurde ein
Schleifstück nach den Normen der
ÖBB montiert. Danach ging die Fahrt wieder weiter. Wegen den breiteren
Schleifleisten waren die
Tunnel grösser, so passte der Zug ohne Probleme
auf die Strecken der ÖBB. Lediglich ein zweiter Lokführer musste
mitfahren, der die Strecken auch kannte.
In Wien wurden dann während mehrerer Tage
Versuchsfahrten mit der
S-Bahn aus der Schweiz durchgeführt. Eine Idee der
beteiligten Leute, führte dazu, dass mit dem Zug der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB einen Taufakt gab. Die Nummer 450 050 sollte in der Folge
mit dem Wappen und dem Namen der Stadt Wien verkehren. In der Schweiz
konnte das dann nach den Feiertagen und daher erst im Jahre 1993 erkannt
werden.
So
gelangte eine Maschine mit dem
Pendelzug nach Oberent-felden und somit auf
die ehemalige
Nationalbahn. Dort selten, war sie sonst auf deren Strecken
oft zu sehen. Es mussten Reis-ende nach Zürich befördert werden, die nicht
mehr umsteigen sollten. Wegen den Explosionen der Spannungswandler war das Gepäck-abteil gesperrt worden. Knallte es, flog alles in diesen Raum, was Leute schwer verletzen konnte. Im Jahre 1993 konnte das Verbot jedoch aufgehoben werden.
Das
Gepäckabteil war daher wieder zugänglich, auch wenn
bei der
S-Bahn kaum Gepäck befördert wurde. Fahrräder und deren Benutzer
sollten nun aber die Möglichkeit haben, sich dort zu verladen.
Einen speziellen Gag erlaubte man sich 1993 bei der
Abnahmefahrt der Nummer 450 068. Diese wurde dazu schlicht vor die
Baureihe
Ae 6/6 gespannt und dann fuhren beide mit einem
Güterzug los. Auf
den Wagen waren zudem
Diesellokomotiven verladen, die für den Export
vorgesehen waren. Diesmal sollte es aber der letzte Einsatz vor einem
Güterzug sein, denn dazu war die Baureihe Re 450 schlicht nicht gebaut
worden.
Als am 26. September 1994 in Brugg die Sirenen der
Feuerwehr zu hören waren und diese den
Bahnhof ansteuerten ahnte man
böses. Ein
Pendelzug mit
Lokomotive Re 450 war in Brand geraten. Diesmal
war aber ein Wagen betroffen, der schnell gelöscht werden konnte. So waren
die Schäden nur gering und die Einheit konnte schnell wieder in Betrieb
genommen werden. Die Ursache hatte aber weitaus grössere Auswirkungen.
Was den Leuten, die
nicht rauchten gefiel, war für jene die mit einer Sucht kämpften ein
Problem. Allerlei Lösungen dafür wurden gesucht und block-ierte Türen waren
sehr beliebt. Das gefiel dem Lokführer nicht, da er ja den
Fahrplan
einhalten sollte.
Auch im Jahre 1994 gab es wieder
Versuchsfahrten mit
der Baureihe Re 450. Diesmal sollte sie aber nicht direkt erprobt werden,
denn es handelte sich um einen Auftrag für die Forschung. Dieser Einsatz
zeigte aber, dass die Verfügbarkeit die hohen Werte nun erreicht hatte und
man auf einen
Pendelzug auch verzichten konnte. Es lohnt sich, wenn wir
kurz auf den Einsatz der Einheiten blicken, denn nicht ohne Probleme ging
das nicht.
Die
Lokomotiven Re 450 hatten nun die meisten Züge
der
S-Bahn in Zürich übernommen. Daher waren sie auf den meisten Strecken
anzutreffen. Ein Problem gab es dabei lediglich mit der S12. Diese befuhr
zwischen Dietikon und Killwangen-Spreitenbach eine Strecke die für 140
km/h zugelassen war. Diese konnten die Einheiten mit 130 km/h aber nicht
mehr erreichen. Auf dem dicht befahrenen Abschnitt ein kleines Problem.
Ausserhalb des Ballungsraumes von Zürich und der
dortigen
S-Bahn waren die Re 450 schlicht nicht mehr zu sehen. Dazu waren
sie gebaut worden und das wirkte sich auch auf das Personal aus. Es wurden
auf diesem Modell nur die Lokführer geschult, die auch eingesetzt wurden.
Damals ahnte noch niemand, dass dazu auch Lokführer des
Depots Erstfeld
gehören sollten. Ich war damals schon zu lange dabei, dass ich nicht dazu
gehörte.
Beim Havaristen eingetroffen, war dann
schnell zu erkennen, dass es ein grösserer Vorfall war. Die schwer
beschädigte
Loko-motive 450 032 musste abtransportiert werden. Die
Hauptwerk-stätte Yverdon richtete sie anschliessend wieder her. Yverdon kam damals in den Genuss, weil die zuständige Haupt-werkstätte in Zürich mit der Arbeit sehr ausgelastet war. Um die Maschine schnell wieder im Einsatz zu haben, wurde sie in die Westschweiz überstellt.
Niemand ahnte damals, dass sich diese Fahrten in
einigen Jahren wiederholen sollten. Noch aber kehrte die Nummer 450 032
wieder zurück. Ein Erfahrung reicher war sie, denn in Yverdon sprach man
französisch. Wenn wieder eine Taufe anstand, fuhr in der Regel der Kandidat an den Ort. Wenn es sich jedoch ergab, wurde das auch genutzt um andere Einheiten zu überführen.
Die Fahrt mit drei Einheiten an eine
Taufe war jedoch eine seltene Sache und musste daher erwähnt werden. Die
Re 450 bekamen nun Wappen und das ergab mit den Namen Wien und City of
Osaka auch zwei Exoten. Es ist bestätigt, dass die
Lokomotive nicht in
Japan war.
Ein schönes Wochenende im Jahre 1995 sollte ein
wesentlich grösseres Problem aufdecken. Während der
Güterverkehr ruhte,
wurde die Hauptlast des Verkehrs von den Baureihen Re 450 und
Re 460
abgewickelt. Diese bekamen nun aber vermehrt Störungen. Diese betrafen die
Überwachung auf 100
Hertz. Sie konnte nicht so leicht behoben werden. Da
zwei Baureihen betroffen waren, konnte es nicht an einem Modell liegen.
Ergab das dann die sechsfache Frequenz sprach die 100 Hz Überwachung an.
Das Problem konnte schliesslich mit einer leicht höheren
Frequenz von 16.7
Hz gelöst werden. So ergaben sich nie mehr Oberwellen, die mit 100 Hz
schwingen konnten. Als die entsprechenden Dienste der Schweizerischen Bundesbahnen SBB im Herbst den neu geschaffenen Funkmesswagen in Betrieb nehmen konnten, musste er geprüft werden.
Dabei waren die eingebauten
Leitungen für die zahl-reichen Systeme bei den
Vielfachsteuerungen ein
wichtig-er Punkt. Dabei war der Wagen jedoch nur mit den Leitungen versehen
worden, denn mehr musste auch nicht vorhanden sein, da die Türen nicht
beeinflusst wurden. Im Winter 1995 und 1996 war dann auch die Lokomotive Re 450 an der Reihe. Der Wagen wurde dazu an Stelle des sonst in der Mitte eingereihten Wagen AB platziert.
Die so mit dem gelben
Funkmesswagen sehr bunt
aus-sehende
Komposition wurde danach auf zahlreiche Testfahrten geschickt.
Dabei wurden auch gleich die Sy-steme zur Messung der Funkwellen überprüft.
Besonders wichtig war das bei den neuen Mobiltelefonen.
Beim regulären Einsatz bei der
S-Bahn in Zürich gab
es keine grossen Veränderungen. Die Einheiten deckten die meisten Linien
ab und nur noch die Reihe RABDe 510 konnte mithalten. Wobei nach wie vor
in den Randzonen auch noch
Pendelzüge mit umgebauten
Triebwagen
RBe 540 zu
beobachten waren. Die Anzahl
Lokomotiven Re 450 war daher weiterhin sehr
knapp bemessen und daher mussten Erweiterungen genau plant werden.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2024 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Speziell
ist, dass nach diesem Schritt auch eine beschränkte
Speziell
ist, dass nach diesem Schritt auch eine beschränkte 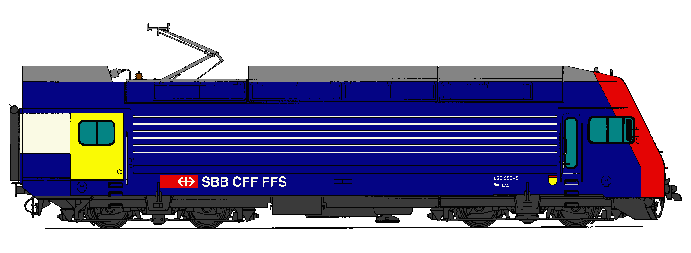 Die Inbetriebnahme von neuen
Die Inbetriebnahme von neuen
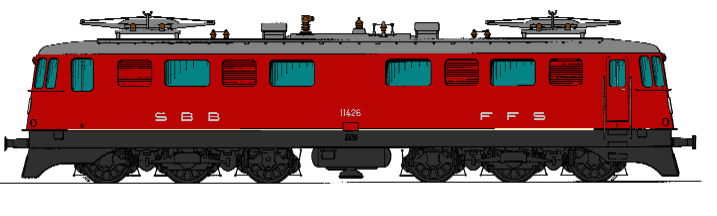 Während dem Sommer beruhigte sich die Sache etwas.
Es standen nun mehr Maschinen der Reihe Re 450 bereit. Die neuen
Während dem Sommer beruhigte sich die Sache etwas.
Es standen nun mehr Maschinen der Reihe Re 450 bereit. Die neuen
 Als dann gleich mehrere Maschinen mit dem gleichen
Problem in den Unterhalt kamen, sah es schon schlechter aus. Es musste ein
Problem geben. Die Fachleute hatten keine Ahnung, was die Ursache sein
konnte.
Als dann gleich mehrere Maschinen mit dem gleichen
Problem in den Unterhalt kamen, sah es schon schlechter aus. Es musste ein
Problem geben. Die Fachleute hatten keine Ahnung, was die Ursache sein
konnte. Indes wurden weitere Serien bestellt. Mit
Ausliefer-ung der letzten Re 450 sollte der Bestand auf 115 Einheiten
angestiegen sein. Noch war das nicht der Fall und niemand wusste, wann das
Fahrverbot kam.
Indes wurden weitere Serien bestellt. Mit
Ausliefer-ung der letzten Re 450 sollte der Bestand auf 115 Einheiten
angestiegen sein. Noch war das nicht der Fall und niemand wusste, wann das
Fahrverbot kam. Mittlerweile gehörten die
Mittlerweile gehörten die
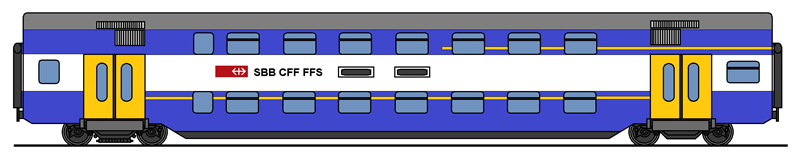 Vermutet wurde eine unachtsam weggeworfene
Zigarette. Nach weiteren solchen Vorfällen sollte es in der Schweiz zu
einem generellen Rauchverbot in den Zügen kommen.
Vermutet wurde eine unachtsam weggeworfene
Zigarette. Nach weiteren solchen Vorfällen sollte es in der Schweiz zu
einem generellen Rauchverbot in den Zügen kommen. Das Jahr 1994 neigte sich dem Ende zu und alle
freuten sich auf Silvester. Die
Das Jahr 1994 neigte sich dem Ende zu und alle
freuten sich auf Silvester. Die
 Die Abklärungen zeigten, dass diese Störungen nur
gehäuft auftraten, wenn wenige Modelle mit einer klassischen Ausrüstung
verkehrten. So konnten sich die Oberwellen ausbreiten und überlagern.
Die Abklärungen zeigten, dass diese Störungen nur
gehäuft auftraten, wenn wenige Modelle mit einer klassischen Ausrüstung
verkehrten. So konnten sich die Oberwellen ausbreiten und überlagern.