|
Druckluft und Bremsen |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Es ist ganz einfach, ohne
Druckluft
funktionierte kaum eine
Lokomotive.
Auch bei der hier vorgestellten Baureihe gab es davon keine Abweichungen.
Um jedoch diese Druckluft nutzen zu können, musste sie hergestellt werden.
Das konnte aber nur gemacht werden, wenn die Lokomotive eingeschaltet war.
Leider konnte diese ohne Druckluft nicht eingeschaltet werden. Ein
Problem, dessen Lösung wir uns daher genau ansehen müssen.
Auch wenn es zwei Lufterzeuger waren, wir könnten uns eigentlich
auf ein Exemplar beschränken. Welcher es letzt-lich ist, spielt keine
Rolle. Ich wählte dazu das Modell, dass beim
Führerhaus
mit der Nummer eins im
Vorbau
eingebaut wurde. Eingebaut wurde ein Kolbenkompressor. Dieser bezog die Luft innerhalb des Vorbaus. Dabei wurde diese durch die Lücke zwischen der Haube und dem Kasten angezogen. Im grossen Raum erfolgte anschliessend eine Beruhigung der Luft, bevor sie dann über einen Filter in den Kompres-sor gelangte.
Dort wurde sie mit der Hilfe eines
Kolbens
in eine ge-schlossene Leitung geschöpft. Der einzige Unterschied zur
Luftpumpe
befand sich lediglich beim
Antrieb.
Die
Leistung
dieses
Kompressors reichte jedoch nicht aus, um die
Verbraucher mit ausreichend Luft zu versorgen. Das war der Grund für die
Lösung mit zwei identischen Modellen. Jedoch war auch dann nicht immer
gesichert, dass genug Luft geschöpft werden konnte. Daher wurde die
Leitung vom Kompressor mit einem Luftbehälter verbunden. Jedes Modell
hatte seinen eigenen Behälter erhalten. Die Leitungen wurden erst
anschliessend verbunden.
Der
Hauptluftbehälter
eines
Kompressors wurde in seiner Nähe eingebaut. Diese
Lösung erlaubte kurze Leitungen. Jedoch war innerhalb des
Drehgestells und auch im
Vorbau
kein Platz mehr vorhanden. Daher wurden die Luftbehälter seitlich auf der
linken Seite im Bereich der
Laufachse
in Längsrichtung eingebaut. Der Luftbehälter war daher sehr gut zu
erkennen. Ein Merkmal, das speziell war, da nur diese Baureihe so
aufgebaut wurde.
Erfolgte dies jedoch nicht rechtzeitig, war in der Leitung zum
Hauptluftbehälter
ein
Überdruckventil
vorhanden. Dieses öffnete, wenn der
Luftdruck
im Be-hälter den Wert von acht
bar
überschritt. Um den Luftvorrat in den Hauptluftbehältern zu spei-chern, waren in der Zuleitung und in der Leitung zum Druckluftsystem Absperrhähne eingebaut worden. So konnte die Lokomotive mit diesem Vorrat einge-schaltet werden.
Da jedoch bei einem längeren
Stilllager die
Druckluft
trotzdem entweichen konnte, musste eine andere Lösung eingebaut werden.
Diese erlaubte es die Druckluft auch ohne elektrischen
Strom
zu erzeugen. Dazu wurde in der Zuleitung zu den beiden Stromab-nehmern eine Handluftpumpe angeschlossen. Mit die-ser konnte die Druckluft erzeugt werden, dass diese gehoben wurden.
Anschliessend konnte die
Lokomotive
eingeschaltet werden und die beiden
Kompressoren
nahmen die Arbeit auf. Eine Lösung, die damals bei den Lokomotiven üblich
war und die noch viele Jahre beibehalten wurde. Jedoch gab es noch eine
andere Lösung, die wir später kennen lernen.
Kehren wir wieder zu den beiden
Hauptluftbehältern
zurück, diese wurden mit einer Leitung miteinander verbunden. Diese teilte
sich jedoch wieder in zwei Leitungen. Die erste Leitung, die wir uns
ansehen wollen, war die
Apparateleitung.
Sie wurde mit Ausnahme der
Bremsen
für alle Verbraucher auf der
Lokomotive
benutzt. Dazu gehörten sowohl Bauteile der elektrischen Ausrüstung, als
auch andere Verbraucher, die wir ansehen müssen.
Das in der Schweiz typische Signal, konnte daher von geübtem
Personal mit ausreichend
Zugkraft
erzeugt werden. Die
Pfeife
der neuen
Lokomotive
war jedoch nicht mehr so laut, wie jene der alten Dampflokomotiven. Der Grund für das geänderte Klangbild und die geringere Lautstärke rührte vom geringeren Druck her. Es waren die gleichen Modelle, die nun mit Druck-luft, statt mit Dampf betrieben wurden.
Weil damit der Druck auch tiefer war, veränderte sich das
Klangbild der neuen
Lokomotive.
Eine Situation, die aber bei allen elektrischen Lokomotiven zu beobachten
war. Dabei hatte hier jeder
Führerstand
seine eigene
Lokpfeife
erhalten.
Ein zweiter Verbraucher der die
Apparateleitung
und deren
Druckluft
nutzte, waren die bei der
Lokomotive
verbauten
Sandstreueinrichtungen.
Diese war so aufgebaut worden, dass der mitgeführte
Quarzsand
mit Hilfe von
Druckluft
durch eine Leitung vor der ersten
Triebachse
auf die
Schienen
vor beiden
Rädern
geblasen wurde. So konnte mit diesen
Sandern
die
Adhäsion
bei schlechtem Zustand der Schienen erhöht werden.
Es war jedoch nur möglich, jeweils die in Fahrrichtung erste
Achse
über den
Sander
mit
Quarzsand
zu versehen. Eine Einrichtung, die das nachfolgende
Drehgestell
versorgt hätte, gab es nicht. So konnte Gewicht gespart werden und wegen
der installierten
Leistung
wurde auch erwartet, dass die Probleme bei der
Adhäsion
mit dieser Lösung ausreichend behoben werden kann. Ein Ansatz, der auch
auf anderen Baureihen so ausgeführt wurde.
Daher wurden in diesem Fall
Reduzierventile
verbaut, die so die Schwank-ungen bei der
Druckluft
ausgleichen konnten. Genauer auf die Bauteile blicken wir bei der
elektrischen Ausrüstung. Damit kommen wir zur zweiten Leitung. Diese können wir als Speiseleitung ansehen und sie wurde für die Anzeige des Luftdruckes in den Hauptluftbe-hältern genutzt.
Die deutlich grösseren Verbraucher der
Druckluft
waren jedoch die pneuma-tischen
Bremsen.
Diese waren sogar so wichtig, dass wegen ihnen die Systeme mit Druckluft
auf den
Lokomotiven
eingeführt wurden. Es lohnt sich, wenn wir bei den Bremsen etwas genauer
hinsehen.
Ausgerüstet wurde diese
Lokomotive
mit einem pneumatischen System, das oft auch als Doppelbremse nach
Westinghouse
bezeichnet wurde. Wir sehen jedoch etwas genauer hin und so teilen wie die
Doppelbremse in die indirekte
Westinghousebremse
und in die direkt wirkende
Regulierbremse
auf. Beginnen werden wir mit der zuletzt genannten
Druckluftbremse,
da sie deutlich einfacher aufgebaut worden war und einen guten Einstieg
erlaubt.
Bei der
Regulierbremse
wurde über ein
Bremsventil
der
Bauart
Westinghouse
von der
Speiseleitung
stammende
Druckluft
in die Leitung zu den
Bremszylindern
geführt. Gleichzeitig wurde diese Leitung aber auch zu den beiden
Stossbalken
geführt und stand dort jeweils mit zwei
Luftschläuchen
der
Anhängelast
zur Verfügung. Die
Kupplungen
der
Regulierleitung
dichteten diese automatisch ab, wenn der Schlauch nicht gekuppelt wurde.
Waren jedoch Wagen angeschlossen, konnte es sein, dass mit dieser Bremse der genannte Luftdruck nicht erstellt werden konnte.
Ein Aspekt, der dafür sorgte, dass diese
Bremse
nicht als Sicherheits-bremse angesehen werden durfte. Trotzdem hatte sie
eine Berechtigung. Angewendet wurde die Regulierbrem-se bei längeren Talfahrten zur Einhalt-ung der erlaubten Geschwindigkeit.
Das war insbesondere auf der Strecke der
Bahnlinie
nach Schwarzenburg erforderlich. Jedoch konnte diese
Bremse
auch im
Rangierdienst
genutzt werden, da sie sehr feinfühlig reguliert werden konnte. Daher
rührte auch der Name. Jedoch bestand das Problem, dass diese Bremse bei
einer
Zugstrennung
auf den Wagen nicht mehr wirkte.
Aus diesem Grund wurde ein zweites
Bremssystem
eingebaut. Dieses arbeitete mit einer als
Hauptleitung
bezeichneten Druckluftleitung. Dabei wurde diese Leitung ab der Speisung
mit einem
Bremsventil
versorgt. Das
Ventil
war so aufgebaut worden, dass diese
Bremsleitung
auf einen Wert von fünf
bar
gehalten wurde. Auch diese Leitung wurde zu den beiden
Stossbalken
geführt, geteilt und stand dort mit zwei
Luftschläuchen
der
Anhängelast
zur Verfügung.
Die Leitungen für die
Hauptleitung
unterschieden sich sowohl im Aufbau, als auch bei den
Kupplungen
von der
Regulierbremse.
So war hier am
Stossbalken
ein normaler
Absperrhahn
vorhanden. Die Kupplungen waren zudem offen ausgeführt worden. Das führte
dazu, dass eine gekuppelte Hauptleitung bei einer
Zugstrennung
entleert wurde. Die
Bremse
konnte erst wieder gelöst werden, wenn der
Luftdruck
auf den normalen Wert erhöht wurde.
Um eine Verzögerung mit dieser Bremse zu erhalten, muss der Druck in der Hauptleitung auf einen Wert unter 4.6 bar gesenkt werden. Da nun aber der Bremszylinder in die-sem Fall nicht korrekt gearbeitet hät-te, musste auf der Lokomotive ein Steuerventil verbaut werden.
Wegen diesem
Steuerventil
wurde die
Bremse
als indirekt wirkende Bremse bezeichnet. Das hier verbaute Steuerventil stamm-te von Westinghouse und es war bei jedem Drehgestell verbaut worden.
Sie vermuten es richtig, für jeden
Bremszylinder
wurde ein eigenes
Ventil
verwendet. Den notwendigen Platz fand es unter dem Umlaufblech auf der
gegenüberliegenden Seite vom
Hauptluftbehälter.
Somit wurde auch bei den
Bremsen
der verfügbare Platz optimal ausgenutzt, was bei der kurzen
Lokomotive
jedoch besonders wichtig war.
Wegen diesem
Steuerventil
wurde diese
Bremse
als
Westinghousebremse
bezeichnet. Dabei reagierte dieses
Ventil
auf den Abfall des
Luftdruckes
in der
Hauptleitung.
So umgesteuert, leitete das
Bremsventil
schliesslich die in einem Hilfsluftbehälter gespeicherte
Druckluft
zum im
Drehgestell
verbauten
Bremszylinder.
Wurde jedoch der Luftdruck in der Hauptleitung nur geringfügig erhöht,
löste die
automatische Bremse
vollständig.
Damit war das verbaute
Steuerventil
einlösig, was damals jedoch durchaus
üblich war. Hingegen war speziell, dass das
Ventil
dieser
Lokomotive
nicht
auf die
G-Bremse
umgestellt werden konnte. Es wurde immer mit der
Personenzugsbremse und somit mit der normalen
automatischen Bremse
nach
Westinghouse
gearbeitet. Ein Umstand, der jedoch berücksichtigte, dass mit
der Lokomotive nur leichte
Güterzüge geführt werden sollten.
Leichte
Güterzüge wurden bereits damals mit der
P-Bremse geführt. Dabei
konnte mit dem
Steuerventil
bei komplettem Auslass in der
Hauptleitung ein
Luftdruck
von 3.9
bar
erzeugt werden. Wobei das jedoch nur für die
Baureihe Ce 4/6 galt, denn bei den Modellen nach der Reihe Be 4/6, wurde
der Druck im
Bremszylinder auf 4.2 bar erhöht. Eine Massnahme, die jedoch
der höheren Geschwindigkeit geschuldet war und zu verschiedenen
Bremsgewichten führte.
Die
Druckluft
für den
Bremszylinder stammte entweder von der
Regulierbremse, oder von der automatischen
Westinghousebremse. Dadurch
wurde der im
Zylinder verbaute
Kolben ausgestossen und die
Bremsung
eingeleitet. Wurde die
Druckluft
jedoch wieder entfernt, sorgte eine
Rückholfeder dafür, dass der Kolben wieder in seine ursprüngliche Lage
zurückkehrte. Eine andere Möglichkeit die
Bremskraft auszuführen gab es
jedoch hier nicht.
Damit haben wir jedoch die mechanischen
Bremsen
erreicht. Der sich
bewegende
Kolben im
Bremszylinder bewegte ein
Bremsgestänge, das bei allen
Lokomotiven auf die
Triebachsen wirkte. In diesem Gestänge war ein
Bremsgestängesteller eingebaut worden. Dieser konnte in einer Werkstatt so
verstellt werden, dass die in den
Bremsklötzen erzeugte
Bremskraft nahezu
immer eingehalten werden konnte. Eine durchaus übliche Ausführung.
Durch das
Bremsgestänge wurden schliesslich die
Bremsklötze gegen die
Lauffläche der
Triebräder gepresst. Dadurch wurden diese an der freien
Drehung gehindert und die
Lokomotive verzögerte. Da die verbauten
Bremsklötze aus Grauguss bestanden, erfolgte der durch die Reibung
erzeugte Verschleiss bei den Bremsklötzen. Die Klötze nahmen zudem auch
den grössten Teil der erzeugten Wärme auf und sie dienten als
Verschleissteil.
Der Einbau von zusätzlichen Bremsklötzen war zu-dem nicht möglich, da der benötigte Platz vom An-trieb genutzt wurde.
Jedoch reichte die erzeugte
Bremskraft aus um eine übliches
Bremsverhältnis zu erzeugen. Wegen dem
geänderten
Luftdruck, lag dieses bei der Reihe Be 4/6 etwas höher. Durch den Aufbau konnten die Druckluftbremsen bei Ausfall der Versorgung mit Druckluft versagen. Zu-dem haben wir erfahren, dass das Steuerventil ein-lösig war. Das hätte bei einem längeren Stilllager zu einer ungebremsten Lokomotive geführt.
Ein Umstand, der jedoch verhindert werden
musste, da die Maschine nicht immer auf einem ebenen
Gleis
abgestellt
werden konnte. Daher musste eine Lösung her, die rein mechanische wirkte. In jedem Führerstand wurde daher eine Handbremse verbaut. Diese wirkte direkt auf das Bremsgestänge. So konnten die Bremsklötze der Klotzbremse ohne die Hilfe von Druckluft angezogen werden. Damit sich diese Handbremse nicht ungewollt löste, war sie mit einer Lochscheibe und einem Stift ver-sehen worden.
Aus diesem Grund konnte die
Handbremse
auch als
Feststellbremse genutzt werden. Ein Umstand der bei einer längeren
Abstellung wichtig war.
Zum Schluss bleibt nur noch zu erwähnen, dass die beiden
Handbremsen der
Lokomotive auf alle gebremsten
Achsen wirkten. Daher konnte mit diesen
Bremsen
eine grosse
Bremskraft erzeugt werden. Das erlaubte, die
Lokomotive auch auf dem steilsten Abschnitt der befahrenen Strecke
abstellen zu können. Wichtig war das auf der
Bergstrecke am Lötschberg,
aber auch in den
Rampen nach Schwarzenburg, die durchaus ansehnlich waren.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Erzeugt
wurde die
Erzeugt
wurde die  Der
Der
 Einer
dieser Verbraucher war die auf dem Dach des Kastens montierte
Einer
dieser Verbraucher war die auf dem Dach des Kastens montierte
 Bei
den elektrischen Bauteilen, die an der
Bei
den elektrischen Bauteilen, die an der
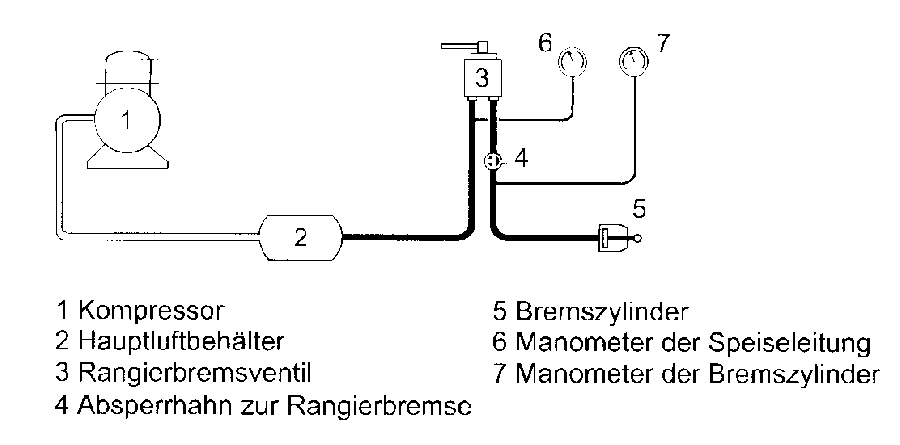 Mit
der
Mit
der
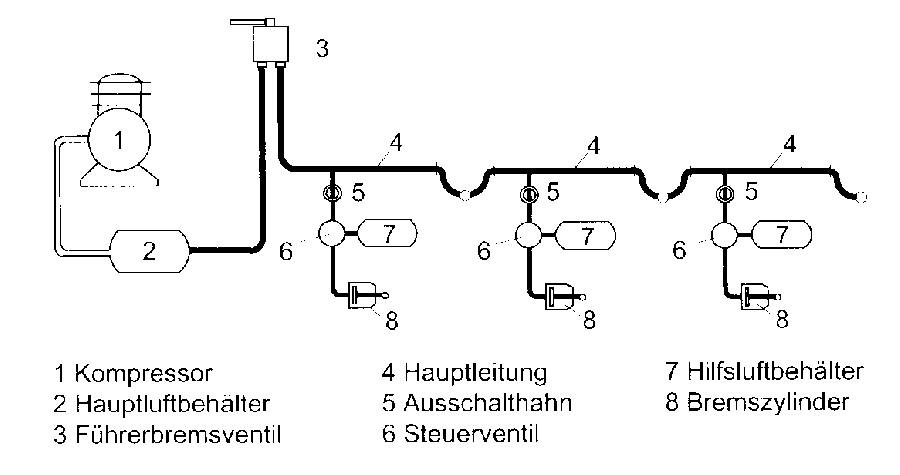 Mit
einem
Mit
einem 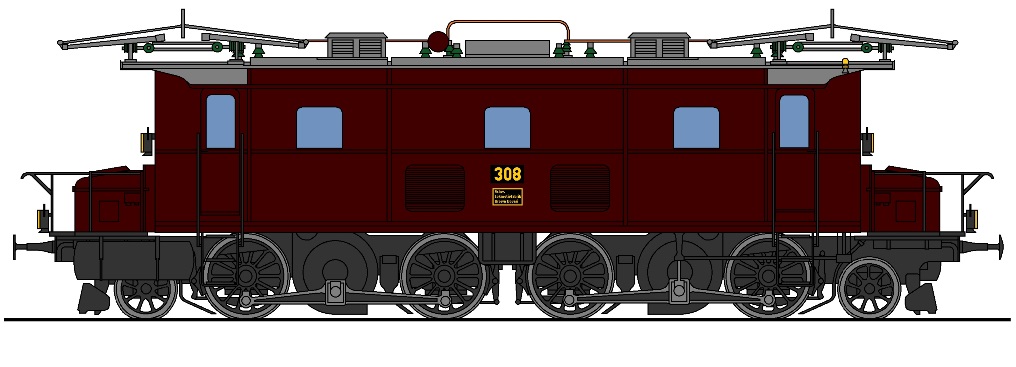
 Jedes
Jedes