|
Beleuchtung und Steuerung |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Sowohl für die
Beleuchtung,
als auch für die Steuerung wurde eine elektrische
Spannung
benötigt. Die Zeiten, wo zur Beleuchtung
Karbidlampen
benutzt wurden, waren längst vorbei. Daher lohnt es sich, wenn wir diese
etwas genauer ansehen. Da auch bei einer
Diesellokomotive
die Funktionen in diesem Bereich funktionieren mussten, wenn der
Dieselmotor
abgestellt wurde, war ein eigenes Netz vorhanden. Es gab deshalb kaum
Unterschiede zu anderen Baureihen.
Bei Fahrzeugen hatten sich die
Bleibatterien
durch-gesetzt und es gab kaum bessere Alternativen dazu. Jedoch waren
diese Baugruppen schwer und erst noch anfällig auf die Bildung des
explosiven Wasser-stoffes. Daher musste der Einbau entsprechend er-folgen. Die Bleibatterien wurden mit Einschüben in den da-für vorgesehenen beiden Kästen in der Lokomotiv-brücke platziert. Dank den vorhandenen Einschüben konnten die schweren Batterien leicht aus dem Fah-rzeug gezogen werden. Das war für den hier erforderlichen
Unterhalt wichtig, aber auch bei einem Wechsel, den die Baugruppen konnte
so einfach abgehoben werden. Notfalls ging der Tausch der
Batterien
sogar auf einer Baustelle, oder in einem
Bahnhof. Bei der Wahl der
Batterien
wurde darauf geachtet, dass nicht neue Baugrössen verbaut wurden. Es kamen
daher die üblichen für 18
Volt
ausgelegten Behälter zu Anwendung. Insgesamt wurden davon vier Stück
eingebaut und in Reihe geschaltet. Damit stieg die
Spannung
auf einen Wert von 72 Volt. Im Vergleich zu den alten
Diesellokomotiven,
wurde die Höhe damit etwas reduziert, aber auch der höhere Bedarf bei der
Leistung
berücksichtigt. Jedoch bestand auch hier das Problem, dass
die
Bleibatterien
ohne entsprechende Massnahmen mit der Zeit entladen wurden. Das Problem
war hier jedoch noch grösser, als bei den elektrischen
Lokomotiven. Der Grund ist, dass dafür der
Dieselmotor
gestartet werden musste. Dieser Vorgang war für die
Batterien
eine sehr grosse Belastung. Daher war es wichtig, dass danach die Ladung
derselben sofort eingeleitet wurde.
Erst dann konnte der
Dieselmotor
mit Hilfe der
Batterien
gestartet wer-den. Dazu war ein Elektromotor vorhanden. Dieser bewegte
lediglich die
Kurbelwelle
und startete so den Dieselmotor. Lief der Dieselmotor korrekt, wurde der Anlasser wieder abgestellt. Durch die sich nun drehende Kurbelwelle wurde der Hilfsgenerator über die Keilriemen in Gang gesetzt. Dieser besass für die Batterieladung eine zweite Wicklung. So wurde eine
Spannung
von 80
Volt
Gleichstrom
abgegeben. Der Lade-strom betrug nun 100
Ampère
und damit wurden die
Batterien
wieder geladen. Die
Leistung
reichte jedoch auch um die
Beleuchtung
und die Steuerung zu versorgen. Beginnen wir mit der Beleuchtung. Diese stand auf der Lokomotive teil-weise auch zur Verfügung, wenn die Steuerung noch nicht aktiviert wurde. Das galt insbesondere für die im Führerhaus verbauten Lampen. So konnte das
Lokomotivpersonal
die Arbeiten bei Licht ausführen. Jedoch gab noch weitere Lampen und diese
wurden zum Teil von der Steuerung überwacht. Dazu gehörten Leuchten in den
Instrumenten
und in den
Vorbauten. Auch die
Dienstbeleuchtung
war teilweise durch die Steuerung geregelt. Die drei bei jeder
Front
montierten Lampen wurden in Form eines A angeordnet. Dabei wurden die
beiden unteren Modelle über den
Puffern
am Bodenblech angebracht. Die dritte Lampe fand ihren Platz jedoch an den
Vorbauten
und dort wurde sie an der Kante angebracht. Durch gab es eine eher
gedrängtes Spitzensignal, aber das war bei Modellen mit Vorbau üblich.
So konnten Ersatzteile reduziert werden.
Ein Punkt, den vielen Bahnen über Jahre erfolgreich ange-wendet haben.
Auch der in Spanien ansässige Her-steller wurde mit den Lampen aus der
Schweiz be-liefert. Diese Modelle stammten aus dem Strassenverkehr und sie wurden von den LKW übernommen. Ledig-lich das seitlich vorhandene gefärbte Glas war hier rot. Dieses wurde an der äusseren Seite angeordnet. Oben, wo nur eine Lampe vorhanden war, wurde das rote Glas rechts positioniert. Damit konnte die
Lokomotive alle damals in der Schweiz im
RS üblichen
Signalbilder
zeigen. Ausser den Farben rot und weiss, gab es keine mehr. Obwohl alle drei weissen
Scheinwerfer
von
Abblendlicht
auf
Volllicht
umgestellt werden konnten, wurde diese Funktion nur bei den beiden unteren
Modellen umgesetzt. Wie und ob die Lampe leuchtete, wurde im
Führerstand
durch das
Lokomotivpersonal
eingestellt. Da die Lampen jedoch im
Rangierdienst
zu hell waren, wurden sie mit den Halterungen für die dort verwendeten
Vorsteckgläser versehen. Damit war auch diese
Beleuchtung
kein Problem. Wir kommen damit zur Steuerung der
Lokomotive. Diese hatte die Aufgabe, die vom
Lokomotivpersonal
verlangten Anforderungen auszuführen. Wie das genau zu erfolgen hatte,
werden wir bei der Bedienung kennen lernen. Hier soll nur der Hinweis auf
diesen Punkt gemacht werden. In diesem Kapitel ist jedoch der zweite Teil
der Aufgaben wichtiger, denn die Steuerung hatte auch die korrekten
Funktionen zu überwachen.
Dieses kontrollierte die Parameter und gab
diese mit einer
Meldung
an das Personal aus. Um welche Anzeigen es sich dabei handelte, hing davon
ab, welche Werte das
Lokomotivpersonal
angezeigt haben wollte. So konnte dieses einige Betriebs-stände
kontrollieren. Weiter übernahm das Diagnosesystem auch die Überwachung der Funktionen. Das galt sowohl für den Dieselmotor, als auch für die elektrische Ausrüstung. Wurden in den beiden Bereichen die Werte in einer kritischen Weise überschritten, wurde die Steuer-ung aktiv. Dabei wurden sofort die entsprechenden
Mass-nahmen umgesetzt. Das konnte zum Beispiel be-deuten, dass der
Dieselmotor
wegen einem Defekt abgestellt wurde. Gleichzeitig erschien auf dem
Diagnosedisplay im
Führerstand
die entsprechende Störungsmeldung. Anhand der dort enthaltenen Angaben
konnte das Personal die erforderlichen Abtrennungen vornehmen. So konnten
Störungen schnell und einfach behoben werden. Bei geringfügigen Problemen
konnte die
Lokomotive eventuell noch eingesetzt werden. Es konnte aber
auch vorgeschlagen werden, dass das Fahrzeug ausser Betrieb genommen
werden muss. Auch wenn vom Bedienpersonal die
Lokomotive mit der Behebung der Störung weiter betreiben
konnte, speicherte das
Diagnosesystem
den Schaden, aber auch die Schritte der Behebung. Dieser Speicher blieb
auch erhalten, wenn die Maschine remisiert werden musste. So war
gesichert, dass die Behebung in einer Werkstatt schnell erfolgen konnte.
Insbesondere die Standzeiten sollten so verringert werden können.
Mit dem passenden Kabel und der
entsprechenden Software konnten die Daten auch auf der Strecke auf einen
tragbaren PC übertragen werden. So war es der Werkstatt möglich das
defekte Teil schnell zu erkennen und dieses anschliessend zu ersetzen. Im vorderen Vorbau war auch eine Brandmeldeanlage verbaut worden. Gerade im Bereich des heissen Motors und der doch mehr oder weniger brennbaren Flüssigkeiten in diesen Be-reich ein Vorteil. Wie wichtig diese Anlage letztlich wurde,
erkennen wir später. Insbesondere bei Einsätzen, wo das
Lokomotivper-sonal
auf der
Diesellokomotive
fehlte, kam dem Brandschutz eine wichtige Rolle zu, denn der Mensch vor
Ort fehlte schlicht. Verlangte das
Lokomotivpersonal
mit den Fahrbremsschalter eine Veränderung der Verhältnisse, wurde das
Fahrzeugleitgerät «AME 15» aktiviert. Dieses regelte nun die Drehzahl des
Dieselmotors
und damit indirekt auch den
Umrichter.
Für die dort erforderlichen Schaltungen war schliesslich das
Antriebsleitgerät «Agate» zuständig. Damit übernahmen diese beiden Systeme
die Regelung, so dass der Dieselmotor immer optimal arbeiten konnte. Die Steuerung überwachte jedoch nicht nur
die Technik, sondern auch das Personal. Solche Massnahmen hatten sich
mittlerweile durchgesetzt und konnten auch bei
Lokomotiven, die vorwiegend im Bau- oder
Rangierdienst
eingesetzt wurden, nicht mehr weggelassen werden. Dabei kamen die in der
Schweiz üblichen Systeme zur Anwendung. Wir beginnen mit der Kontrolle, ob
das
Lokomotivpersonal
noch seine Arbeit verrichten konnte.
Reagierte das
Lokomotivpersonal
auf weiteren 50 Metern nicht darauf, wurde eine
Zwangsbremsung
eingeleitet und im
Strom-richter
eine
Fahrsperre
erzeugt. Der
Dieselmotor
wechselte da-her in den Leerlauf. Nach der Rückstellung durch das Personal, konnte die Bremsung aufgehoben werden. Auch die Fahrsperre löste sich und die Fahrt konnte ungehindert fortgesetzt werden. Einmal täglich wurde dies geprüft. Daher war der Vorgang normal. Trotzdem konnte es auch passieren, dass die
Einrichtung be-tätigt wurde, aber das
Lokomotivpersonal
trotzdem nicht mehr reaktionsfähig war. Daher musste auch dieser Umstand
berück-sichtigt werden. Diese Wachsamkeitskontrolle wurde mit dem Langsamgang um-gesetzt. Dieser war jedoch so aufgebaut worden, dass ver-schiedene Handlungen eine Rückstellung zu Folge hatten. Das führte dazu, dass davon im
Rangierdienst
nichts bemerkt wurde. Jedoch bei Fahrten auf der Strecke sprach die
Kontrolle an und gab einen akustischen Warnton aus. Ohne Reaktion durch
das Personal kam es auch jetzt zu einer
Zwangsbremsung
und dem vom
Schnellgang
bekannten Verhalten der
Lokomotive. Auch wenn der Betriebseinsatz für die
Lokomotive in erster Linie
Rangierdienste
vorsah, wurde auch die aktuellste Ausrüstung für die
Zugsicherungen
verbaut. Gerade bei den Einsätzen für den Baudienst war sie wichtig, da
die Fahrten zu den Baustellen immer wieder als Zug geführt wurden. Dabei
setzte der Hersteller auch hier die Vorgaben der Schweizerischen
Bundesbahnen SBB um. Ist ja klar, die neue Maschine musste zur Strecke
passen.
Wobei ganz mittig waren sie auch wieder
nicht, sondern leicht nach vorne verschoben worden. Die
Zugsicherung
der Schweiz erlaubte diese Lösungen, die bei den meisten
Lokomotiven der Schweiz so gelöst worden war. Die Wirkweise der Zugsicherung war so aufgebaut worden, dass sie den anderen Baureihen entsprach. Bei «Warnung» wurde durch die Steuerung die Meldelampe gelb aktiviert und gleichzeitig ein aku-stisches Signal ausgelöst. Die
Sicherheitssteuerung
löste letztlich die
Zwangs-bremsung
aus. Keine Reaktionszeit und auch keine Möglichkeit der Rückstellung
während der Fahrt war jedoch bei der
Haltauswertung
vorhanden. So war die
Lokomotive auf dem aktuellen Stand. Da nur wenige Jahre vor Auslieferung dieser
Diesel-lokomotiven
für den Baudienst die Schweizerischen Bundesbahnen SBB beschlossen hatten,
dass auf dem gesamten Netz die Zugbeeinflussung
ZUB 121
verbaut werden sollte, wurde auch diese Maschine damit ausgerüstet. Die
hier erforderlichen
Zugdaten
konnten am
Funkgerät
für den
Zugfunk
eingegeben werden. Das ist jedoch ein Teil der Bedienung und wird später
vorgestellt werden. Bei der kurzen Vorstellung der
Brandschutzanlage wurde es bereits angetönt. Die
Lokomotive konnte auch ferngesteuert werden. Dabei war
dieser Bereich durchaus umfangreicher, als das bei anderen Baureihen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB der Fall war. Jedoch beginnen wir auch
hier mit dem bekannten Bereich und das war die klassische
Vielfachsteuerung.
Eine Einrichtung, die in der Schweiz seit Jahren angewendet wurde.
Da es im Bestand keine passenden Maschinen und Steuerwagen gab, galt dies jedoch nur für Modelle, der Baureihe Am 841. Dabei wurden die Signale für die
Mehrfachtraktion mit einem
Vst-Kabel,
das in die Steckdosen bei den
Stossbalken
passte auf die anderen
Lokomotiven übertragen. Beeinflusst wurde jedoch nur das Fahrzeugleitgerät der ferngesteuerten Maschinen. Das bedeutete, dass man nach dem Kuppelvorgang zuerst alle Lokomo-tiven, die an der Vielfachsteuerung angeschlossen waren, manuell starten musste. Das galt zudem auch für die
Federspeicherbremse,
die auf jedem Fahrzeug der
Vielfachsteuerung
ge-löst werden mussten. Damit die
Lokomotiven im System erkannt werden konnten, war ein
Daten-Bus vorhanden. Wurde ein
Fahrpult
und somit eine
Lokomotive akti-viert, bemerkte die Steuerung die anderen
Fahrzeugleitgeräte, die nun angeschlossen waren. Damit wurde die bediente
Maschine im System zum
Master.
Die restlichen Lokomotiven wurden hingegen als
Slave
bezeichnet. Damit war die
Vielfachsteuerung
bereits betriebsbereit und die Reihe Am 841 konnte im gewohnten Rahmen
bedient werden. Es war daher ein sehr einfaches System. Neu war jedoch die verbaute
Funkfernsteuerung.
Diese erlaubte es die
Lokomotive auch ab einer anderen Stelle zu bedienen. Die
Einrichtung wurde von der Firma ATB Luzern AG geliefert und entsprach dem
Typ TCR 100L. Diese Firma verfügte über eine grosse Erfahrung mit solchen
Systemen und lieferte für die Reihe Am 841 sowohl den Empfänger auf der
Lokomotive, als auch den Sender für das Personal. Wie die Baureihe nun
bedient wurde, ist jedoch Teil der Bedienung.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2022 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
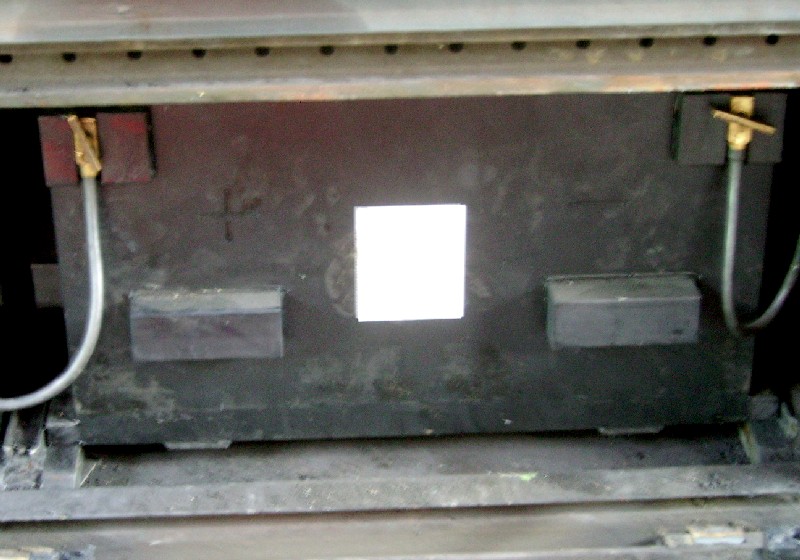 Versorgt
wurde dieses unabhängige
Versorgt
wurde dieses unabhängige
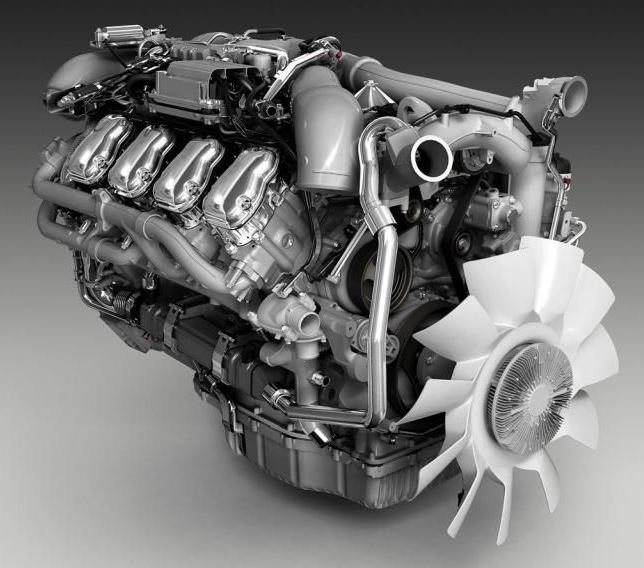 Der
Startvorgang für den
Der
Startvorgang für den
 Bei
der Ausführung der einzelnen Lampen gaben die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB vor, welche Modelle verbaut werden. Daher wurden auch bei dieser
Baureihe die Lampen verbaut, wie sie schon bei anderen Baureihen verwendet
wurden.
Bei
der Ausführung der einzelnen Lampen gaben die Schweizerischen Bundesbahnen
SBB vor, welche Modelle verbaut werden. Daher wurden auch bei dieser
Baureihe die Lampen verbaut, wie sie schon bei anderen Baureihen verwendet
wurden.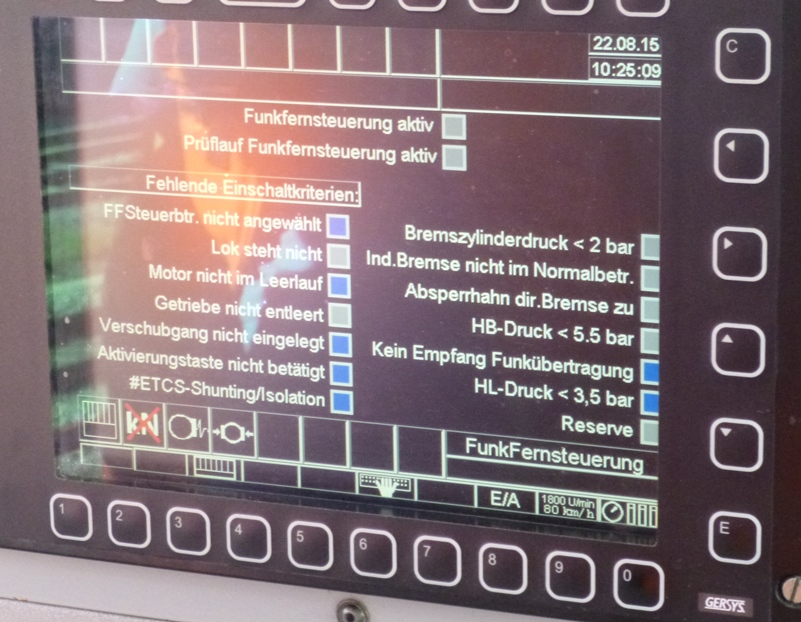 Die
Überwachung durch die Steuerung erfolgte in dem Moment, wenn durch das
Die
Überwachung durch die Steuerung erfolgte in dem Moment, wenn durch das
 Um
detaillierte Daten zur Störung und zu den Betriebszu-ständen zu erhalten,
konnte am
Um
detaillierte Daten zur Störung und zu den Betriebszu-ständen zu erhalten,
konnte am
 Dazu
wurde auf der Maschine die bekannte
Dazu
wurde auf der Maschine die bekannte
 Es
war die
Es
war die
 Eine
Eine