|
Betriebseinsatz 1952 - 1962 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Vorerst wurden die neuen
Triebwagen
mit einer
Höchstgeschwindigkeit
von 100 km/h eingesetzt. Dieser Wert war im
Pflichtenheft
festgelegt worden und daran wollte man trotz der guten Laufruhe bei hohen
Geschwindigkeiten nicht rütteln. Im Betrieb war das jedoch kein Nachteil,
denn kaum ein Zug fuhr damals wirklich viel schneller. Einzig die Reihe
Re 4/4
erreichte mit den Städteschnellzügen 125 km/h. Der Rest begnügte sich mit
100 km/h.
Die dort abgelösten Triebwagen Ce 4/6 und Fe 4/4 wurden in der Folge aus dem Tessin abgezogen, da sie für die steilen Hauptstrecken nicht unbe-dingt geeignet waren.
Dort kamen die ersten
Pendelzüge
mit
Lokomotive
Re 4/4
zum Einsatz. Der Gotthard hatte damit modernes
Roll-material
erhalten. Ab dem Depot Bellinzona besorgten zwei CFe 4/4 zusammen mit je einem Steuerwagen ab 1953 den Verkehr mit Pendelzügen nach Locarno. Dabei er-reichten sie tägliche Leistungen von 400 Kilometern.
In Anbetracht der kurzen Distanz der beiden Städte, stellt das
eine ausser-ordentliche
Leistung
der
Triebwagen
dar. Dabei wurden neben dem
Regionalverkehr
auch vereinzelte
Schnellzüge
als Anschluss an den Gott-hard geführt.
Der dritte
Triebwagen
wurde als
Lokomotive
eingeteilt und auch so eingesetzt! Er führte mit einer täglichen Distanz
von 285 Kilometer, Züge nach Biasca und Giubiasco. Daneben war er zwischen
Biasca und Airolo auch als
Vorspannlokomotive
eingeteilt worden. Gerade diese
Vorspanndienste passten nicht so recht zu einem Triebwagen, der
für
Nebenstrecken
beschafft wurde. Daher müssen wir einen etwas genaueren Blick darauf
werfen.
Zugeteilt waren diesem
Triebwagen
der
Güterzug
805 und die
Schnellzüge
57, 65 und 67. Obwohl die
Normallast
mit 140 Tonnen eher bescheiden war, wurde der CFe 4/4 auf der Strecke
benötigt. Der Grund war, dass diese Züge für die eingeteilten
Lokomotiven
nur knapp zu schwer waren. Statt für ein paar Tonnen eine wertvolle
Maschine zu verwenden, wurde der vorhandene Triebwagen, der so oder so ein
Stilllager hatte, dazu benutzt.
Da die
Triebwagen
sowohl bei MFO, als auch bei der SAAS montiert wurden, hielten sich die
Abliefer-ungen nicht an die Reihenfolge der Nummern. Im Jahre 1953 wurden
daher auch die Nummern 845 bis 853 geliefert. Sie wurden nach dem Muster
des 841 gebaut und mussten später noch angepasst werden. Daher tauchten
diese bei der
Inbetriebsetzung
nicht auf, da sie anderweitig eingesetzt wurden. Wobei natürlich immer
wieder Lücken vorhanden waren.
Stationiert waren diese CFe 4/4 in den
Depots
Lausanne und Olten. Sie verkehrten dabei oft im Wechsel mit den alten
Triebwagen
und wurden noch nicht in eigenen Diensten geführt. So fehlten im Raum
Olten die entsprechend vorgesehen Strecken zum Teil noch. Auf der Linie
über den Hauenstein wurde die
Fahrleitung
am 04. Oktober 1953 in Betrieb genommen. Damit stand neben der
National-bahn
auch die andere für CFe 4/4 vorgesehen Strecke bereit.
In Lausanne sah es ähnlich aus. Wobei hier die vorhandenen
Triebwagen
schnell ihre vorgesehenen Strecken besetzten. Die Anzahl jedoch noch nicht
ausreichte und man daher noch auf die alten Triebwagen setzen musste. So
war nur das Tessin, das vorerst mit reinen Dienstplänen für CFe 4/4
aufwarten konnte. Gerade diese drei Dienste, hatten spezielle Aufgaben,
die auf den anderen Strecken schlicht nicht zu erwarten waren.
1954 wurde der Spätzug 2641 in die beiden Locarno Umläufe
eingebunden, und der einzelne
Triebwagen
hatte mit täglichen 605 km neben kleinen
Leistungen
im Tessin auch weiterhin Einsätze als
Vorspannlokomotive
vor der Baureihe Ae 4/6 zu
erbringen. Dabei kam er sogar bis nach Göschenen und damit planmässig
erstmals in die deutschsprachige Schweiz. Es bleibt aber dabei, dass
dieser Triebwagen nicht seinem angedachten Zweck diente.
Sicherlich handelte es sich hier um keinen Einsatz, den sich die
Erbauer für dieses Fahrzeug ausgedacht hatten. Dass diese
Vorspanndienste nicht nur auf dem Papier existierten,
berichteten ältere Erstfelder Lokomotivführer, die oft den CFe 4/4 hinten
hatten, weil die
Lokomotive
Ae 4/6 als Titularlok vorne
eingereiht werden musste. Selber auf dem
Triebwagen
zum Einsatz kamen sie jedoch nicht, da die
Leistung
von Bellinzona abgedeckt wurde.
Ebenfalls im Jahre 1954 wurden die Nummern 844, 854 bis 858, 864
bis 867 und 869 bis 871 ausgeliefert. Damit konnten nun in allen drei
Kreisen
die
Triebwagen
eigene Dienste übernehmen. Dazu gehörte zum Beispiel im Kreis III ab
Winterthur die Strecke nach Schaffhausen durch das Weinland. Es ging aber
auch ins Tösstal. Womit hier
Nebenstrecken
abgedeckt wurden. Wenn Lücken gefüllt werden konnten, wurden aber auch
Hauptstrecken
befahren.
Es muss jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB zu jener Zeit an einem akuten Mangel an
Triebfahrzeugen
litten. Es wurde einfach das genommen, was gerade herum stand. Gerade am
Gotthard, wo die
Normallasten
oft um wenige Tonnen überschritten wurden, konnte das auch ein
Nebenlinien-Triebwagen
sein. Der CFe 4/4 bewährte sich anscheinend auch in solchen Aufgaben.
Daher sollte nun vor dem
Fahrplanwechsel
im Frühjahr eine Bereinigung durchgeführt werden. Daher sehen wir uns die
Standorte mit den
Dienstplänen
genauer an.
Ab Lausanne wurden die
Triebwagen
mit den Nummern 846 bis 848 und 862 bis 866 in fünf
Pendelzügen
eingesetzt. Diese Pendelzüge des
Kreises
I verkehrten auf den Strecken Fribourg – Yverdon, Lausanne – Nyon,
Lausanne – Lyss und Lausanne – Vallorbe ohne Zwischenwagen. Mit einem
Zwischenwagen verkehrten die Züge auf der Strecke Le Locle – Neuchâtel.
Mit einem zweiten Zwischenwagen wurde die Strecke Genève – Lausanne –
Palézieux befahren.
Die restlichen drei
Triebwagen
verblieben in Einzeldiensten und bildeten die Reserve für die in
Pendelzügen
verkehrenden Triebwagen. Die Dienste brachten die Triebwagen bis nach
Lyss, Biel, Bern und Brig. Dabei wurden die Züge als
Lokomotive
bespannt, was auch leichte
Güterzüge
bedeutete. Bemerkenswert ist dabei die Fahrt durch das Rhonetal. Die
durchschnittliche Tagesleistung der Lausanner CFe 4/4 betrug dabei 493
Kilometer.
Immer noch bedeutete das, dass auch Leistungen auf der Südrampe abgedeckt wurden. Wobei hier mit den ersten Lokomotiven der Reihe Ae 6/6 einzelne Dienste vor den Schnellzügen verschwun-den waren.
Die in Olten stationierten Triebwagen mit den Nummern 844, 845 und 854 bis 861 kamen hauptsächlich ab Aarau und Olten zum Einsatz. Vier Pendelzüge des Depots Olten fuhren mit Per-sonenzügen nach Basel, Luzern, Zürich, Arth-Goldau und über Läufelfingen nach Sissach.
Dabei erbrachten sie eine tägliche
Leistung
von 462 Kilometern. Damit lagen diese Leistungen im Be-reich des
Kreises
I und stellten einen guten Wert dar.
Die restlichen vier
Pendelzüge
des
Depots
Olten fuhren
Leistungen
ab Aarau. Diese Züge fuhren über Suhr nach Zofingen und Wettingen, aber
auch über Muri AG nach Arth-Goldau. Ein einzelner
Triebwagen
fuhr ab Aarau nach Zürich und Solothurn. Dabei erbrachten die Aarauer Züge
eine tägliche Fahrleistung von 364 km. Wobei hier mit dem einzeln
eingesetzten Triebwagen auch der Ersatz für die in Pendelzügen
eingesetzten Modelle diente.
Im
Depot
Winterthur wurden noch die
Triebwagen
mit den Nummern 849 bis 853 und 867 bis 871 eingesetzt. Die
Pendelzüge
des
Kreises
III verkehrten 1956 mit
Eilzügen
ab Winterthur nach Basel, Zürich und Schaffhausen und Romanshorn. Dazu
kamen noch Personenzüge über Bauma nach Rapperswil und über St. Gallen
nach Sargans. Die einzelnen Triebwagen befuhren mit Personenzügen die
Strecken über Bauma nach Hinwil und nach Rüti. Die tägliche
Leistung
betrug im Durchschnitt 337 Kilometer.
An jedem Standort gab es somit
Triebwagen,
die nicht in
Pendelzügen
verkehrten. Das hatte zwei Gründe. So dienten diese Triebwagen als
Reserve, da sie leicht durch eine
Lokomotive
ersetzt werden konnten. Zudem fehlte für diese Triebwagen schlicht ein
passender
Steuerwagen.
Somit konnten diese nicht verpendelt werden. Bei Bedarf wurden diese
Triebwagen auch zwischen den einzelnen
Depots
verschoben, wobei das Tessin eine Ausnahme bildete.
Die Einsätze als
Vorspannlokomotive
entfielen nun und der
Triebwagen
kam seinem Zweck immer näher. Bei den
Pendelzügen
änderte sich nichts, sie blieben im Einsatz zwischen Locarno und
Bellin-zona. Ab 1958 bekamen die Triebwagen der Schweizer-ischen Bundesbahnen SBB neue Nummern zugeteilt. In der Folge trugen die Fahrzeuge der Baureihe CFe 4/4 die Nummern 1621 bis 1651.
Die Umbezeichnung war nötig geworden, da man bei den
Staatsbahnen
begann, den
Triebwagen
vier-stellige Nummern zu geben.
Lokomotiven,
die
Re 4/4,
bekamen generell fünfstellige Nummern zuge-teilt. Ein eigentlicher Umbau
fand jedoch nicht statt. Kurz nachdem die Nummern auf Anfang Jahr geän-dert wurden, bekamen die Triebwagen neue Be-zeichnungen.
Mit der Aufhebung der ersten
Wagenklasse
wurden die Abteile der verbliebenen Wagenklassen aufgewertet. So hatte der
Triebwagen
neu Abteile der zweiten Wagenklasse. Die Triebwagen waren daher zu BFe 4/4
geworden. An den Einsätzen änderte sich damit jedoch nichts, denn die
Leistungen
waren fest zugeteilt.
Die
Steuerwagen
mutierten gar zu den Typen ABt. Dabei verschwand auch das 4ü und eine
neuartige Nummer trat an deren Stelle. Die Nummern lauteten in der Folge
50 85 37 – 03 900 bis 919. Hier erfolgte somit die neue Bezeichnung nach
den Vorgaben der
UIC.
Diese UIC-Nummern sollten die Steuerwagen nie mehr abgeben, denn es war
deren letzter Wechsel. Bei den passenden
Triebwagen
sollte das jedoch noch nicht der Fall sein.
In der Zeit von 1958 bis 1960 hatten die
Triebwagen
des
Depots
Olten erstmals eine bemerkenswerte
Leistung
mit
Schnellzügen
im Plan. Die 1955 begonnene Verpendelung der Schnellzüge Bern – Luzern
verschaffte den Oltener BFe 4/4 notgedrungen einen Schnellzug! Der Betrieb
verlangte, dass ab 1958 eine zusätzliche
Komposition
für die Züge 357/362 eingesetzt wird.
Lokomotiven
standen für den zusätzlichen
Pendelzug
jedoch nicht mehr zur Verfügung.
Da jedoch keine Re 4/4 mit Pendelzug mehr zur Verfügung stand, wurde diese Leistung in den Umlauf der Oltener BFe 4/4-Pendelzüge eingebaut.
Nur, der Dreiwagenzug genügte nicht, es mussten da-her
Verstärkungswagen eingesetzt werden. Zum Um-stellen der Wagen in Bern
reichte die Zeit offenbar aus. Der erste Umbau der BFe 4/4 wurde ab 1958 im Rahmen einer Revision nach Massgabe der Kilometer-stände durchgeführt. Da er auch eine Anpassung der Vielfachsteuerung um-fasste, wurden die umgebauten Trieb- und Steuer-wagen zuerst alle dem Kreis III, dann auch dem Kreis I und erst zuletzt dem Kreis II zugewiesen.
Damit konnten eine gewisse Zeit die Fahrzeuge nicht getauscht
werden, da die Trieb- oder
Steuerwagen
nicht passten.
Die Zuteilung zu den
Depots
geriet während dem Umbau etwas durcheinander und wurde erst auf den
Fahrplanwechsel
im Sommer 1962 bereinigt. Dabei wurden die
Triebwagen
mit den Nummern 1621 bis 1628 in Lausanne stationiert. Olten erhielt die
Triebwagen mit den Nummern 1629 bis 1638. Für Winterthur fielen letztlich
die BFe 4/4 mit den Nummern 1639 bis 1651 ab. Dabei waren die Triebwagen
aus dem Tessin ab 1960 in Olten gelandet.
Im Jahre 1960 wurden daher die
Triebwagen
im Tessin abgezogen. Die Züge wurden von verpendelten
Lokomotiven
Re 4/4
übernommen. Das Intermezzo am Gotthard endete deshalb bereits nach fünf
Jahren und die Triebwagen verschwanden vom Gotthard. Sie konnten auf den
diversen
Nebenstrecken
im
Flachland
besser eingesetzt werden. Zudem verlangte der Verkehr im Tessin auch nach
längeren Zügen, die der Triebwagen auf den Steigungen nicht mehr schaffte.
Ab dem Jahre 1963 erhielten die
Triebwagen
die heute bekannte Bezeichnung BDe 4/4, da die
UIC
für die Bezeichnung der
Gepäckwagen
statt dem bisherigen F den Buchstaben D festgelegt hatte. Bereits früher
wurde die dritte
Wagenklasse
in der Schweiz aufgehoben, wodurch es zum kurzen Zwischenspiel als BFe 4/4
gekommen war. Es sollte damit die letzte neue Bezeichnung sein, die diesen
Triebwagen betreffen sollte.
Die Wagen wurden aus den
Einheitswagen
EW I abgeleitet und waren umschaltbar, so dass sie sowohl mit BDe 4/4 als
auch mit
Re 4/4
eingesetzt werden konnten. Das wurde jedoch erst vollumfänglich möglich,
als sämtliche
Triebwagen
auf das System IIIb umgebaut wurden. Nun aber konnten sämtliche Züge mit
BDe 4/4 verpendelt werden, was die vorhandene Reserve bei dieser Baureihe
weiter reduzierte. Die Triebwagen funktionierten zu gut.
Um wieder zum eigentlichen Fahrzeug dem BDe 4/4 zurück zu
gelangen, sei hier erwähnt, dass sich an der Zuteilung ab 1962 über viele
Jahre nichts mehr geändert hatte. So verkehrten die Züge des
Kreises
I auf verschieden Strecken im Jura und anderen Strecken. Dank den neuen
Steuerwagen
waren nun bis auf einen
Triebwagen
alle BDe 4/4 verpendelt und verkehrten mit einer unterschiedlichen Anzahl
Zwischenwagen aus dem Pool der
Leichtstahlwagen.
Noch immer war ein
Triebwagen
als
Lokomotive
eingeteilt. Dieser verkehrte im Traverstal und bespannte zwischen
Neuchâtel und Bern einen über die Strecke der BN geführten Schnellzug. Die
Rückleitung erfolgte mit dem
Schnellzug
951 von Bern über Neuchâtel bis nach Pontarlier. Dort wurden die Wagen an
die SNCF übergeben, die den Zug schliesslich nach Paris brachte. Somit war
im
Dienstplan
auch ein internationaler Zug enthalten.
Neben den bekannten
Nebenstrecken
wurde mit einem
Pendelzug
sogar noch ein
Schnellzug
zwischen Basel und Brun-nen abgedeckt. So besassen auch die BDe 4/4 des
Kreises
II im-mer noch einen Schnellzug, was bemerkenswert war. Der einzelne Triebwagen diente als Reserve und wurde in einem Dienstplan geführt, der für die Lokomotiven der Bau-reihen Ae 3/5 oder Ae 3/6 ausgelegt wurde. Er verkehrte daher im Raum Solothurn, Olten, Aarau und Lenzburg.
Teilweise im leichten
Güterverkehr.
Zudem war noch eine
Leistung
bis nach Göschenen vorgesehen, bei der sogar öfters der
Triebwagen
BDe 4/4 wegen der
elektrischen
Bremse
ver-wendet wurde.
Im
Kreis
III vollzog sich eine ähnliche Entwicklung. Noch Mitte der sechziger Jahre
fuhren
Pendelzüge
des
Depots
Winterthur neben den üblichen Personenzügen auf vielen
Nebenstrecken
Schnell- und
Eilzüge
von Winterthur aus nach Basel und ab Zürich nach Romanshorn und
Schaffhausen. Mit Personenzügen kamen die
Triebwagen
auf den Strecken St. Gallen – Sulgen, Winterthur – Rapperswil und Zürich –
Zug – Luzern zum Einsatz.
Besonders zu erwähnen ist hier der Einsatz von Romanshorn nach
Arth-Goldau, da er über die steilen Strecken der SOB führte. So kam der
eher schwache
Triebwagen
BDe 4/4 auf einer der steilsten
Privatbahnen
der Schweiz zum Einsatz. Dies zudem teilweise immer noch als
Lokomotive
und nicht in einem
Pendelzug.
Auch er war als Reserve vorgesehen und wurde in einem
Dienstplan
für Lokomotiven mitgeführt. So waren die Triebwagen gut ausgelastet.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2019 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Der
Betriebseinsatz erfolgte im Dez-ember 1953 mit den ersten drei
Der
Betriebseinsatz erfolgte im Dez-ember 1953 mit den ersten drei  Am
Abend war dann noch der
Am
Abend war dann noch der 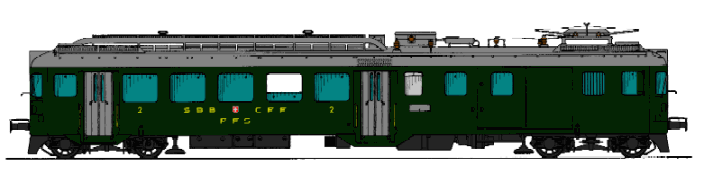 Im
Jahre 1955 wurden noch die Nummern 859 bis 863 und 868 ausgeliefert. Damit
standen nun alle
Im
Jahre 1955 wurden noch die Nummern 859 bis 863 und 868 ausgeliefert. Damit
standen nun alle
 In
Bellinzona leisteten die
In
Bellinzona leisteten die
 Auf
den
Auf
den  Wegen
der angeblich kurzen Wendezeit in Bern musste diese
Wegen
der angeblich kurzen Wendezeit in Bern musste diese
 Vergessen
werden dürfen aber auch nicht die zu den
Vergessen
werden dürfen aber auch nicht die zu den
 Im
Im