|
Betriebseinsatz Teil 3 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Einen ersten
Rückschlag mussten die erfolgreichen
Triebzüge
RABe 523 im Frühjahr 2011 ertragen. Die früh am Morgen verkehrende S2 von
Erstfeld nach Baar Lindenpark war unter der Woche sehr gut besetzt. Der
Triebzug platzte bereits ab Brunnen aus allen Nähten. Der Einsatz eines
zweiten Zuges in
Vielfachsteuerung
war jedoch nicht möglich, da die
Bahnsteige
im Raum Zug zu kurz waren. Warum waren die nur auf einen Zug ausgelegt
worden?
Die immer wieder
vorhandenen Kritiker kamen nun natürlich schnell und meinten dabei nur,
dass solche Konzepte schlicht nicht funktionieren können. Eisenbahnen
benötigen schwere Modelle um erfolg-reich zu sein. Scheiterte wieder ein leicht gebautes Fahrzeug an seinem eigenen Erfolg? Nur hatten die flinken leichten innovativen Regionaltriebwagen gegenüber den roten Pfeilen einen Vorteil, denn sie konnten in Vielfachsteuerung verkehren.
Es war letztlich ja
nicht das Problem des
Trieb-zuges,
sondern es war die mangelhafte
Infrastruk-tur,
die einen Einsatz in
Vielfachsteuerung
verun-möglichte. Bei der Planung der
Stadtbahn
erwartete man scheinbar keinen Erfolg. Dumm, dass er doch kam.
Gerade der grosse
Erfolg der
Stadtbahn
in Zug war auch den neuen
Triebzügen
zu verdanken. Die flinken Züge erlaubten auf vielen Strecken attrak-tive
und schnelle
Verbindungen.
Das führte aber dazu, dass der Bedarf den Bestand bei den Zügen
übertrumpfte. Man benötigte zusätzliche Einheiten um dem Verkehrsaufkommen
gerecht zu werden. Diese bekam die Zentralschweiz aus der Region Basel, wo
einige RABe 521 abkommandiert werden konnten.
Dabei verkehrten die
Züge aus Basel mit den in der Zentralschweiz eingesetzten RABe 523 in
gemischten Zügen oder alleine. Jedoch fielen sie wegen dem für Basel
angebrachten Anstrich schnell auf. Wobei nach all den Jahren hatte man
sich daran gewohnt, dass nicht alle
Leistungen
von einem sympathischen Zug gefahren wurden. Zumindest waren die
Anschriften jetzt lesbar. Jedoch blieb der Bestand bei den Zügen sehr
knapp.
Sie haben richtig
gelesen, die für Frankreich ge-bauten Modelle kamen nun in den Einsatz und
sie konnten nun auch wieder zwischen Frick und Mul-house eingesetzt
werden. Dem Einsatz in Frank-reich wurden nun keine Hürden mehr in den Weg
gestellt.
Mit dem
Trotz grossen
Startschwierigkeiten konnte sich das Angebot mit der direkten
Verbindung
von Bellin-zona aus festigen und gehört zum festen Angebot der Region.
Das Problem bei den
Zügen nach Malpensa war aber deren
Kapazität.
Ideal wären da die grösseren Einheiten gewesen, aber damit hatte man in
Italien immer noch keine
Zulassung
erreicht. War es einmal diese Lampe, die blau statt gelb sein musste, war
es an einem anderen Tag, das Problem, dass der Fahrgast nicht erkennen
konnte, dass es zwei Abteile der ersten
Wagenklasse
gab. Wenn man etwas verhindern will, fallen einem alle erdenklichen Ideen
ein.
Ein Meilenstein in
der Geschichte der langwierigen Prozedur mit der
Zulassung
der RABe 524 in Italien konnte jedoch am 09. Februar 2012 endlich
abgeschlossen werden. Jetzt konnten auch die verlängerten RABe 524 in
Italien verkehren. Spannend dabei war, dass die Züge in Italien
unterschiedliche Bezeichnungen erhalten hatten und die langen RABe 524 in
Italien als ETR 524 bezeichnet wurden. Im Betrieb konnte man nun die Züge
besser den Bedürfnissen anpassen.
Bei den bisher
kontrollierten Zügen der Reihen RABe 521 und RABe 523 waren diese Schäden
nicht zum Vorschein gekommen und deren Lauf-leistung war auch sehr hoch. Schnell vermutete man bei den Fachleuten den Grund beim rund elf Tonnen höheren Gewicht der RABe 524. Hinzu kam, dass das Einsatzgebiet im Tessin sehr kurvenreich war, was auch zu einem grösseren Verschleiss führen konnte.
Dann gab es noch
steile Abschnitte. Bei allen eingesetzten Zügen bot die Strecke den
Modellen im Tessin die grössten Herausforderungen. Enge
Kurven,
die sich abwechselten, bildeten den grössten Teil des Netzes. Als Folge davon wurden am 13. März 2012 alle 16 vierteiligen Triebwagen RABe 524 aus dem Verkehr genommen und im Depot Bellinzona intensiv nach Schäden untersucht. Der Verkehr musste nun von den langen Zügen gestemmt werden.
Wenn es ging, wurden
eiligst Domino aus dem Norden zugeführt und diese als Ersatz eingesetzt.
Noch war man davon überzeugt, dass die Aktion nach wenigen Stunden
entschärft werden könnte. Dabei fand man bei weiteren Triebwagen zerschlissene Elemente. Als Notmassnahme wurden bei den betroffenen Triebzügen RABe 524 die Luftfeder der Laufdrehgestelle abgeschaltet und die Züge so mit redu-zierter Geschwindigkeit im Tessin eingesetzt.
Das war möglich,
weil dort die Verluste bei der
Fahrzeit
nicht so ins Ge-wicht fielen. Ein Vorteil der vielen engen
Kurven,
auch wenn diese ver-mutlich die Ursache gewesen waren.
Man erkannte aber,
dass man die Teile bei diesen Zügen intensiver wechseln musste. Nachdem
die Zentralschweiz das Problem mit den einseitig abgenutzten
Rädern
hatte, erkannte man, dass die Standorttreue dieser Züge nicht nur Vorteile
hatte. Ein gleichwertiger Verschleiss konnte nur erreicht werden, wenn die
Züge viele Regionen befuhren. Dazu waren die Modelle der diversen Reihen
jedoch zu speziell gebaut worden.
Die in Basel
eingesetzten Modelle der Reihe RABe 522 kamen im Jahre 2012 auch im
Fernverkehr
zum Einsatz. Die Züge fuhren dabei mit einem
Interregio
aus dem Raum Basel nach Zürich und zurück. Die Not macht immer wieder
erfinderisch und wenn die
Komposition
fehlt, sucht man an anderer Stelle. Der grosse
RABDe 500, der als
Regionalzug
verkehrte und die
S-Bahn,
die als Interregio von einer grossen Stadt zur anderen fuhr.
Diese Einsätze waren
jedoch bei den Kunden nicht sonderlich beliebt, da die dem
Nahverkehr
angepasste Bestuhlung alles andere als zum im
Veränderungen beim
Einsatz der Reihe RABe 523 gab es jedoch auch. Die in der Westschweiz
eingesetzten
Triebwagen
wurden dort durch neue Doppelstockzüge ersetzt. Diese hatten den Vorteil,
dass bei gleicher Länge des
Bahnsteiges
mehr Leute sitzen konnten. Der dabei verwendete grosse Bruder des Flirts,
musste sich dabei nicht verstecken, denn auch der hatte für den Einsatz
genug Power. Es gab nun etwas, was den RABe 523 ersetzen konnte.
Die Anschriften wurden jedoch nicht angepasst, so dass die Züge unter-schiedlich in Erscheinung traten. Auch sonst strebte das Unternehmen wieder einheitlich aussehende Züge an.
Die Modelle im Raum
Konstanz zeigten es schon lange. Die
Staatsbahnen
hat-ten ihre Farben. Der RABe 523 mit der Nummer 523 037 wurde in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 2012 an der Aus-fahrt aus dem Bahnhof Lenzburg ge-hindert. Die einen Güterzug führende Lokomo-tive Re 4/4 II mit Nummer 11 277 miss-achtete ein rotes Signal, wodurch es zur seitlichen Kollision der beiden Züge kam.
Dabei verunstaltete
die kräftig gebaute
Lokomotive den Kasten des Leichtbaus und der RABe
523 wurde aus den
Schienen
gedrückt.
Da kaum Reisende im
Zug und die Geschwindigkeit gering war, gab es bei dem Vorfall keine
Opfer. Man erkannte aber, dass es immer wieder zu solchen Vorfällen kommen
kann und die Strukturen der modernen Fahrzeuge bei seitlichen Kollisionen
kaum einen
Widerstand
bieten konnten. Die Crash-Optimierung fand immer bei den Frontpartien
statt. Dabei vergass man jedoch, dass das bei normalen Wagen auch zu
gleichen Schäden geführt hätte.
Der Unfall zeigte
aber auch, dass die
Triebzüge
davon bisher verschont geblieben waren. Das waren die Folgen von
verbesserten Systemen bei der
Zugsicherung,
aber auch der Zug half mit, weil das Personal damit die Arbeit leichter
erledigen konnte. So blieb die Konzentration länger erhalten. Ein Vorteil
für die Sicherheit, aber auch für den Planer, der so neue
Leistungen
kreieren konnte. Mal sehen, wer mehr als 100mal mit einem Zug an einem Tag
halten kann.
So konnten die Züge
aber weiterhin mit der S2 in den Kanton Uri fahren. Die Alternative wäre
nur die Verkürzung der Linie gewesen. Den Kunden hätte das sicherlich
nicht gefallen. Doch nun kam
ETCS
und damit die Probleme. Ein Problem bei der Software führte dazu, dass diese Triebzüge nicht mehr mit der Geschwindigkeitssteuerung gefahren werden konnten. Bei der nervös wirkenden Regelung der Zugkraft, war das Personal damit stark gefordert.
Eine Folge davon
waren ungewollte Tests der
Bremskurven
und ver-mehrte
Zwangsbremsung
durch
ZUB.
Erstmals zeigte sich ein Problem bei den Zügen, die so auf den Einsatz mit
der Regelung der Ge-schwindigkeit ausgelegt wurden, dass sie normal kaum
bedient werden konnten.
Auch wenn wir von
einem erfolgreichen Fahrzeug sprechen können, es gab immer wieder
Vorfälle, die den Laien an dieser Aussage zweifeln liessen. Die Einheit
bestehend aus zwei Modellen der Reihe RABe 523 bekam das zu spüren. Dabei
führte eine
Bremsstörung
am
Triebdrehgestell
der Einheit 523 024, die an zweiter Stelle lief, zu einem schweren
Vorfall. Durch die in die
Klimaanlagen
gelangenden
Gase,
sprach beim Zug die Brandschutzanlage an.
Ein Vorfall, der
passieren konnte. So betraf es anfänglich immer wieder die WC-Kabine. Bei
dieser sprach die Anlage an und löschte dabei mit dem Wassernebel die
brennende Kabine. Dummerweise war es lediglich eine Zigarette und der
Pechvogel genoss eine unerwartete Dusche. Doch mittlerweile hatten auch
jene kapiert, dass man in diesen Zügen auf keinen Fall eine Ecke zum
Rauchen suchen sollte, die Anlage findet jeden Sünder.
Die Strecke wurde in
der Regel von TRAVYS be-fahren und diese hatte die Fahrzeuge von den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB gemietet. Für uns ist das aber einer der
Hotspots, die es bei den Zügen auch gab. Wenn es eine Baureihe mit Veränderungen gab, dann waren das die Modelle der Baureihe RABe 524. Diese sollen nun für einen neuen Einsatz verwendet werden. Nach der Inbetriebnahme des Basistunnels im De-zember 2016 sollten die Einheiten auf der alten Bergstrecke den Einsatz als Regioexpress übe-rnehmen.
Mit dem Flirt von
Erstfeld nach Mailand ohne um-steigen. Sicher ein Traum, in einem
Fahrzeug, das für
Stadtbahnen
gebaut worden war.
Ebenfalls eine
Neuerung war die Einführung der S 25. Diese neue
Verbindung
wurde zwischen Brugg und Muri eingerichtet. Im Unterschied zu den Zügen
von früher gab es hier jedoch eine Änderung, denn Lenzburg wurde nicht
mehr angefahren. Die mit der Reihe RABe 523 gefahrenen Züge benutzten auf
ihrem Weg, die Strecke zwischen Othmarsingen und Hendschiken. Damit
entstand eine schnelle Verbindung zwischen den beiden Orten.
Bleibt eigentlich
noch die Westschweiz. Dort gab es eine grosse Veränderung. Die Strecke
zwischen Genève und La Plaine wurde von 1 500
Volt
Gleichstrom
auf 25 000 Volt
Wechselstrom
umgestellt. Damit konnten die dort eingesetzten
Triebzüge
nicht mehr verwendet werden. Aus diesem Grund wurden RABe 522 aus Basel
abgezogen und ganz im Westen eingesetzt. Der Einsatz sollte erst enden,
wenn die eigenen Züge geliefert würden.
Wenn man daran denkt,
dass damals von zehn Einheiten für die
Stadtbahn
gesprochen wurde. Ein sehr grosser Erfolg für die Baureihe. Die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB sollten in Zukunft nur noch Züge nach den
Mustern Flirt 2 und 3 erhalten. Das Jahr verlief ruhig, die Triebzüge konnten sich immer wieder aus den gröbsten Händel raushalten. Nahezu überall in der Schweiz waren sie zu sehen. Selbst die Ostschweiz war dabei.
Wobei dort immer
wieder Modelle mit besonderen An-strichen und komischen Anschriften zu
sehen waren. Der internationale Erfolg war daher immer wieder zu erkennen.
Dabei vielen die neuen
Triebzüge
für die Bundesbahnen nicht auf.
Auffallen wollte
jedoch der RABe 521 017. Dieser verkehrte am 01. November 2017 mit einem
neuen Anstrich. Die Türen waren plötzlich wieder gelb und auch der Kasten
hatte grosse gelbe Bereiche bei den
Führerständen
erhalten. Die Anschriften NRW zeigten, dass der Zug für Werbung
missbraucht wurde. Eine Aktion, die an den Neubau der Hochschule erinnern
sollte und die dafür sorgte, dass der Zug ein paar Jahre auffallen konnte.
Auch auffallen konnte
der erste RABe 522 für Léman Express. Dieser wurde noch 2017 ausgeliefert
und nach kurzen
Probefahrten
für die Einstellungen in die Region um den Genfersee verschoben. Die
Aushilfe aus Basel konnte daher wieder abgezogen werden. Die Modelle für
die Region um Genève kamen. So sollte man für die neuen Strecken bereit
sein. Auch wenn dort kaum jemand an die versprochenen Termine glauben
konnte.
Das wiederum führte
dazu, dass andere Strecken mit Domino geführt wurden. Doch deutlich
wichti-ger war der Wechsel des
Stromsystems.
Die ent-sprechende
Schutzstrecke
wurde nämlich auf der Strecke vorgesehen. Das führte dazu, dass diese Züge nun den System-wechsel während der Fahrt absolvierten. Das gab es bisher weder im Raum Basel noch im Tessin, denn dort erfolgte der Wechsel bei einem Halt, wo die Aufenthaltszeiten genutzt wurden.
Da jedoch die Züge
für einen solchen Wechsel vorbereitet waren, wurden dank der guten
Vorbe-reitung
keine Probleme erwartet. Wie der
Ablauf
dabei war, haben wir schon erfahren. Es zeigte sich, dass man mit dem
entsprechenden Aufbau schnell sein konnte.
Die Spezialisierung
auf bestimmte Strecken spürte man bei den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB. Dort begann die Sanierung der Schäden durch Korrosion. Für die
erforderlichen Arbeiten wurde die
Hauptwerkstätte
in Bellinzona vorgesehen. Schäden an den
Radsätzen
jedoch in Basel. Das führte dazu, dass der Betrieb ganz komische Lösungen
hervorrufen konnte. Das Problem war die mit
ETCS
versehene Strecke.
So verkehrte von
Süden in den Norden ein Zug mit drei
Triebzügen.
An der Spitze verkehrte die Nummer 523 064. Dieser folgte die Nummer
524 011 und am Schluss fand sich der RABe 521 mit der Nummer 521 016.
Angeblich sollte es sich dabei um einen
ETCS
Vorspann gehandelt haben. Dumm dabei war eigentlich nur, dass die Reihe
RABe 524 mit dieser Einrichtung versehen war, denn im Tessin kam man ohne
ETCS
Level 2
nicht sehr weit.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2021 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
 Daher
kam es, dass die
Daher
kam es, dass die
 Diese
Einsätze waren jedoch nur möglich, da man in Basel vermehrt die neuen
Diese
Einsätze waren jedoch nur möglich, da man in Basel vermehrt die neuen
 Doch
das Glück währte nicht lange. Die ersten vierteiligen RABe 524 kamen in
die
Doch
das Glück währte nicht lange. Die ersten vierteiligen RABe 524 kamen in
die
 Die
nun frei gewordenen
Die
nun frei gewordenen
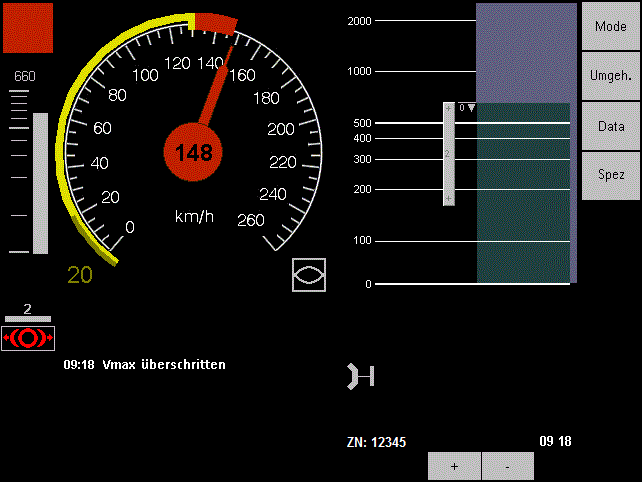 Da
auf der Strecke zwischen Zug und Erstfeld ab 2015
Da
auf der Strecke zwischen Zug und Erstfeld ab 2015
 Es
war immer noch so, die
Es
war immer noch so, die
 Nahezu
unbemerkt erfolgte eine Mitteilung an die Fach-presse. Nach Auslieferung
des Zuges mit der Nummer 523 073 sollte die Lieferung von Modellen der
Nahezu
unbemerkt erfolgte eine Mitteilung an die Fach-presse. Nach Auslieferung
des Zuges mit der Nummer 523 073 sollte die Lieferung von Modellen der
 Der
Der