|
Einleitung |
||||
|
|
Navigation durch das Thema | |||
|
Vielleicht wurden Sie durch den Titel der Seite etwas überrascht.
Bisher waren immer
Bahngesellschaften
und Typenbezeichnungen aufgeführt worden. Ergänzt natürlich mit den
Nummern der einzelnen
Lokomotiven. Nun aber steht im Titel nur noch Lokomotive
2000 und damit kann wirklich niemand etwas anfangen. Doch warum dieser
Wechsel beim Titel, denn bisher waren hier Typenbezeichnungen vorhanden.
Es ist eigentlich ganz einfach, denn die
Lokomotiven der Reihe Re 460 wurden nicht nur für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB gebaut, sondern konnten auch an andere
Bahngesellschaften
verkauft werden. So gesehen ist die Maschine eine der ersten, die aus
einem frühzeitigen Baukasten stammte, obwohl man diese Lösungen schlicht
noch nicht kannte. Da die Maschine bei den Schweizerischen Bundesbahnen
SBB als Lok 2000 bezeichnet wurde ist das der Titel.
Daher werden wir nun eine
Lokomotive kennen lernen, die ihrer Zeit eigentlich weit
voraus war. Wie bei jeder
Plattform
von Lokomotiven besitzt auch die Familie der „Lok 2000“ ein Grundmuster
auf dem schliesslich die von den verschiedenen
Bahngesellschaften
gewünschten Varianten aufgebaut werden konnten. Dieses Grundmuster war die
Re 460 der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, die auch als Lok 2000
bezeichnet wurde.
|
||||
|
Baujahr: |
1992 – 1996 |
Leistung: |
6 100 kW / 8 300 PS |
|
|
Gewicht: |
84 t |
V. Max.: |
230 km/h |
|
|
Normallast: |
700 t |
Länge: |
18 500 mm |
|
|
Die Entstehung der Lok 2000 und somit der Re 460 war eine
langwierige Angelegenheit. Daher lohnt es sich, wenn wir die Entstehung
dieser Baureihe etwas genauer unter die Lupe nehmen, denn wie sollte es
dazu kommen, dass eine
Lokomotive, die für die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
gebaut wurde, zu einer
Plattform
von Lokomotiven wurde, auch wenn man solche Lösungen zur damaligen Zeit
gar noch nicht kannte.
Wenn man auf den Fahrzeugpark der Schweizerischen Bundesbahnen SBB
im Jahre 1975 blickt, erkennt man, dass noch viele alte Fahrzeuge
verkehrten. Neu waren eigentlich nur die Lokomotiven der Baureihe
Re 6/6. In vielen Punkten war im
Unternehmen nicht viel Investiert worden. Das Land und somit die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB erholten sich gerade von der
Wirtschaftskrise, die es schaffte, dass Autobahnen leer waren.
Die Eisenbahn der Zukunft sollte sich wirklich von den alten
Maschinen der Baureihe Ae 4/7
unterscheiden. Die Bahn der Zukunft sollte entstehen und das konnte
eigentlich nur mit der
Staatsbahn
erfolgen. So sollte die Schweiz in die Zukunft starten.
Der Grundstein für diese
Lokomotive wurde daher bereits anfangs der 80er Jahre
gelegt. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB begannen zu dieser Zeit mit
einem speziellen Programm, das die Modernisierung des Fahrzeugparkes und
der Anlagen bewirken sollte. So ein Programm hatte es schon länger nicht
mehr gegeben und kann eigentlich nur mit der Einführung der
Leichtstahlwagen,
oder mit der Elektrifizierung 1920 verglichen werden.
Neben einem netzweiten Funknetz zur Kommunikation zwischen Zug und
Bahnhof
war damals auch geplant, eine neue Generation von
Reisezugwagen
und die dazu passenden
Lokomotiven für den nationalen
Fernverkehr
zu beschaffen. Im
Nahverkehr
sollten ebenfalls moderne optimal abgestimmte Fahrzeuge entstehen. So
sollten die Maschinen aus den Anfängen der elektrischen Traktion endlich
verschwinden.
So entstanden in dieser Zeit die
Triebwagen
RBDe
560, die den
Regionalverkehr
modernisierten und die sich in diesem Bereich am Zuspruch der Bevölkerung
erfreuen konnten. Beim Wagen für den
Fernverkehr
handelte es sich um den
Einheitswagen
der vierten Generation. Diese neuen Wagen benötigten aber, um optimal
eingesetzt werden zu können, eine passende
Lokomotive. Daher werfen wir einen kurzen Blick auf
diesen Wagen.
Doch die schweren Wagen erforderten auch im
Flachland immer wieder die starken
Lokomotiven
Re 6/6. Mit den zahlreichen
Maschinen der Baureihe
Re 4/4 II war kaum
mehr viel auszurichten. So war klar, es musste eine neue Lokomotive
beschafft werden.
Daher wurden von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB vorerst vier
Prototypen
einer 160 km/h schnellen
Lokomotive beschafft. Diese vier mit einer
Phasenanschnittsteuerung
ausgerüsteten
Prototypen
waren eigentlich schon beim Bau von der Technik überholt. Die Steuerung
der
Triebwagen
RBDe
4/4 wirkte zwar modern, aber bei der Industrie peilte
man bereits einen anderen Schritt für die Lokomotive der Zukunft an.
Obwohl der Wagen mit 200 km/h verkehren konnte, überraschte es,
dass die
Lokomotive nur 160 km/h verkehren sollte. Um mit 200
km/h zu fahren fehlte schlicht das passende Signalsystem. Dieses war
ebenfalls neu entwickelt worden und wurde erprobt. So lange man nicht
sicher war, fuhr man lediglich mit 160 km/h durch das Land. Noch war die
Schweiz kein Land für die wirklich schnellen Züge, denn es gab kaum
genügend lange gerade Strecken.
Die Bezeichnung dieser vier
Lokomotiven lautete Re 4/4 IV. Sie war somit eine
direkte Folge der erfolgreichen
Re 4/4 II. Dank der
neuen Technik konnte etwas mehr
Leistung
abgerufen werden. Das kam den neuen schweren Wagen entgegen. Zusätzlich
sollte mit den Maschinen auch das Erscheinungsbild der Zukunft erprobt
werden. Grüne Lokomotiven gehörten daher der alten Generation an. Neu
sollten rote Akzente Einzug halten.
War das bei der Baureihe
Re 4/4 II
technisch bedingt, konnte man diese Argumente nicht mehr bringen. Der neue
Star der
Staatsbahnen
wurde als veraltet und überholt betitelt. Wahrlich kein guter Start der
Lokomotive
der Zukunft.
Der kantig daherkommende Kasten mit den längs ver-laufenden Sicken
unterschied sich deutlich von den anderen
Lokomotiven. So wirkte die Lokomotive optisch
überraschend modern und gliederte sich fast ein wenig an die BR 120 der DB
an. Gerade das Wellblech auf der Seite, das damals bei Lokomotiven in
Mitteleuropa eher selten verwendet wurde, brachte der eckigen Lokomotive
den Begriff „Container“ ein.
So war schon sehr schnell klar, die
Lokomotive der Baureihe Re 4/4 IV sollte nie in Serie
gebaut werden. Auslöser für diese Erkenntnis bei den Schweizerischen
Bundesbahnen SBB war die nagelneue bei der damaligen
Bodensee-Toggenburg-Bahn getestete Lokomotive Re 4/4 für die
Privatbahnen.
Diese Maschine war technisch viel weiter als die Re 4/4 IV der
Staatsbahnen.
Dabei stand IV freilich gemäss bösen Zungen für die Invalidenversicherung.
Diese als KTU-Re 4/4 bekannt gewordenen Maschinen besassen neue
Umrichter
und
Asynchronmotoren.
Geliefert werden konnte diese
Lokomotive letztlich an die BT, die SZU und an die EBT-Gruppe.
Sie führten jedoch auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
schliesslich zu den Re 450 der
S-Bahn
Zürich und so zur ersten in Serie gebauten Lokomotive mit statischem
Umrichter bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Das politische Geplänkel, das zum Konzept Bahn+Bus 2000 veran-staltet wurde, führte dazu, dass die Fahrzeiten in der Schweiz zwischen den wichtigsten Zentren auf unter 60 Minuten reduziert werden mussten.
Mit einer für 160 km/h gebauten
Lokomotive konnte diese Vorgabe nur sehr knapp umgesetzt
werden.
Mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h reichte die
Fahrzeit
gerade aus. Nur, man hatte keine Zeitreserven mehr. Eine Baustelle mit
Langsamfahrstelle
genügte und schon kamen die Züge zu spät an. Damit der
Fahrplan
aber stabil bleibt, musste der Zug die durch eine Baustelle verursachte
Verspätung
durch schnelleres Fahren aufholen. Da jedoch der Lokführer nicht schneller
als erlaubt fahren darf, muss er Zeitreserven bekommen, die es ihm im
Normalfall ermöglichen, ein wenig Tempo wegzunehmen.
Der Slogan nicht so schnell wie möglich, sondern so schnell wie
nötig wurde kreiert. Trotzdem hiess das, dass man in der Schweiz eine neue
höchste Marke anstreben musste und die lag bei 200 km/h. So erwies sich
die immer noch ausstehende Bestellung für eine neue
Hochleistungslokomotive, ein paar Jahre später, als sehr gut. Man musste
die
Lokomotive
neu überdenken.
Die
vier
Prototypen,
also die Re 4/4 IV, wurden daher nie in Serie gebaut.
Gründe gab es dazu viele, mit 160 km/h war die
Lokomotive zu langsam und technisch war sie seit den Re
450 bereits veraltet, denn die Lokomotiven mit
Umrichter
hatten mit den guten
Asynchronmotoren
viele Vorteile. Es musste eine andere Lokomotive gebaut werden. Das
Intermezzo Re 4/4 IV war beendet und die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
konnte sich schliesslich einige Jahre später von den vier ungeliebten
Prototypen
trennen.
Es musste eine komplett neue
Lokomotive entwickelt und beschafft werden. Sie wurde ab
dann allgemein als Lok 2000 bezeichnet. Der Grund war klar, es sollte die
Lokomotive für die
Bahn 2000
sein. Deshalb gaben die Schweizerischen Bundesbahnen SBB Mitte der 80er
Jahre bei den damaligen Hauslieferanten Asea Brown Boveri in Oerlikon
(ABB) und der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur
(SLM) den Auftrag, eine entsprechende Lokomotive zu entwickeln.
Am
Gotthard sollte mit 80 km/h die Traktionsleistung einer
Ae 6/6
erbringen können. Diese Eckdaten ergaben eine scheinbar gigantische
Leistung,
die in der vierachsigen
Lokomotive installiert werden musste.
Dass in der Schweiz mit den vielen engen
Kurven
ein schonender Kurvenlauf gefordert wurde, überraschte niemanden
sonderlich und seit den
Lokomotiven
Re 4/4 II war
das auch üblich geworden. Diese Forderungen hatte man im Griff. Mehr
überrascht war man in Fachkreisen, als die Forderung für noch schnellere
Kurvenfahrten aufgestellt wurde. Die Domäne der in Italien verkehrenden
Neigezüge
sollte nun durch eine Lokomotive hoher
Leistung
geknackt werden.
Weitere Punkte im
Pflichtenheft
waren eine
Vielfachsteuerung
unter den
Lokomotiven. Die Schweizerischen Bundesbahnen SBB
verzichteten daher auf eine Kombination mit den alten Lokomotiven der
Baureihen
Re 4/4 II und
Re 6/6. Zudem sollte die
neue Lokomotive soweit vorbereitet werden, dass sie auch unter 3 000
Volt
Gleichstrom
und somit in Italien eingesetzt werden könnte. Indirekt machte man damit
einen ersten Schritt zu den internationalen Lokomotiven.
Hier fehlte den Schweizerischen Bundesbahnen SBB vermutlich der Mut zur
vollen Umsetzung einer
Zweisystemlokomotive.
Gerade die damals noch lukrativen Züge über die Alpen und weiter nach
Italien waren durch die Lokwechsel behindert worden. Eine passende
Lokomotive hätte durchfahren können. Nur, gerade
am Gotthard waren die Züge für diese Lokomotive zu schwer, so dass man
vermutlich aus diesen Grund auf die Umsetzung verzichtete.
Das war bisher bei den errechneten 6 100 kW
Leistung
noch nie verwirklicht worden und die optimale Lösung mit der
Lokomotive
Re 6/6 war auch nicht
möglich. Als Muster konnte nur die BR 120 der DB verwendet werden.
Damit haben wir nun die
Lokomotive 2000. Diese wurde für die
Schweizerischen Bundesbahnen SBB entwickelt und sollte eine
zukunftsweisende Maschine werden. Eigentlich war damit eine der ersten
internationalen Lokomotiven in Europa entworfen worden. Vielmehr ergab
sich eine
Plattform
von Lokomotiven, die man so nicht erkannte. Trotzdem erachteten die
Manager den Bau von Lokomotiven in der Schweiz als gescheitert an.
Das hatte zur Folge, dass die Re 460 oder eben die Lok 2000 die
letzte in der Schweiz entwickelte und gebaute
Lokomotive sein sollte. Die Produktion von
Lokomotiven dieser Grösse wurde ins Ausland verkauft und somit in der
Schweiz aufgegeben. Ein paar Jahrzehnte später versuchten die
ausländischen Hersteller in Deutschland und Frankreich wieder an die
zukunftsweisende Technik der Lok 2000 anzuknüpfen.
Die weiteren Entwicklungen bei Bombardier und Siemens konnten in
vielen Punkten von diesen Erfahrungen profitieren. Selbst die BR 101 der
Deutschen Bahn wurde immer wieder der Familie Lok 2000 zugeschlagen. Der
Grund war simpel, denn diese Maschine wurde in vielen Punkten aus der Lok
2000 entwickelt und konnte so das Muster aus der Schweiz in Deutschland
umgesetzt werden. Doch blicken wir nun auf die erfolgten Bestellungen der
Lok 2000.
|
||||
|
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
||||
 Durch
den Aufschwung bedingt, kamen in der Schweiz neue Ideen auf. Die Züge in
der Schweiz sollten schneller, moderner und besser vernetzt werden.
Utopische Ideen wurden dadurch aufgezeichnet.
Durch
den Aufschwung bedingt, kamen in der Schweiz neue Ideen auf. Die Züge in
der Schweiz sollten schneller, moderner und besser vernetzt werden.
Utopische Ideen wurden dadurch aufgezeichnet. Die
neuen
Die
neuen
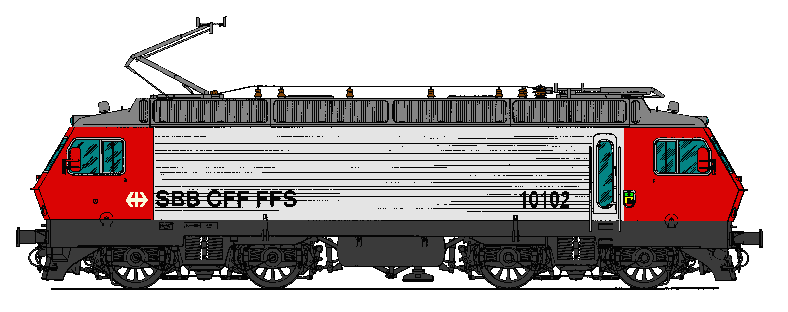 Als
der neuste Stolz der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB die ersten
Gehversuche machte, war man sich in der Fachwelt einig. Die
Als
der neuste Stolz der Schweizerischen Bundes-bahnen SBB die ersten
Gehversuche machte, war man sich in der Fachwelt einig. Die 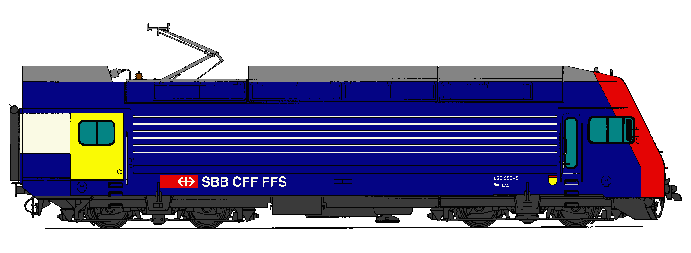 Somit
fehlte eigentlich immer noch eine moderne
Somit
fehlte eigentlich immer noch eine moderne 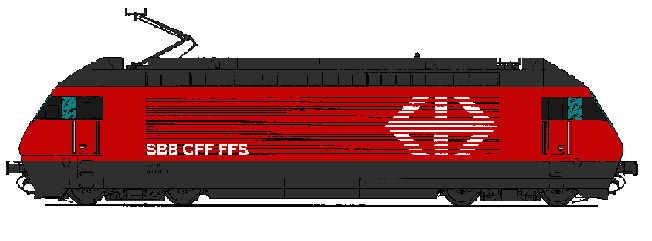 Die
dabei von den
Die
dabei von den
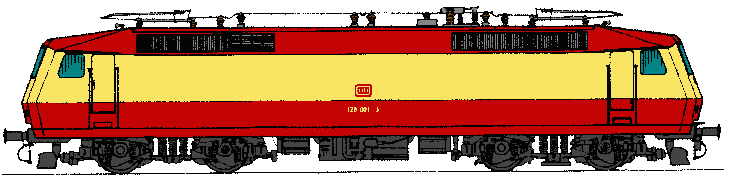 Die
Bezeichnung der neuen
Die
Bezeichnung der neuen