|
Die Gotthardstrecke |
||||||
| Navigation durch das Thema | ||||||
|
Vermutlich wäre es einfacher gewesen, wenn
ich mit der
Lötschbergstrecke
begonnen hätte. Jedoch müssen wir, um umfassend informiert zu sein, auch
auf die Gotthardstrecke blicken. Damit beginnen wird bei der Strecke
selber, denn die Strecke über den Gotthard war sehr speziell. Der Grund
ist, dass hier im Gegensatz zur Lötschbergstrecke planmässig
Dampflokomotiven verkehrten. Das hätte eigentlich internationale Einsätze
schon sehr früh ermöglicht. Die Gotthardbahn
wurde 1882 eröffnet und die ersten Jahre mit Dampflokomotiven betrieben.
Daher wäre durchaus ein Einsatz von ausländischen
Lokomotiven kein Problem gewesen.
Jedoch hatten andere Länder und auch andere Bahnen kaum Lokomotiven, die
am Gotthard verwendet werden konnten. Daher verkehrten am Gotthard die
Dampflokomotiven der Gotthardbahngesellschaft. Diese gehörten zu dabei den
kräftigsten Modellen in Europa.
Aufgrund ihrer permanenten Verkehrsüberlastung wurde die
Gotthardstrecke zudem nur äusserst selten für ausländische Versuchsfahrten
genutzt. Überliefert sind daher kaum Fahrten mit ausländischen
Lokomotiven. Als die TEE-Züge an den Gotthard kamen, waren die Dieseltriebwagen schlicht zu schwach und zu klein für die Strecke. Auch die lange Talfahrt stellte ein grosses Problem dar. Hier kamen daher die elektrischen Züge der Schweizerischen Bundesbahnen SBB zum Einsatz.
Später gab es sogar
TEE-Züge,
die mit
Lokomotiven der SBB geführt wurden. Man
wechselte wieder Lokomotiven, obwohl man das eigentlich gar nicht mehr
wollte. Doch noch etwas änderte mit der neuen Staatsbahn. Das durch den Staat geschützte Unternehmen musste seine Triebfahrzeuge und Wagen im eigenen Land bestellen. Das war nicht nur bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB so, sondern bei den meisten Staatsbahnen. Damit wurde die Industrie im Land unterschützt und Arbeitsplätze geschaffen. Ausländische Hersteller wurden daher nicht berücksichtigt.
Jedoch wurde mit den neuen Bedingungen und
dank der neuen Technik die Angelegenheit grundsätzlich verändert.
Ausländische Hersteller konnten nun auch den schweizerischen Bundesbahnen
SBB
Lokomotiven anbieten und verkaufen.
Die
Staatsbahn
wurde von der Pflicht im eigenen Land zu bestellen, entbunden. Daher kamen
Hersteller mit ihren Lokomotiven und führten Versuchsfahrten aus. So
sollte die neue Lokomotive dem zukünftigen Kunden präsentiert und
angeboten werden.
Solche Fahrten gelten von den Vorschriften
her, als Versuchsfahrten. Diese Versuchsfahrten mit ausländischen
Lokomotiven kamen somit an den Gotthard,
jedoch tauchten die Lokomotiven überraschend spät auf. Wir werden sehen,
dass hier der Lötschberg etwas anders war, denn diese Strecke wurde immer
wieder für solche Versuche herangezogen. Wir betrachten jedoch nun die
Versuche am Gotthard, denn diese gab es auch und daher dürfen sie nicht
fehlen. |
||||||
|
Versuchsfahrten |
||||||
|
Wenn wir eine Strecke für Versuchsfahrten
benutzen wollen, müssen wir uns ansehen, was diese Strecke so speziell
macht, dass wir Versuche in einem fremden Land durchführen. Die meisten
Triebfahrzeuge müssen schliesslich nicht in jedem Land alle grundlegenden
Versuche machen. Trotzdem muss die Gotthardstrecke Attribute haben, die
man nicht an anderen Orten findet. Nur, was macht diese Strecke denn so
speziell?
Wer oben ist, muss bekanntlich wieder
hinunter kommen. Hier beginnen nun die speziellen Punkte der
Gotthardstrecke. Die
Südrampe
besitzt ein durchschnittliches Gefälle von über 20‰.
Die Länge zwischen Airolo und Bodio beträgt dabei 39 Kilometer.
Vergleichbare Strecken gibt es bei
Normalspurbahnen
nicht mehr. Auch bei
Schmalspur
gibt es nicht viele Strecken, die diesen Wert übertreffen. Daher ist
dieser Abschnitt für Bremsversuche wie geschaffen.
Wenn es jedoch auf einer Strecke kaum freie
Kapazitäten für die planmässigen Züge gibt, hat es schlicht keinen Platz
für
Testfahrten. Dann nützen solche extremen Eckwerte wenig. So kam es,
dass lange Zeit kaum Versuchsfahrten am Gotthard beobachtet werden
konnten. Führte man solche Fahrten aus, nahm man die eigenen
Triebfahrzeuge, denn diese mussten schliesslich auch getestet werden.
ausländische Fahrzeuge hatten es daher schwer. Die Gefälle auf der Strecke sind bei Wagen wichtiger, als bei Lokomotiven. Die Bremsen der Wagen können so auch auf ihre Leistung überprüft werden. Daher gab es immer wieder Versuche mit Wagen, die jedoch mit eigenen Lokomotiven bewegt wurden. Ausländische Lokomotiven kamen erst später an den Gotthard. Trotzdem wollen wir die bei Versuchsfahrten eingesetzten Lokomotiven ansehen. Wir unterteilen diese in Dampf-, Diesel- und elektrische Lokomotiven.
Dampflokomotiven kamen im Rahmen von
Versuchsfahrten nur mit den eigenen
Lokomotiven
vor. Eine Dampflokomotive ist auf ihren Einsatz abgestimmt worden. So
hatten die Lokomotiven der Gotthardbahngesellschaft kleine
Räder.
Dadurch stieg die
Zugkraft.
Jedoch sank die Geschwindigkeit der Lokomotive. Im Ausland hatte man aber
schnell fahrende Lokomotiven im Einsatz, die am Gotthard kaum eingesetzt
werden konnten.
Die gleich aufgebaute
Dampfmaschine
konnte aber eine viel grössere
Zugkraft
erzeugen. Genau das war am Gotthard gefragt, denn die Geschwindigkeit war
nicht so wichtig. Ausländische
Lokomotiven konnten hier nicht
mithalten.
Daher sind keine ausgedehnten Versuche mit
ausländischen Dampflokomotiven bekannt. Das änderte sich auch nicht mit
der Verstaatlichung der Gotthardbahn
und den schweizerischen Bundesbahnen SBB. Die
Lokomotiven für die
Gotthardbahn waren zu speziell. Zwar setzten die
Staatsbahnen
schnellere Lokomotiven ein, aber mit 100 km/h war man weit unter dem
Ausland, so dass ausländische Lokomotiven nicht an den Gotthard kamen.
Selbst die
Lokomotiven der
Gotthardbahngesellschaft
verschwanden nach der Elektrifizierung sehr schnell von der Bildfläche.
Die langsamen Lokomotiven der Gotthardbahngesellschaft konnten im
Flachland nicht verwendet werden. Die hohe
Zugkraft
war zwar gewünscht, jedoch lag die
Höchstgeschwindigkeit
unter den anderen Modellen der Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Das zeigt
deutlich auf, wie speziell die Dampflokomotiven waren und dass man solche
Lokomotiven kaum auf anderen Strecken verwenden konnte.
Damit wechseln wir nun zu den elektrischen
Lokomotiven. Diese lösten am
Gotthard schon sehr früh die Dampflokomotiven ab. Andere Länder setzten zu
dieser Zeit immer noch auf Dampflokomotiven. Diese hätten jetzt mit den
Dampflokomotiven der
Gotthardbahn
mithalten können, jedoch nicht mehr mit den neuen elektrischen
Lokomotiven, die wahrlich gigantisch anmutende
Leistungen
erbrachten.
Daher überrascht es nicht, dass anfänglich
nur die eigenen elektrischen
Lokomotiven getestet wurden.
Fremde Lokomotiven, auch von anderen Bahnen in der Schweiz, waren selten
am Gotthard zu Gast. Zudem gab es nun auch die
Lötschbergstrecke
und auch dort wurden ebenfalls elektrische Lokomotiven verwendet, die mit
jenen des Gotthards durchaus mithalten konnten. Doch nun zu den
elektrischen Lokomotiven aus dem Ausland. |
||||||
|
Elektrische Lokomotiven |
||||||
|
Jahr |
Bahn |
Fahrzeug |
Bemerkungen |
|||
|
1994 |
Siemens |
127‘001-6 |
Im Rahmen der Präsentation der
Lokomotive befuhr die Lokomotive als
Versuchsfahrt den Gotthard am 11. Februar 1994. Die meisten
Versuche fanden jedoch auf anderen Strecken statt. So blieb es bei
dieser Fahrt. |
|||
|
1997 |
FS |
E 412'002 | Die neue
Mehrsystemmaschine der FS, die auch unter dem Namen
Brennerlokomotive bekannt wurde, absolvierte die
Testfahrten unter
15 Kilovolt
Wechselstrom am Gotthard. Kommerziell eingesetzt wurde
sie jedoch am Brenner. |
|||
|
2001 |
DB |
185'001 |
Zusammen mit der baugleichen
Lokomotive 185'003
absolvierte diese Maschine der DB erste Versuchsfahrten in der
Schweiz. Damit sollte geprüft werden, ob diese
Mehrsystemlokomotive international eingesetzt werden kann. |
|||
|
2001 |
DB |
BR 403 | Der
ICE 3 wurde für Erwärmungsfahrten auf der
Südrampe eingesetzt.
Planmässig war der
Triebzug jedoch nicht für einen Einsatz in der
Schweiz und damit am Gotthard, vorgesehen. Man nutzte lediglich
das lange Gefälle der Südrampe. |
|||
|
2003 |
SNCF |
437'001 | Die neue
Dreisystemlokomotive
der SNCF wurde am Gotthard im Rahmen der
Zulassungsfahrten für die Schweiz eingesetzt. Die
Lokomotive wurde anschliessend jedoch auf der Strecke Basel –
Buchs SG eingesetzt. Einen planmässigen Einsatz am Gotthard gab es
jedoch nicht. |
|||
|
2003 |
Siemens | ES 64 F4 | Die
Zulassungsfahrten der ES 64 F4 001 (BR 189) in der Schweiz führte
die
Lokomotive auch an den Gotthard und weiter in Richtung
Italien. Ähnlich, wie die Lokomotive der DB, wollte man eine
international einsetzbare Lokomotive für den
Güterverkehr. |
|||
|
2004 |
Bombardier | TRAXX 140 AC |
Bei der Maschine handelt es sich um eine
Weiterentwicklung der BR 185, die am Gotthard schon getestet
wurde. Die Veränderungen an der
Lokomotive wurden daher am
Gotthard erneut erprobt und überprüft. |
|||
|
2006 |
SNCF |
TGV - POS |
Der französische
TGV
für die
Verbindung Paris – Basel – Zürich HB
absolvierte in der Schweiz seine
Zulassungsfahrten. Dabei befuhr
er mehrere Strecken in der Schweiz. Dazu gehörte auch die
Südrampe
der Gotthardstrecke. |
|||
|
2008 |
DB |
BR 401 |
Ein verkürzter
Triebzug
ICE 1 der DB befuhr die
Gotthardstrecke im Rahmen von diversen Abnahmefahrten. Dabei ging
es in erster Linie um die Einrichtungen der
ETCS
Zugsicherung. Der
Zug fuhr früher schon einmal in voller Länge nach Flüelen. |
|||
|
Bei Versuchsfahrten mit
elektrischen
Lokomotiven, geht es auf der Gotthardstrecke oft darum, wie
sich eine Lokomotive unter langen Einsätzen an der
Leistungsgrenze bewährt. Die Steigungen und Gefälle dieser Bergstrecke beanspruchen
Fahrzeuge oft sehr stark und das sollte bei Versuchsfahrten überprüft
werden. Deshalb sind gerade die Hersteller von neuen international
vermarkteten Lokomotiven an Fahrten auf dieser Strecke interessiert. Nur
wenige werden dabei auch kommerziell eingesetzt. Mit dem
Depot
Erstfeld
steht zudem unmittelbar bei der
Bergstrecke ein Unterhaltsstandort für
allfällige Anpassungen oder Veränderungen in unmittelbarer Nähe bereit.
Gerade die aus Deutschland kommenden Hersteller schätzen den
deutschsprachigen Standort, der auch über Personal verfügt, das die
italienische Sprache spricht. Gerade dieser Punkt zeigte sich schon früher
mit eigenen
Lokomotiven als grosser Vorteil. Solche Versuche belasteten
die Strecke mit ausserordentlichen Halten und den anschliessenden
Anfahrversuchen zusätzlich. Daher sind Versuchsfahrten mit elektrischen
Lokomotiven am Gotthard selten. Trotzdem sind im Lauf der Jahre viele
Interessante Fahrzeuge an den Gotthard gekommen. Einige davon werden wir
später bei den kommerziellen Einsätzen wieder kennen lernen. Andere
schafften es jedoch nie mehr an den Gotthard. Es fehlen uns nur noch die
Diesellokomotiven. Diese
Lokomotiven kamen am Gotthard ebenfalls zum
Einsatz und dabei hatten diese Fahrten oft weniger die spätere
Zulassung
zum Ziel. Vielmehr führten die Dieseltriebfahrzeuge Messfahrten für die
Infrastruktur durch. Trotzdem es waren immer wieder ausländische
Fahrzeuge, die hier nicht vergessen werden dürfen, denn es gab diese Fahrt
immer wieder.
|
||||||
|
Diesellokomotiven |
||||||
|
Jahr |
Bahn |
Fahrzeug |
Bemerkungen |
|||
|
div. |
Diverse |
Diverse |
Die einzelnen Fahrzeuge der auf die Untersuchung mit Ultraschall
spezialisierten Unternehmen lassen wir weg. Hier wurden
ausländische
Triebwagen verwendet, weil es in der Schweiz keine
solchen Fahrzeuge gab und man nur so die Messungen durchführen
konnte. |
|||
|
2008 |
DB |
VT 612 |
Mit dem VT 612 kam ein thermisch geführtes Fahrzeug
am Gotthard zu mehreren Fahrten. Die Fahrten dienten der Erfassung
von wichtigen Daten für den Einsatz von
Neigezügen. Der Zug
verbrachte seine Nachtlager im
Depot Erstfeld. |
|||
|
Mit den Fahrzeugen, die mit
Dieselmotoren angetrieben werden, haben wir die Betrachtung der Versuche
abgeschlossen. Jedoch bleiben uns noch ein paar Worte zu diesen Einsätzen
und der Tatsache, dass dafür
Diesellokomotiven, respektive
Dieseltriebwagen verwendet wurden. Beginnen werden wir mit den Messfahrten
der diversen ausländischen Firmen, denn diese hatten einen eigenen
Charakter, so dass es spannend wird.
Diese Firmen verwendeten dabei
Dieseltriebwagen, da diese überall in Europa unabhängig der
Fahrleitung
eingesetzt werden konnten. Die
Spannungen der jeweiligen Fahrleitungen
spielten daher keine Rolle. So konnte man unabhängig messen und die Anlagen schnell prüfen. Zumindest schneller, als von Hand. Diese Triebwagen befuhren die Strecken in der Schweiz in eigener Kraft und untersuchten dabei die Schienen auf Fehler. Bedient wurden diese Fahrzeuge
vom jeweiligen Personal. Die notwendigen Vorschriften und Kundigkeiten
vermittelte immer ein Lokführer der schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Zusätzlich war ein weiterer Mitarbeiter dabei, der die Strecke technisch
gut kannte. Mittlerweile sind jedoch
die Vorschriften verschärft worden, so dass diese Fahrten nicht mehr
zugelassen sind. Diese Vorschriften sind bei der
Zugsicherung zu suchen,
denn ein Fahrzeug muss im Land über die vorhandenen Zugsicherungen
verfügen. Daher wurden eigene
Lokomotiven vorgespannt und die
Triebwagen galten als
Anhängelast. Heute kommen jedoch andere Lösungen mit
speziellen Wagen zur Anwendung, so dass die
Triebwagen selten verwendet
werden.
Ähnlich sieht es mit dem VT 612 aus. Hier liegt
jedoch eine beschränkte
Zulassung für die Schweiz vor, so dass der
Triebwagen verwendet werden konnte. Doch damit kommen wir zu den
kommerziellen Einsätzen, denn die bisherigen Fahrten wurden von den
schweizerischen Bundesbahnen SBB bezahlt. Was bei den folgenden
Lokomotiven nicht mehr der Fall ist. Vielmehr verkehren diese
Triebfahrzeuge im freien Netzzugang für andere Unternehmen, aber auch für
die SBB.
|
||||||
|
Kommerzielle Einsätze |
||||||
|
Mit den kommerziellen Fahrten am Gotthard kommen wir
in die moderne Zeit der Eisenbahn. Die meisten Strecken in Europa wurden
mit einer
Fahrleitung versehen und in der Schweiz wurde der freie
Netzzugang für Bahnen im
Güterverkehr eingeführt. Für die beiden Strecken
bedeutete das, dass sie in einem internationalen Korridor lagen und dass
sich hier der Wettbewerb deutlich zeigen könnte. Nur, wie wirkte sich das
auf die
Lokomotiven aus?
Mittlerweile wurden nur noch elektrische
Lokomotiven
verwendet. Die anderen Modelle konnten der modernen Traktion mit
elektrischen Lokomotiven nicht mehr folgen und kamen daher am Gotthard
nicht mehr zum Einsatz. Zwar konnten die
Diesellokomotiven bei der
Anfahrzugkraft noch mithalten, sie verloren jedoch viel an
Geschwindigkeit. Die war aber gefragt, denn die stark belastete Strecke
musste schnell befahren werden können.
Lokomotiven, die am Gotthard eingesetzt werden,
verfügen über hohe
Zugkräfte. Daher werden hier moderne Lokomotiven
verwendet. Diese verfügen zusätzlich über
Vielfachsteuerung und können in
mehreren Ländern eingesetzt werden. Das macht die Lokomotiven sehr
vielseitig einsetzbar. Jedoch beschränkt sich die Sache meistens auf den
Güterverkehr, denn dort sind solche
Leistungen üblich. Daher auch dieser
Abschnitt mit den kommerziellen Fahrten am Gotthard.
Kleinere
EVU können sich kaum eigene
Lokomotiven
leisten, daher greifen diese auf Lokomotiven zurück, die bei speziellen
Firmen gemietet werden können. Diese Lokomotiven gehören dann meistens zum
Bild vor den Zügen am Gotthard. Diese Fahrten zeigen klar, dass der
moderne Verkehr viele spezielle Lösungen bringt. Daher folgen nun
ausschliesslich Fahrzeuge, die über eine in der Schweiz gültige
Zulassung
verfügen und die mit Lokomotiven in der Schweiz vergleichbar sind.
In der folgenden Tabelle, werden nicht mehr alle
Bahngesellschaften aufgeführt. Vielmehr wird hier auf die speziellen
Fahrzeuge Rücksicht genommen. Die einzelnen
EVU setzen oft Maschinen
gemeinsam ein und diese würden dann die Tabelle unübersichtlich werden
lassen. Vielmehr kümmern wir uns um die
Lokomotiven und
Triebzüge, die aus
dem Ausland kommen am Gotthard eingesetzt werden. Dabei gibt es besondere
Überraschungen.
|
||||||
|
Jahr |
Bahn |
Fahrzeug |
Bemerkungen |
|||
| 2001 |
DB |
|
Die Züge der DB sind ausschliesslich mit
Lokomotiven der Baureihe 185 bespannt. Diese Lokomotiven
entsprechen den Lokomotiven
Re 482
der schweizerischen
Bundesbahnen SBB. Daher sind die Lokomotiven der SBB hier genau
beschrieben. |
|||
|
2003 |
Siemens | ES 64 F4 | Die Lokomotive
verkehrt oft als gemietete
Lokomotive am Gotthard. Das einzige
EVU, das dabei eigene Lokomotiven dieses Typs einsetzt, ist
SBB Cargo, die mit den
Re 474 baugleiche Lokomotiven besitzt. |
|||
| 2003 |
Siemens | ES 64 U2 | Die für die ÖBB entwickelte
Lokomotive 1116,
wird am Gotthard von kleineren
EVU eingesetzt. Dabei kommen
ausschliesslich gemietete Lokomotiven zum Einsatz. Die Lokomotiven
sind entweder gelb oder schwarz. |
|||
|
2004 |
Bombardier | TRAXX F140 MS | Die aus der BR 185 weite entwickelte
Lokomotive TRAXX
F140 MS wird als Mietlokomotive eingesetzt.
SBB Cargo verwendet die baugleichen Lokomotiven
Re 484. Damit kommen
auch solche Lokomotiven zum Einsatz. |
|||
|
Einige Punkte beim kommerziellen Einsatz müssen näher
betrachtet werden. Besonders die
Triebzüge
ETR 470 und ETR 610 haben eine
spannende Geschichte hinter sich. So wurden diese Fahrzeuge nach
italienischem Muster bezeichnet und von der durch die Bahnen SBB und FS
gegründete Tochterfirma Cisalpino AG gekauft. Die Züge verfügen über
Neigetechnik und sollten die internationale Reise über den Gotthard
verkürzen.
So führten die permanenten
Verspätungen der Züge zur
Auflösung der Firma Cisalpino AG. Die der Firma gehörenden
Triebzüge
ETR 470 und ETR 610 wurden dabei unter den beteiligten beiden Bahnen
aufgeteilt. Die schweizerischen Bundesbahnen SBB kamen so zu Triebzügen
ETR 470 und ETR 610. Später beschaffte die SBB sogar noch eigene ETR 610
um die ETR 470 zu ersetzen. Die Züge bekamen sogar den Anstrich der
jeweiligen
Staatsbahnen und waren das als deren Züge zu erkennen. Damit gehören die Züge in den Kreis der einheimischen Fahrzeuge und haben eine genauere Betrachtung verdient. Diese beiden eigetnlich ausländischen Züge werden deshalb hier nicht näher erwähnt und werden in zu gegebener Zeit in eigenen Seiten genauer vorgestellt werden. Schliesslich ist nicht die Bezeichnung, sondern der Besitzer für die Wahl der genauen Vorstellung massgebend. Das gilt auch für die ETR 470 und ETR 610. Wobei letztere auch als RABe 503 bezeichnet werden.
Einfach gestalten sich die
Lokomotiven, denn
eigentlich gibt es nur drei Typen die verwendet werden. Das sind die von
Bombardier gelieferte BR 185 / TRAXX F140 MS und die beiden von
Siemens
gelieferten Lokomotiven ES 64 F4 und ES 64 U2. Gerade diese Tatsache
zeigt, wie wenige Lokomotiven international eingesetzt werden können. Die
Vielfalt der Lokomotiven sank dabei, denn kleinere
EVU entwickelten keine
neuen Lokomotiven, sondern mieteten diese einfach.
Jedoch können ab und zu auch
Fahrzeuge beobachtet werden, die geschleppt verkehren. Dabei handelt es
sich oft um Fahrzeuge, die dem Empfänger zugeführt werden. Aber, wie schon
erwähnt, solche Fahrzeuge gelten in der Schweiz als
Anhängelast und werden
daher hier nicht geführt. Jedoch befuhr ein FLIRT, der für das Südtirol bestimmt, war die Strecke über den Gotthard in eigener Kraft. Das obwohl er hier nicht aufgeführt wurde. Der Grund lag in der fehlenden Zulassung für Österreich und Bauarbeiten an der Arlbergstrecke. Deshalb musste der Fahrweg über den Gotthard gewählt
werden. Es handelte sich weder um eine Versuchsfahrt, noch wurde der
Triebzug kommerziell eingesetzt. Sie sehen, es gibt immer wieder spezielle
Fahrten auf der Gotthardstrecke. Es kamen jedoch auch andere
Fahrzeuge, wie ausländische Dampflokomotiven auf der Gotthardstrecke zum
Einsatz. Diese Fahrten erfolgten aber meistens im Rahmen von
Feierlichkeiten oder als Notalgiefahrten. Es kam aber auch zu speziellen
Fahrten, die für Filmaufnahmen getätigt wurden. Dabei muss jedoch erwähnt
werden, dass für solche Fahrten oft der historische Hintergrund fehlt.
Trotzdem werde ich diese hier aufführen, denn auch sie gehören zu den
Fahrten mit ausländischen Fahrzeugen.
|
||||||
|
Film- und Nostalgiefahrten |
||||||
|
Speziell sind Eisenbahnen
in Filmen immer wieder. Brauchen Sie ein paar Beispiele? Gut, dann kennen
Sie sicherlich den Film, bei dem ein Hubschrauber einem modernen Zug in
den
Tunnel folgt. Es stellt sich die Frage, wo bei dem elektrisch
betriebenen Zug die
Fahrleitung ist und das Wunder der kleinen Rotoren des
Hubschraubers. Das reicht nicht? Sehen Sie sich Filme an, denn oft wird
bei den Eisenbahnen getrickst und so finden wir plötzlich eine
FS-Lokomotive in Berlin oder Zürich. Sie sehen, es gibt Tricks,
die in den Filmen erkannt werden, aber auch solche, die kaum auffallen.
Doch, wie entstanden solche Filme? Oft wurde einfach der
Bahnhof
umgetauft. Andere
Bahnlinien wurden schlicht geografisch verschoben und
landeten auf anderen Kontinenten. Die Vielfalt der verwendeten Tricks ist
dabei kaum zu erfassen. Sie werden aber schnell erkennen, dass man
wirklich zu besonderen Lösungen greift. Doch es geht noch schlimmer, denn
was ist, wenn eine Bahnlinie ein Jubiläum feiert?
Niemand erinnert sich dabei an die schweren
Zeiten der
Bahnlinie und besonders bei
Nebenbahnen, an deren drohende
Stilllegung. Man geniesst es, sich in die alten Zeiten zurückzuversetzen.
Daneben präsentiert man natürlich voller Stolz den neusten Fahrzeugpark. Das natürlich auch, wenn die Fahrzeuge auf der Strecke kaum zu sehen sein werden. Ist ja klar, man will seinen Stolz der Öffentlichkeit präsentieren. Die nagelneuen Nahverkehrszüge fahren mit den Reisezügen und lassen die Leute spüren, wie der Nahverkehr ebenfalls aussehen könnte. Am Tag nach der Feier setzt man natürlich wieder die alten Fahrzeuge ein. Feiert jedoch eine Strecke, wie die Gotthardbahn ein Jubiläum, streiten sich die Bahnen auf der halben Welt, wer zu dem Fest reisen darf und wer nicht. Natürlich nimmt man dazu die Dampflokomotiven der Heimat mit und stellt sie auch aus. Das, obwohl
wir nun wissen, dass es auf der
Gotthardbahn kaum oder gar nicht zu
solchen Einsätzen kam. Man will, koste es was es wolle, an dem Fest dabei
sein. So kamen ausländische
Lokomotiven an den Gotthard, die es dort noch
nie gab. Es kommt so zu Nostalgiefahrten, die jeder Realität
widersprechen und die oft, wie wir noch sehen werden, zu Problemen führen.
Trotzdem, die Fahrzeuge wurden auf der Gotthardstrecke eingesetzt und
sollen hier erwähnt werden, auch wenn der historische Aspekt nicht immer
oder gar nicht stimmt. Ändern können wir es nicht, auch wenn uns viele
Punkte abschrecken. Neu nennt man solche Fahrten einen Besuch. Die Kunden
kommen so zu einem Erlebnis, das es nie gab. |
||||||
|
Jahr |
Bahn |
Fahrzeuge |
Bemerkungen |
|||
|
1990 |
FS |
685.196 |
Die Dampflokomotive wurde zwischen Melide und
Lugano für Filmaufnahmen eingesetzt. Wie gut das passte, können
Sie sich selber ausmalen. Denken Sie daran, dass der Dampfzug
unter einer
Fahrleitung verkehrte und dabei eine Strecke befuhr,
die von einer Autobahn begleitet wird. |
|||
|
1997 |
SNCF |
Die Grossdampflokomotive, die dem Klub Mikado 1244 gehört, befuhr anlässlich des 150 Jahr Jubiläums der schweizer Bahnen die Gotthardstrecke. In diesem Jahr als einzige Dampflokomotive in Alleinfahrt. Historisch gab es nie solche Einsätze. | ||||
|
2007 |
DR |
50 3673 |
Anlässlich der 125 Jahr Feier der Gotthardstrecke
befuhr die DR-Reko Dampflokomotive, die sich im Besitz von
Eurovapor befindet am 2. Juni 2007 die Gotthardstrecke. Auch sie
wurde elektrisch unterstützt und entbehrt jeder historischen
Korrektheit. Als die
Lokomotive gebaut wurde, gab es am Gotthard schon
lange keine Dampflokomotiven mehr. |
|||
|
2007 |
ÖBB |
1020 |
Ebenfalls zum 125 Jahr Jubiläum der Gotthardstrecke
fuhr das österreichische Gegenstück zur DB 194 am 7. und 8. Juli
über den Gotthard. Die Lokomotive wird oft einer eigentlichen
Krokodilbauweise zugeschlagen. Dabei handelt es sich wie bei der
Ce
6/8 II um eine
Gelenklokomotive, die jedoch vorher noch nie am
Gotthard war. |
|||
| 2007 |
CSD |
475.111 |
Die beiden Dampflokomotiven 498.022 und
475.111 reisten aus Tschechien zum am 8. und 9. September
stattfindenden Gotthardjubläum. Die Fahrt über die
Bergstrecke
wurde den beiden
Lokomotiven untersagt, so dass sie nur bis
Erstfeld fuhren und dort ausgestellt wurden. Man besuchte die
Gotthardbahn. |
|||
| 2007 |
DB |
01 1066 |
Mit den beiden
Lokomotiven der Reihe 01 wurde
ein unrühmliches Kapitel am Gotthard geschrieben. Bei der Fahrt
über den Gotthard wurden (wohl aus Spektakel) durch die beiden
Lokomotiven so dichte Rauchfahnen ausgestossen, dass die danach
verkehrende
Re 484 in einem
Tunnel
stecken blieb. Auch hier fehlte
jeder historische Hintergrund. |
|||
| 2011 |
SNCF |
241 A 65 |
Auch bei dieser
Lokomotive handelt es sich um
eine gigantische Dampflokomotive. Die Maschine verkehrte am
Gotthard anlässlich des Geburtstages. Man muss jedoch bedenken,
dass im
Depot Erstfeld ältere elektrische Lokomotiven standen.
Daher fehlte auch hier der historische Hintergrund. |
|||
|
Sie sehen, wie viele
Dampflokomotiven sich in den letzten Jahren am Gotthard bemüht haben. Die
meisten dieser
Lokomotiven sind von der Grösse her, um einiges grösser,
als die C 5/6 der schweizerische Bundesbahnen SBB, die als grösste
Dampflokomotive der Schweiz gilt. Blickt man bei den Lokomotiven auf die
Baujahre und vergleicht sie, erkennt man schnell, dass am Gotthard zu
dieser Zeit längst die elektrischen Lokomotiven den Betrieb übernommen
hatten.
Die Folgen sind
dann, dass die Behörden eine Sonderbewilligung erlassen müssen. Die Züge
dürfen dann keinen anderen Zügen begegnen, was wiederum zu betrieblichen
Problemen führt. So gesehen, sind fremdländische Dampflokomotiven immer
ein Problem. Die Geschichte der beiden Lokomotiven der Baureihe 01 zeigt deutlich, wie problematisch solche Schaulaufen mit einer nicht zur Strecke passenden Lokomotive sein kann. Die deutsche Schnellzugslokomotive im Gebirge passte irgendwie nicht so richtig ins Bild. So mussten zwei
Lokomotiven verwendet werden. Um den Fotografen zudem ein Spektakel bieten
zu können, rauchte man mit den Lokomotiven künstlich. Was sicher gute
Bilder gibt. Wenn man dann überlegt, dass die Gotthardbahngesellschaft, wegen unnötigem Qualmen in Tunnel, drakonische Strafen aussprach, fragt man sich, warum das 125 Jahre später kein Problem mehr sein sollte? Der Reisezug, der danach wegen dem Rauch im Tunnel stecken blieb, zeigte die Probleme deutlich auf. Wie wäre gewesen, wenn es wegen einer solchen Aktion zu Opfern unter den Reisenden gekommen wäre? Bei solchen Fahrten verfügt das bedienende Personal
nicht immer über die notwendige
Streckenkenntnis. Man weiss daher nicht,
wo die Probleme der Strecke zu finden sind. Moderne
Lokomotiven haben dann
ein Problem, das nicht mit Vorschriften verbessert werden kann. Die Folgen
waren klar, die Strecke wurde für alleine fahrende Dampflokomotiven
gesperrt. Büssen dürfen es nun die Fotografen, die die schönen Bilder
machten. Bei den elektrischen
Lokomotiven sind die Probleme nicht geringer. Auch diese wurden im Ausland
für den Betrieb im eigenen Land gebaut. Moderne Lokomotiven mussten an die
Schweiz angepasst werden, damit man sie einsetzen konnte. Bei den
ausländischen elektrischen Lokomotiven ist das oft nicht der Fall. Daher
sind auch hier viele Fragezeichen zu stellen, denn am schönsten ist eine
Lokomotive immer noch in ihrer Heimat, vor einem passenden Zug.
|
||||||
|
Versuche im Basistunnel |
||||||
|
Heute werden neue Strecken für schnelle Züge gebaut.
Da unterscheidet sich die Schweiz nicht sonderlich von den anderen
Ländern. Mit der NEAT und dem
Basistunnel am Gotthard erreichten solche
Strecken auch den Alpenraum. Da die betreibenden Bahnen oft nicht über die
passenden Fahrzeuge verfügen, müssen für die Fahrten andere
Lokomotiven
beigezogen werden. Das hat zur Folge, dass die schnellen Züge aus dem
Ausland kommen müssen.
Dort konnten die ersten Versuche im
Tunnel
stattfinden.
Erst später kamen dann die Versuche, die den ganzen Tunnel benötigten.
Jedoch war das Problem der lange Tunnel, denn mit 57 Kilometer übertraf er
alles Bisherige deutlich. Zudem wurden im Innern des Basistunnels Temperaturen erwartet, die klimatisch hohe Anforderungen an die Triebfahrzeuge stellen sollten. Gerade die schnelle Fahrt sollte zeigen, wie leistungsfähig Klimaanlage sind und was die Lokomotiven zu leisten vermögen. Die Fahrt
muss daher mit den passenden Fahrzeugen erfolgen. Die Vielzahl der im
Basistunnel eingesetzten ausländischen
Lokomotiven und
Triebwagen, war bei
den Versuchsfahrten daher nicht besonders gross. Zudem standen am Schluss
eigene Züge bereit. Sie haben richtig gelesen, am Schluss hatte man bei
den Versuchsfahrten die eigenen
Triebzüge verwendet. Die Sache ist
eigentlich klar, denn wer baut eine Strecke, auf der mit 250 km/h gefahren
werden kann und befährt sie dann nicht mit dieser Geschwindigkeit?
Niemand, denn man will den sich so bietenden Vorteil nutzen. Daher muss
man spezielle Züge für die neue Strecke anschaffen. Die erscheinen dann
meist kurz vor der Eröffnung. Am besten blicken wir zuerst auf die eingesetzten
ausländischen Fahrzeuge. Danach können wir dann einen Blick auf die
Einsätze und die einheimischen
Lokomotiven werfen. Sie werden sehen, dass
heute Versuchsfahrten auf neuen Strecken umfangreicher sind, als das noch
bei der Eröffnung der
Gotthardbahn im Jahre 1882 war. Man fährt heute
wesentlich schneller, was automatisch mehr Versuche mit sich bringt, als
früher.
|
||||||
|
Jahr |
Bahn |
Fahrzeuge |
Bemerkungen |
|||
|
Mit dem Abschluss der Versuchsfahrten im
Basistunnel
können wir uns ein paar Gedanken über die dabei eingesetzten Fahrzeuge
machen. Bevor wir damit beginnen können, benötigen wir ein paar Details
zur Strecke. So wird der 57 Kilometer lange
Tunnel
mit einer maximalen
Geschwindigkeit von 250 km/h befahren. Die kurzen Zufahrten dienen dabei
zur Beschleunigung des Zuges. Daher müssen speziell
Triebzüge für den
Hochgeschwindigkeitsverkehr verwendet werden. Zur Zeit des Baus gab es solche Fahrzeuge in der
Schweiz, aber es handelte sich um ausländische Baureihen, die von den
schweizerischen Bundesbahnen SBB gekauft wurden. Dazu gehörten die
Triebzüge
TGV und ETR 610. Beide Typen kamen durch die Zusammenarbeit zu
den schweizerischen Bundesbahnen SBB. Sie sehen, man hatte eigene Züge, so
dass faktisch kaum fremde Triebzüge verwendet werden mussten. Gerade diese Tatsache zeigt deutlich, dass man in der
Schweiz bis vor wenigen Jahren davon ausging, dass man maximal 200 km/h
fahren würde. Die
Triebzüge, die mit Geschwindigkeiten bis 250 km/h fahren
konnten, beschaffte man schlicht nicht. Kommt hinzu, dass die Strecke bei
den Versuchen noch schneller befahren wird, denn es gilt immer die
Höchstgeschwindigkeit plus 10%. Im
Basistunnel ergibt das eine
Geschwindigkeit von 275 km/h. Weiter nach der Inbetriebnahme
|
||||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | ||||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |||
|
Copyright 2015 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |
||||||
 Mit
der
Mit
der
 Zuerst
haben wir die Steigungen. Diese steilen Abschnitte stellen an
Zuerst
haben wir die Steigungen. Diese steilen Abschnitte stellen an
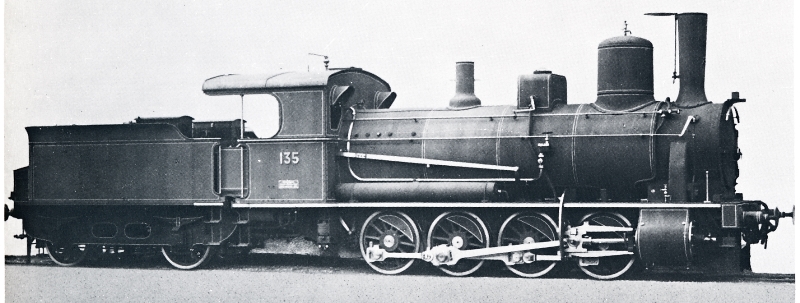 Wenn
Sie die
Wenn
Sie die  Die
Die
 Die bei den Versuchen nicht
erwähnte Baureihe ES 64 U2 von
Die bei den Versuchen nicht
erwähnte Baureihe ES 64 U2 von
 Eigentlich passiert bei
solchen Anlässen nicht viel. Die betreibende Gesellschaft sucht
verzweifelt nach einem alten Fahrzeug, das dann die vergangene Zeit
symbolisieren kann. Das erfreut die Besucher, die so in der Nostalgie der
Strecke schwelgen können.
Eigentlich passiert bei
solchen Anlässen nicht viel. Die betreibende Gesellschaft sucht
verzweifelt nach einem alten Fahrzeug, das dann die vergangene Zeit
symbolisieren kann. Das erfreut die Besucher, die so in der Nostalgie der
Strecke schwelgen können. Viele der ausländischen
Dampflokomotiven mussten seinerzeit vergrössert werden, damit die grossen
Viele der ausländischen
Dampflokomotiven mussten seinerzeit vergrössert werden, damit die grossen
 Der
Der