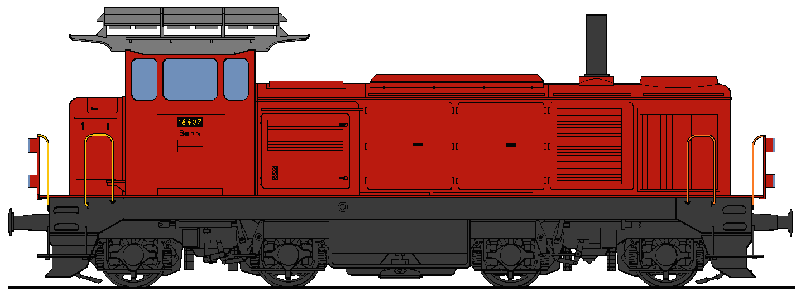|
Betriebseinsatz |
|||||
| Navigation durch das Thema | |||||
|
Als die erste Bm 4/4 am 20. Oktober 1960 in Genf von den SBB übernommen wurde, war klar, die Bm 4/4 mit der Nummer 18'401 war zu spät abgeliefert worden. Nicht, dass die Hersteller lange Verzögerungen hatten, aber für die nicht elektrifizierten Strecken war sie zu spät. Auf den Linien nach Niederwenigen und Luino fuhren die Züge bereits elektrisch. Die Lokomotive konnte dort also nicht mehr eingesetzt werden. Wie das mit neuen Lokomotiven üblich ist, die Lokomotive wurde zuerst grundlegend gestestet und überprüft. Diese Tests führten die Lokomotive in fast alle Gegenden der Schweiz, denn die Lokomotive sollte ja eine weite Verbreitung finden und so musste das ganze Netz befahren werden. Letztlich wurde diese erste Lokomotive noch mit weiteren zwei Maschinen ergänzt, so dass Ende 1960 drei Bm 4/4 zur Verfügung standen. Die Versuche zeigten, die Lokomotive konnte trotz dieser kurzen Bauweise die geforderten Aufgaben vollumfänglich übernehmen. Die Bm 4/4 war somit die kürzeste Lokomotive ihrer Leistungsklasse in ganz Europa. Das war gerade in den engen Platzverhältnissen der Schweiz ein grosser Vorteil. Die Bm 4/4 begann den Verantwortlichen der SBB zu gefallen. Ab 1961 standen dann die ersten sechs Lokomotiven bereit und wurden immer mehr in Diensten der letzten Dampfloks eingesetzt und machten sich dort gut, so dass die SBB gleich 20 Lokomotiven einer ersten Serie bestellte und so die Anzahl Bm 4/4 auf die gleiche Menge erhöhte, wie das bei den älteren Bm 6/6 der Fall war. Man hatte nun also zwei grosse Diesellokomotiven im Bestand, die immer mehr den schweren Rangierdienst von den Dampfloks übernahmen. Ab 1964 setzte dann die Ablieferung der ersten Serie ein. Die Lokomotiven wurden nun in immer mehr Gegenden eingesetzt und lösten dort immer wieder Dampflokomotiven ab. Gerade die Dampflokomotiven vor den Hilfswagen wurden durch die Bm 4/4 ersetzt und so kam es, dass man mit Ablieferung der letzten Lok dieser ersten Teilserie die Dampfloks als abgestellt betrachtete. Die Lokomotive kam daher in immer mehr Bahnhöfen mit grossen Anlagen ohne Fahrleitung zum Einsatz. Dort zeigten die Lokomotiven immer wieder, dass sie durchaus auch vor den schweren Aufgaben nicht zurücksteckten. Die Lokomotive machte sich gut und die elektrische Bremse verringerte den Verschleiss an Bremsklötzen gegenüber der schweren Bm 6/6 erheblich. Kam hinzu, dass in jedem Depot mindestens eine Bm 4/4 stationiert wurde. Sie war dort oftmals einfach als thermische Reserve abgestellt und wurde selten bewegt. Die Aufgabe konnte man mit der Lokomotive sehr gut abdecken, denn sie war ja ideal für solche Aufgaben. Mehr Mühe bekundete jedoch das Personal mit der Lokomotive. Einerseits beklagten sich immer mehr Lokführer über Kopfschmerzen nach Einsätzen auf der Bm 4/4 und andererseits waren da jene Kollegen, die mangelnde Kenntnisse ins Feld führten. Gerade dort, wo nur eine einzige Bm 4/4 vorhanden war, kam viel Personal nur selten oder gar nie auf die Lok, obwohl es diese kannte und bedienen musste, wenn es zur Störung kam. Die Einsätze waren daher sehr unterschiedlich. Die Bm 4/4 wurde auch immer wieder von den Bahndiensten verlangt, so dass an allen Ecken Lokomotiven fehlten. Gerade in Abschnitten, wo steile Strecken befahren werden mussten, war die Lok gefragt, denn sie hatte mehr Leistung, als die Fahrzeuge der Baudienste und konnte dank der elektrischen Bremse auch die Talfahrten besser verkraft. So war klar, es mussten weitere Bm 4/4 angeschafft werden, wollte man den Mangel beseitigen. Die SBB bestellen daher eine weitere Serie von 20 Lokomotiven dieser Baureihe. Diese letzte Serie wurde zwischen 1968 und 1970 angeliefert. Die letzte Bm 4/4, die abgeliefert wurde, war die 18'446, die am 20. Oktober 1970 übernommen wurde. Die Bm 4/4 wurden also in einem Zeitraum von 10 Jahren abgeliefert. Genau heisst das, zwischen dem 20. Oktober 1960 und dem 20. Oktober 1970. Ob dabei die letzte Bm 4/4 absichtlich zurückgehalten wurde, lässt sich nicht sicher sagen. Bekannt ist nur, es war die einzige 1970 abgelieferte Bm 4/4. Was nun auch klar war, die Bm 4/4 war die grösste Serie Diesellokomotiven in der Schweiz. Diese Leistung wurde erst wieder mit den Am 843 erreicht, also mit der Lok, die die Bm 4/4 ersetzen sollte, aber noch sind wir davon weit entfernt. Die Lokomotive arbeitete unscheinbar in allen Gegenden der Schweiz. Besonders häufig an Orten, wo grosse Anlagen bestanden. Das waren beispielsweise die Rangierbahnhöfe in Basel und im Tessin. An anderen Orten war man jedoch froh, wenn die Lok nicht mit dem Hilfswagen auf Reise gehen musste und sich nur ab und zu im Rangierdienst sehen liess. Bekannt wurde die Lok jedoch ausser in Fachkreisen nicht.
Nachdem die Lokomotive nun das Land erobert hatte, fehlte eigentlich nur noch der Einsatz, der in die Geschichte eingehen sollte. Dieser kam im Frühling 1975. Nach dem der Winter eher lauwarm und schneearm war, setzten im April 1975 in den Alpen starke Schneefälle ein. Die Gotthardstrecke musste am 6. April gesperrt werden. Lawinen hatten Teile der Strecke überrollt und dabei die Fahrleitung, wie auch Brücken und Masten beschädigt. Der Gotthard wurde an den darauf folgenden Tagen zum Eldorado für thermische Fahrzeuge. In Erstfeld wurde eiligst die Dampfschneeschleuder, also das letzte mit Dampf betriebene Fahrzeug der SBB angeheizt und eine Bm 4/4 absolvierte auf der gesperrten Strecke eine einsame Fahrt durch den Schnee. Diese nicht ungefährliche Fahrt durch den meterhohen Schnee bestätigte die Sperrung und auch die an der Lok montierten Bahnräumer. Die Gotthardstrecke, eine der dichtesten befahrenen Bahnlinien in Europa, versank in der Folge im Schnee. Die Lawinen hatten dafür gesorgt, dass auch die stärksten elektrischen Lokomotiven zu Hause bleiben mussten. Die Mannen des Depots Erstfeld machten sich, nachdem die Lawinengefahr abgeklungen war auf den Weg zur Freilegung der Strecke. Dabei schob die Hilfslokomotive des Depots, also die Bm 4/4, die uralte Schneeschleuder den Gotthard hoch. Die beiden Fahrzeuge begannen mit viel Schall und Rauch die Strecke vom Schnee zu befreien. Da die Fahrleitungen auf mehreren Abschnitten beschädigt wurden, konnten die elektrischen Lokomotiven auch nicht fahren, obwohl eigentlich die Strecke frei und befahrbar war. Besonders schlimm betroffen war dabei der Abschnitt zwischen Wassen und Göschenen. Dort war die Rohrbachbrücke wieder ein Opfer der Lawine geworden und die Fahrleitung musste auf mehreren Abschnitten repariert werden. Trotzdem, der Betrieb musste aufgenommen werden. Jetzt schlug die Stunde der grossen Diesellokomotiven. Am 11. April wurde der Betrieb mit einem speziellen Fahrplan wieder aufgenommen. Dieser berücksichtigte, dass auf dem Abschnitt zwischen Wassen und Göschenen kein elektrischer Betrieb möglich war und die Züge thermisch zu führen sind. Die einzigen Loks dafür waren die Bm 4/4 und die Bm 6/6. Man bildete mit diesen Maschinen Pärchen, die aus Bm 4/4 und Bm 6/6 bestanden und spannte diese vor die mit elektrischen Lokomotiven bis zu den Übergangsbahnhöfen geführten Züge. Die Diesel hatten nun die Aufgabe, den Zug mitsamt der hilflosen elektrischen Lokomotive über die Abschnitte ohne Fahrleitung zu führen. Es donnerte wohl kräftig, wenn die beiden Diesellokomotiven den Gotthard hoch krochen. Oft wurde die rettende unter Spannung stehende Fahrleitung mit letzter Kraft erreicht. Dort bügelte die elektrische Lokomotive während der Fahrt auf und schaltete ein. Danach beschleunigte sie den Zug wieder und schob dabei die beiden Diesel, die nun die Arbeit getan hatten nach Göschenen, wo diese entfernt wurden und nach Wassen zurückkehrten, dabei half die elektrische Bremse der Bm 4/4. Vorspann auf der Talfahrt wurde nicht gestellt, da dort die Züge mit der Schwerkraft fahren konnten. Gerade die hier erwähnte Situation zeigt deutlich, wenn die Diesel auf die Strecke gelassen wurden, waren oft die elektrischen Lokomotiven in Not geraten, oder es mussten Teile von Zügen geborgen werden. Sonst blieben die Bm 4/4 mit wenigen, dafür umso spannender Fälle immer in den Bahnhöfen und machten sich dort nützlich. Die Lokomotive wurde wirklich nahezu überall zum Hilfsdiesel für Notfälle. Die Bm 4/4 waren auch immer wieder vor Reisezügen zu sehen. Diese speziellen Einsätze fanden aber ausschliesslich auf der mit Gleichstrom elektrifizierten Strecke zwischen Genève und La Plaine statt. Fielen beide dort eingesetzten BDe 4/4 II Triebwagen aus, waren die Bm 4/4 gefragt. Die Lokomotiven bildeten einen Ersatzzug mit speziellen Leichtstahlwagen. Die fehlende Heizleitung wurde mit einem, auf einem der Wagen montierten, Stromabnehmer gelöst. Abgesehen von diesen speziellen Fällen, waren die Bm 4/4 in den Rangierbahnhöfen der ganzen Schweiz zu sehen. Dabei kam an einzelnen Orten die Bm 4/4 auch als Ersatz für eine Ee 3/3 zum Einsatz. Dabei waren das aber oft Einsätze, die dazu benutzt wurden, die Lokführer auf der Lokomotive kundig zu halten, denn diese Loks rückten sonst nur mit dem Hilfswagen aus. Die ruhigen Jahre wurden eigentlich selten durch auffällige Aktionen unterbrochen. Die ersten Bm 4/4 bekamen ab 1984 einen neuen Anstrich in Rot und wurden dann immer zu den schmutzigen Lokomotiven, denn der Russ aus den Abgasen verschmutzte den Vorbau und die Lokomotive. Aber abgesehen von dieser Massnahme waren die Einsatzjahre dieser Lokomotive sehr ruhig verlaufen.
Es war das Jahr 1996, als sich erstmals eine folgenschwere Situation einstellte. Die Bm 4/4 mit der Nummer 18'417 erlitt in diesem Jahr in Nyon einen schweren Anprall. Die Maschine wurde danach in der Hauptwerkstätte Biel, wo die Bm 4/4 unterhalten wurden, untersucht und als nicht mehr zu retten bezeichnet. So wurde diese Lokomotive als erste ihrer Bauart am 30. November 1996 ausrangiert. Wenig später war es dann die 18'414 die den Leuten auffiel. Am Kamin dieser Lokomotive war nicht mehr nur Rost, sondern das Wappen des Kantons Bern zu sehen. Die Lokomotive war so sicherlich etwas verschönert worden, doch war der Grund anderweitig zu suchen. Die Lokomotive wurde nämlich mit dem Funk für das Streckennetz der RBS ausgerüstet und auf dem dortigen Dreischienengleis eingesetzt. Der Berner Bär half bei der Suche nach dieser Lokomotive. Mit der Teilung der SBB in mehrere Bereiche, waren die Bm 4/4 die begehrtesten Lokomotiven. Waren bei anderen Lokomotiven die Nummern auf die Bereiche Personen- oder Güterverkehr aufgeteilt worden, stritten sich nun alle drei Bereiche des Unternehmens um diese begehrten Diesellokomotiven. Niemand wollte auf die Maschinen verzichten. So kam es, dass die Loks auf alle drei Bereiche verteilt wurden. Dabei kam ein so komplizierter Schlüssel zur Anwendung, dass die Nummern nicht gruppiert werden konnten. Der Grund lag dabei einfach in der Tatsache, dass die Bm 4/4 einfach dort, wo sie sich gerade befand platziert wurde. War also eine Bm 4/4 gerade mit Bauzügen beschäftigt, gab es eine Lok der Infrastruktur und so weiter. Daher hilft hier wirklich nur eine Tabelle um die Übersicht zu bewahren.
|
|||||
| Infrastruktur | Personenverkehr | Güterverkehr | |||
| 18'402 | 18'442 | 18'409 | 18'401 | 18'423 | |
| 18'403 | 18'443 | 18'415 | 18'405 | 18'424 | |
| 18'404 | 18'444 | 18'418 | 18'407 | 18'426 | |
| 18'406 | 18'445 | 18'420 | 18'408 | 18'427 | |
| 18'412 | 18'446 | 18'410 | 18'428 | ||
| 18'425 | 18'411 | 18'429 | |||
| 18'436 | 18'413 | 18'430 | |||
| 18'437 | 18'414 | 18'431 | |||
| 18'438 | 18'416 | 18'432 | |||
| 18'439 | 18'419 | 18'433 | |||
| 18'440 | 18'421 | 18'434 | |||
| 18'441 | 18'422 | 18'435 | |||
|
Nun, ein Blick auf die Tabelle lässt klar erkennen, dass die Lokomotive im Bereich des Personenverkehrs nicht optimal verwendet werden konnte. Diese vier Maschinen waren daher oft in einem Depot hinterstellte Bm 4/4, die zusammen mit dem zugehörigen Hilfswagen und dem Personal zum Personenverkehr zugeteilt wurden. Das war wie gesagt, oft der Fall, darum kam es zu dieser Zerstückelung der Nummern. SBB Cargo nahm die Bm 4/4 mit der Nummer 18'408, welche in Bern stationiert war und rüstete diese Lokomotiven für den Einsatz auf dem Dreischienengleis des RBS ein. Neue Vorschriften verlangten dabei, dass man es nicht bei einem Umbau des Funkes belassen konnte. Die Maschine wurde deshalb mit der auf den Strecken des RBS verwendeten Zugsicherung ausgerüstet. Eigentlich änderte sich im Einsatz der Maschine mit der Verteilung wenig bis gar nichts. Die Lokomotiven wurden also immer noch so eingesetzt, wie das bisher der Fall war. Nur war das entweder für diese oder die andere SBB-Division. Dabei kam es selten zu wilden Verschiebungen zwischen den Divisionen, so dass die oben aufgezeigte Aufteilung überraschend klar bestand hielt. Die neuen Am 843, die an die diversen Unternehmensteile geliefert wurden, sorgten dafür, dass die Bm 4/4, die nun auch schon bis zu 45 Jahre alt waren, unter Druck gerieten. Die nun geltenden Umweltschutzauflagen konnte die Bm 4/4 mit ihrer alten Technik nicht einhalten und so wurden immer wieder Am 843 statt Bm 4/4 verwendet. So war klar, dass die Bm 4/4 nicht mehr lange im Einsatz stehen würden. Man stellte daher die Neuanstriche der Bm 4/4 ein. Das führte dazu, dass es bei dieser Lokomotive nie zu unterschiedlichen Farbgebungen der einzelnen Teilbereiche kam. Die Bm 4/4 waren daher entweder rotbraun oder rot und dabei sollte es dann auch bleiben. Die Lokomotive war einfach zu alt geworden und die neueren Modell hatten mehr Leistung waren umweltschonender und so weiter. Die Verantwortung für die Hilfswageneinsätze oblag bisher immer den Depots. Dort war geeignetes Material und Personal vorhanden. Doch die Einführung einer Betriebswehr änderte dies grundlegend. Man hatte nun eine professionelle Einsatztruppe, die schnell einsatzbereit war. Diese Truppe wurde aber von den Verkehrsunternehmen in die Infrastruktur verschoben, was natürlich auch für das Rollmaterial galt. Man kann sich nun fragen, ob das sinnvoll war oder nicht. Es war sinnvoll! Der freie Netzzugang brachte immer mehr unterschiedliche Eisenbahnunternehmen hervor. Nun bestimmt man, dass SBB Cargo zum Beispiel die Hilfsdienste übernehmen muss, wer hilft dann aber einer entgleisten Lok von TXL oder der DB? Genau, niemand, denn welche Firma hilft schon freiwillig der Konkurrenz oder einem Mitbewerber, wie es neu besser heisst. Es kam nun aber auch zu ersten Ausrangierungen von Bm 4/4. Dabei waren es immer öfters Ausmusterungen, die wegen dem schlechten Zustand oder wegen grösserer Schäden erfolgten. Sie müssen sich denken, dass die Motoren ebenso alt, wie die Lokomotive waren. Gerade diese Tatsache zeigt, wie gut diese Motoren aus Winterthur waren, denn kaum ein Fahrzeug auf der Strasse macht das so lange im täglichen Einsatz. Mit den Nummern 18'402, 18'409, 18'411, 18'417 und 18'421 verschwanden so fünf Bm 4/4 von der Bildfläche. So waren also bis am 1. Januar 2006 erst fünf Bm 4/4 ausrangiert und zum Teil abgebrochen worden. Man würde nun vermuten, dass diese Ausmusterungen zu grossen Veränderungen in den Listen geführt hätte. Wir schauen uns daher besser die Liste von 2000 an und markieren die bis 2006 erfolgten Veränderungen.
|
|||||
| Infrastruktur | Personenverkehr | Güterverkehr | |||
| 18'402 | 18'443 | 18'409 | 18'401 | 18'423 | |
| 18'403 | 18'444 | 18'415 | 18'405 | 18'424 | |
| 18'404 | 18'445 | 18'418 | 18'407 | 18'426 | |
| 18'406 | 18'446 | 18'420 > Cargo | 18'408 | 18'427 | |
| 18'412 | 18'410 | 18'428 | |||
| 18'425 | 18'411 | 18'429 | |||
| 18'436 | 18'413 | 18'430 | |||
| 18'437 | 18'414 | 18'431 | |||
| 18'438 | 18'416 | 18'432 | |||
| 18'439 | 18'419 | 18'433 | |||
| 18'440 | Von P > 18'420 | 18'434 | |||
| 18'441 | 18'421 | 18'435 | |||
| 18'442 | 18'422 | ||||
|
Wir sehen, die Lokomotiven blieben sich treu und wurden mit einer einzigen Ausnahme nicht umgeteilt. Das zeigt eigentlich auch, dass die Lokomotive immer noch benötigt wurde. Die Reduktionen beim Personenverkehr kann klar begründet werden, denn es war ja SBB Cargo, die Anschlussgleise ohne Fahrleitung zu bedienen hatte. Daher auch dort die grosse Anzahl Bm 4/4. Die ausrangierten Bm 4/4 wurden nicht immer sofort abgebrochen. So wurde die Bm 4/4 18'411 zwar ausrangiert, danach jedoch abgestellt und schliesslich verkauft. Sie wurde von der Firma Marti AG übernommen und ab dem Jahr 2007 als Bm 840'111-9 eingesetzt. Die Lokomotive war leuchtend gelb gespritzt worden und trug gross die Anschrift Tunnel. Erstmals eingesetzt wurde die Lokomotive bei der Sanierung der Tunnels an der Axenstrecke.
Da nun alle Am 483 im Einsatz standen, war zu befürchten, dass nun eine grosse Welle der Ausrangierungen kommen würde. Diese blieb jedoch aus und so gab es in den Jahren 2007 und 2008 nur gerade zwei Ausmusterungen. Diese betrafen die Bm 4/4 18'404 und 18'418. Unverändert blieben jedoch die Zuteilungen, denn eigentlich änderte sich am Einsatz wenig. Auf den 1. Januar 2009 war es dann um die älteste Bm 4/4 geschehen. Die Lokomotive 18'401 wurde nach einem Einsatz von etwas mehr als 48 Jahren ausrangiert und abgebrochen. Doch noch immer war mit der Bm 4/4 11'403, 18'405 und 18'406 drei Prototypen im täglichen Einsatz vor den Lösch- und Rettungszügen, sowie vor den Hilfswagen an den diversen Standorten der Betriebswehr und natürlich in täglichen Einsätzen bei SBB Cargo. Die 50 Jahre alten Lokomotiven wurden ab 2010 noch schneller. Zwar schafften sie das nicht aus eigener Kraft, sondern sie mussten geschleppt 80 km/h aushalten. Diese Steigerung für die geschleppte Lokomotive nach 50 Jahren zeigte, dass man immer noch auf die Bm 4/4 angewiesen war, die Am 841 und die Am 843, welche die Bm 4/4 ersetzen sollten, schafften das noch nicht.
|
|||||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |||
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | ||
|
Copyright 2010 by Bruno Lämmli Erstfeld: Alle Rechte vorbehalten |
|||||