|
Fahrwerk mit Antrieb Xrotm 2/3 Nr. 97 - 98 |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Die Schneeschleuder stand auf einem mit drei
Achsen
versehenen
Drehgestell.
Dieses Drehgestell war kräftig ausgeführt worden und wurde als Fahrgestell
bezeichnet. Der Grund dafür lag beim Rollendrehkranz, der den Drehpunkt
des Aufbaus bildete. Seine Ausführung unterschied sich nicht vom der
elektrischen Schneeschleuder Xrote.
Einzig der automatische
Antrieb
für die Abdrehung war eine Änderung, die umgesetzt wurde.
Diese arretierten den oberen Teil gegenüber dem
Fahrwerk.
So können wir vermerken, dass im Fahrbetrieb das Verhalten einer Maschine
mit Rahmen vorhanden war. Es gab daher kaum Unterschiede zur Reihe
Em 3/3. Aufgebaut wurde dieses Drehgestell jedoch aus normalem Stahl. Dieser wurde mit einer grauen Farbe behandelt. Zusam-men mit dem Oberbau haben wir einen schlichten Anstrich erhalten.
Wobei dort die
Griffstangen
gelb behandelt wurden. Der farb-liche Tupfer im Bereich des Fahrgestells
war lediglich das
Handrad
für die
Feststellbremse.
Diese war in einer roten Farbe gehalten, so dass es gut zu erkennen war.
Im Rahmen wurden drei
Achsen
mit der Hilfe von doppelreihigen
Rollenlagern
eingebaut. Die vertikale Führung war hingegen als mit
Fett
geschmiertes
Gleitlager
ausgeführt worden. Da hier nur die beiden äusseren Achsen mit einem
Antrieb
versehen wurden, war die
Achsfolge
A1A vorhanden. Ein Antrieb auf alle Achsen sah man bei der Schneeschleuder
nicht als angebracht an, da hier keine grossen
Anhängelasten
gezogen werden mussten.
Unterschiedlich war auch der Durchmesser der auf den
Achsen
aufgepressten
Räder.
Die Vollräder der beiden Triebachsen hatten neu einen Durchmesser von 850
mm erhalten und sie besassen
Bandagen
als Verschleissteil. Eine Lösung, die damals bei
Triebachsen
durchaus üblich war. Bei der
Laufachse
reduzierten die Hersteller den Durchmesser auf 730 mm. Zudem wurde hier
ein
Monoblocrad
verwendet, welches das Gewicht zusätzlich verringerte.
Man machte sich hier die Erfahrung nützlich, denn mittlerweile
wussten die Konstrukteure, dass Schnee und Eis die mechanischen Funktionen
einer Schneeschleuder behindern konnten und daher so wenig bewegliche Teil
wie möglich verwendet wur-den. Die Achslasten waren nicht identisch ausgeführt worden. Die Konstrukteure wollten eine möglichst grosse Belastung der Triebachsen erreichen. Daher wurde hier eine Achslast von 19.5 Tonnen angege-ben.
Das
Adhäsionsgewicht
der Schneeschleuder betrug deshalb 39 Tonnen. Ein Wert, der für den
geplanten Einsatz als alleine fahrendes Fahrzeug durchaus nachvollzogen
werden kann, zudem wurde so die
Streckenklasse
C eingehalten.
Bei
der
Laufachse,
die wegen den
Kuppen
und
Senken eine weichere Abfederung erhalten hatte und seitlich
verschiebbar ausgeführt wurde, war eine
Achslast
von 18 Tonnen erreicht worden. Das war nur unwesentlich weniger, als bei
den
Triebachsen.
Daher kam die Schneeschleuder auf ein Gesamtgewicht von 57 Tonnen und der
feste Radstand betrug 4 500 mm. Ein Wert der damals durchaus auch bei
Lokomotiven
angewendet wurde.
Jede
Triebachse
wurde von einem eigenventilierten
Gleichstrommotor
angetrieben. Diese
Ventilation
war sicherlich nicht optimal, sie konnte jedoch wegen dem Aufbau nicht
anders gelöst werden. Das hatte unweigerlich zur Folge, dass die
Leistung
der Motoren wegen der
Kühlung
nicht optimal genutzt werden konnte. Maximal konnte jeder
Fahrmotor
90 kW erzeugen. Für die Schneeschleuder ergab das einen Wert von 180 kW,
was ansprechend war.
Die
Übersetzung
betrug im Fall der Schneeschleuder
1 :
4.94. Damit können wir erkennen, dass die Übersetzung so ausgelegt
wurde, dass möglichst hohe
Zugkräfte
erzeugt werden. Diese wurden bei der
Schneeräumung
benötigt. Die Schleuder erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Diese konn-te auch in den Steigungen der Gotthardstrecke erreicht werden. Das erlaubte eine schnelle Fahrt zur Räumung. Dort sank der Wert für die Geschwindigkeit jedoch deutlich.
Das war dadurch bedingt, dass nun der kleinere
Generator
für den Fahrantrieb genutzt wurde. Jedoch musste jetzt das Tempo auch den
Aggregaten ange-passt werden, denn schnell war die Räumung nicht.
Es wurde eine
Anfahrzugkraft
von 57 kN erreicht, welche durchaus bei den Geschwindigkeiten während der
Schleudertätigkeit gehalten werden konnte. Bei der
Leistungsgrenze,
die hier bei 21 km/h lag, konnte während der Dauer von einer Stunde noch
eine
Zugkraft
von 29.4 kN erzeugt werden. Daher war die Maschine auf den Einsatz als
Schneeschleuder ausgelegt worden und nicht dazu geeignet um schwere
Anhängelasten
zu befördern.
Die Schneeschleuder konnte mit drei unterschiedlichen
Bremsen
verzögert werden, jedoch erlaubten nur zwei Bremsen, dass damit auch
angehalten werden konnte. Für die Talfahrt in den
starken Gefällen
am Gotthard war für alleine verkehrende
Triebfahrzeug
eine verschleisslose Bremse vorgeschrieben. Damit dafür keine zusätzliche
Lokomotive
vorgespannt werden musste, war eine
Widerstandsbremse
vorhanden.
Diese wurden durch den Fahrtwind gekühlt und wa-ren so ausgelegt
worden, dass die Talfahrt problem-los möglich wurde. Das war jedoch ein
deutlicher Unterschied zu den
Diesellokomotiven. Beide pneumatischen Bremsen der Schneeschleuder konnten dazu genutzt werden um damit anzuhalten. Dabei war die direkt wirkende Rangierbremse vor-handen, die mit einem Druck von 3.9 bar arbeitete.
Diese
Bremse
wurde mit einem üblichen
Bremsventil
der
Bauart
FD 1 bedient und unterschied sich daher nicht von anderen Baureihen der
Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Ein Umstand, der die Schulung
vereinfachte.
Die
Rangierbremse
kam auch während der Schleuderbetriebes zur Anwendung, weil damit präziser
abgebremst werden konnte, als das mit der
automatischen Bremse
möglich war. Zudem war die
direkte Bremse
auch in der Lage, die Maschine aus der maximalen Geschwindigkeit bis zum
Stillstand zu verzögern. Bei der möglichen
Bremskraft
gab es nämlich keinen Unterschied zur zweiten eingebauten Bremse der
Schneeschlauder.
Die
automatische Bremse
der Schneeschleuder arbeitete nur mit der
P-Bremse.
Dank der
Hauptleitung
dieser
Bremse
konnten damit jedoch auch angehängte Wagen abgebremst werden. Gleichzeitig
war es aber auch möglich, die mechanischen Bremsen der Schleuder zu
betätigen, wenn diese am Schluss eines Zuges abgeschleppt werden musste.
So war eine sichere
Überführung
des Fahrzeuges jederzeit möglich.
Damit konnte ein Bremsverhältnis von 74% berechnet werden. Das reichte problemlos aus, um mit der Maschine die Talfahrt am Gotthard mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit in Angriff zu nehmen.
Daher konnte bei Fahrten immer mit 65 km/h gefahren werden, was
eine schnelle Verschiebung ermöglichte.
Beide pneumatischen
Bremsen
der Schneeschleuder wirkten auf zwei
Bremszylinder,
welche mit einem
Bremsgestänge
mit automatischem
Gestängesteller
auf die
Klotzbremse
von jeweils 1.5
Achsen
wirkten. Die
Laufachse
war dabei je zur Hälfte von einem Bremszylinder gebremst. Das war eine
Lösung, die man von der Baureihe Ae 6/6
her kannte und die auch eine zweckmässige Abbremsung der Schneeschleuder
erlaubte.
Wurde die Schneeschleuder abgedreht, wurde die
Hauptleitung
automatisch entleert und so die volle Bremswirkung der
automatischen Bremse
erreicht. Gleichzeitig wurden auch die Leitungen zu den
Fahrmotoren
unterbrochen. So konnte in diesem Moment mit der Schleuder nicht
losgefahren werden. Die
Bremse
verhinderte zudem, dass diese auch ungewollt losrollen konnte. Erst mit
der Verriegelung konnte wieder gefahren werden.
Die Möglichkeit, die Schneeschleuder abzudrehen, verhinderte auch,
dass eine normale und regulierbare
Handbremse
eingebaut werden konnte. Daher wurde hier eine
Feststellbremse
verwendet. Diese wirkte mit einem seitlich am Fahrgestell angebrachten
Handrad
rein mechanisch auf ein
Bremsgestänge
und somit auf die Hälfte der
Achsen.
Es war daher nicht möglich alle Achsen mit der Handbremse anzuziehen.
Daher konnte mit dieser
Feststellbremse
ein
Stillhaltebremsgewicht
von 17 Tonnen erreicht werden. Das war nicht besonders hoch und führte zu
Behinderungen beim Einsatz. Mit diesem Wert konnte die Schneeschleuder
jedoch nicht überall abgestellt werden. Besonders in den
starken Gefällen
reichte das nicht aus. Damit die Schleuder trotzdem auch dort gesichert
werden konnte, wurden auf der Maschine
Hemmschuhe
mitgeführt.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2020 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
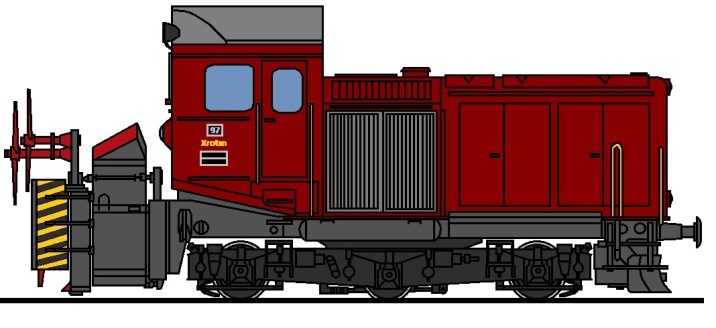 Während
der Fahrt konnte sich das
Während
der Fahrt konnte sich das
 Abgefedert
wurden sämtliche
Abgefedert
wurden sämtliche
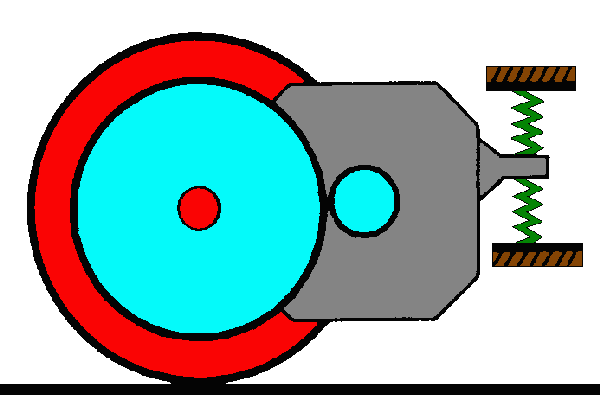 Die
verfügbare Fahrleistung von 237 PS, beziehungsweise 180 kW wurde mit einem
Die
verfügbare Fahrleistung von 237 PS, beziehungsweise 180 kW wurde mit einem  Diese
Diese
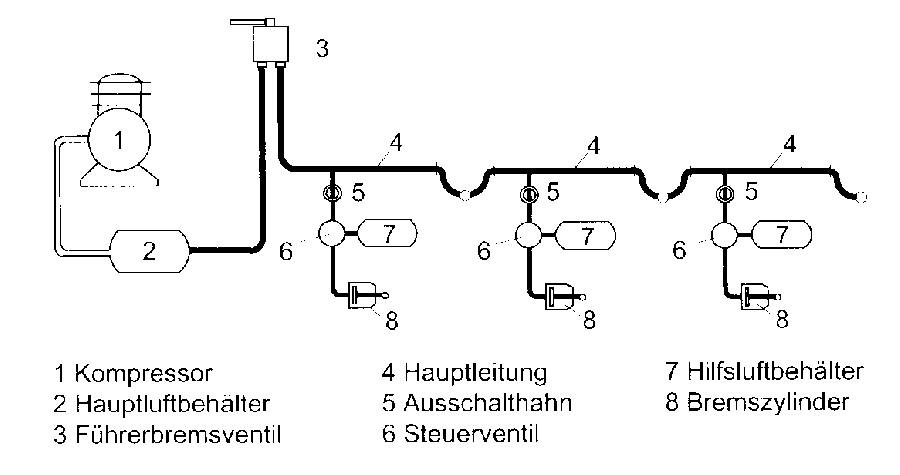 Bei
einem Gewicht des Fahrzeuges von 57 Tonnen wurde bei einem Druck von 3.9
Bei
einem Gewicht des Fahrzeuges von 57 Tonnen wurde bei einem Druck von 3.9