|
Tour 4: RBL - Buchs - RBL |
|||||
|
Es ist ein Freitag im Oktober und draussen
ist es Herbst geworden. Nachdem es in den vergangenen Wochen schön und
warm war, meldete der Wetterbericht, dass es in der kommenden Nacht zu
einem Wetterwechsel kommen soll. Es ist Regen gemeldet und im Herbst mit
dem Laub, wird es nicht einfach sein. Nasses Laub bildet einen
Schmierfilm, der die
Räder
schnell dazu bringen kann, dass sie blockieren. Heute müssen mir daher die
Wagen helfen.
Das bedeutet, dass in der Gegenrichtung ein Stau besteht und in meiner Richtung alle nachsehen müs-sen, ob sie jemanden im Stau kennen. Zudem funktionieren bei den meisten
Fahrzeugen die Blinker nicht. Das Gefährlichste bei meiner Ar-beit ist
eigentlich der Weg dorthin.
Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich nun im Rangierbahnhof Limmattal im Einsatz und dabei erinnere ich mich, wie vor einem Jahr die Strecken neu gelernt werden mussten. Viele von den damals befahrenen Linien,
habe ich seither nicht mehr gesehen. Es sind Umleitungs-strecken die sehr
selten befahren werden und daher immer ein Problem darstellen. Diese gab
es auch in Erstfeld und das Problem war identisch. Mit den Namen meiner neuen Kollegen klappt es auch etwas besser. Es ist einfacher einen, als 90 zu lernen und diese dem richtigen Gesicht zuzuordnen. Die Gespräche vor der Arbeit bilden einen
festen Bestandteil und seit einigen Tagen bin ich selber zum grossen Thema
geworden. Das nicht nur im RBL. Wer jedoch in dieser aktuellen Tageszeit
eine
Bahnlinie
blockiert, wird schnell bekannt. Dabei war es doch ein so schöner Tag. Die Fahrt im Rauch von Emmenbrücke nach
Rothenburg, die anschliessende Sperrung der Strecke und die angerückte
Feuerwehr sorgten dafür, dass darüber in der Presse berichtet wird. Die
Lokomotive
bekam später einen neuen
Ventilator
und ich eine Autofahrt nach Hause.
Nun beschäftigt der Vorfall auch noch meinen
Vorgesetzten, denn es ist rechtlich ein Unfall. Allfällige Kosten und
spätere Folgen müssen der Versicherung gemeldet werden. In den letzten Monaten kämpfte ich mit Störungen an den Lokomotiven und dabei zeigte sich die Reihe Re 620 nicht gerade von der guten Seite. Heute weiss ich, dass ich auf der ganzen Fahrt eine solche Maschine haben werde. Ich mache die Arbeit jedoch lange genug, so dass ich davon ausgehe, dass die Fahrt nach Buchs und zurück in den RBL klappen wird. Diesmal ist es mit dem Ziel jedoch etwas
komplizierter, als man allgemein meinen könnte. Das Ziel heisst Buchs,
genau genommen ist es Buchs SG, dann gibt es noch jenes im Kanton Zürich,
das sich den
Bahnhof
mit Dällikon teilt. Die dritte Gemeinde mit diesem Namen liegt im Aargau
und sie hatte früher eine
Haltestelle
auf der von den Schweizerischen Bundesbahnen SBB betriebenen Strecke von
Aarau nach Suhr. Das ist jedoch längsten vorbei, so dass es im Netz der
Staatsbahnen
diesen Namen nur noch zweimal gibt. Von der Eisenbahn hergesehen, ist Buchs SG
der grösste
Bahnhof,
bildet er doch das Tor zu Österreich und genau dorthin wollen die Wagen,
die ich mitnehmen werde. Wobei dieser
Grenzbahnhof
nicht mit jenem in Chiasso vergleichbar ist, denn er befindet sich nicht
an der Grenze zu Österreich, sondern das Nachbarland ist das Fürstentum
Liechtenstein. Ab Buchs ist dem Zug jedoch eine
Lokomotive
der ÖBB vorgespannt. Jetzt jedoch habe ich den Parkplatz
erreicht. Sowohl ich, als auch mein Auto haben die Fahrt auf dem
weltgrössten Autoscooter, der sich in der Schweiz Autobahn nennt,
überstanden. Nun geht es mit dem Rucksack aus dem Kofferraum und der Jacke
auf den kurzen Fussweg. Alleine muss ich nicht gehen, denn es fängt noch
ein weiterer Lokführer mit der Arbeit an. Das kurze Gespräch dreht sich um
die Rauchzeichen der letzten Woche.
|
|||||
| RBL
– Dietikon |
|||||
|
Wo die
Lokomotive
steht, erkenne ich am
Bildschirm.
Dort steht, dass sie sich im
Gleis 616
befindet. Vor einem Jahr hätte ich noch einen verzweifelten Blick auf den
aufgehängten
Bahnhofsplan geworfen. Mittlerweile weiss ich jedoch, dass es
sich dabei um die R-Gruppe
handelt. Schon oft bin ich hier abgefahren. Jedoch selten nur bis zum
nächsten
Bahnhof,
der erst noch mit dem
Rangierbahnhof
verbunden ist und das macht die erste Fahrt nicht so einfach. Zwischen dem RBL und Dietikon gibt es keine
Strecke. In der Folge können zwischen diesen beiden
Bahnhöfen
auch Rangierbewegungen verkehren. Damit die so verkehrenden
Lokomotiven
jedoch vom System erkannt werden, erhalten sie
Zugnummern,
die mit einem R ergänzt werden. Es verkehren jedoch auch ganz normale
Lokomotivzüge
und so muss der Lokführer sehr genau aufpassen, nach welchen Vorschriften
er zu fahren hat. In der
LEA
erkenne ich es schnell, denn meine
Zugnummer
besitzt kein R. Damit muss ich das weisse Rücklicht, das nicht mehr
obligatorisch ist, jedoch immer noch angewendet wird, durch das rote Licht
des Zugschlusses zu ersetzen. Der entsprechend markierte Schalter wird
dazu in die entsprechende Position verbracht. Doch bevor es soweit ist,
steht die Aussenkontrolle an. Viel muss nicht mehr angesehen werden. Die Nummer der Lokomotive ist auch leicht zu erkennen, seit diese mit grossen weissen Ziffern an der Front angeschrieben steht. In meinem Fall steht dort 620 049-7. Eine Re 620 auch wenn immer noch von der Re 6/6 gesprochen wird. Alte Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht aus der Welt schaffen, wie es erwartet wird. Die jungen Lokführer wenden die neuen Nummern an und diese ist wirklich sehr lange geworden. An der Seite steht dann die neue
TSI-Nummer. Ich benutze auf meiner Fahrt damit die Lokomotive 91 85
4 620 049-7 CH-SBBC. In der
Lokomotive
wird daraus jedoch schnell die Nummer 49. Auch schon ertappte ich mich,
als ich in alter Manier von der 649 gesprochen habe. Selbst in den
Lokomotivdiensten
werden nicht alle Ziffern aufgeführt, denn dort erkannte ich, dass diese
Maschine bis zum Schluss in meinen Händen verbleiben soll.
Eine solche Erfahrung, die längst zur Routine geworden ist, sind die Handlungen um die Maschine zu übernehmen und einzuschalten. In den vergangenen Jahren wurden die dazu
verfügbaren Zeiten immer mehr gekürzt. Möglich wurde dies, weil die
Aufgaben für das Personal neu verteilt wurden. Glücklich dar-über bin ich
nicht gerade. Es sind hier nicht mehr viele Kontrollen zu machen, denn neu wird nicht mehr der vor-herige Kollege kontrolliert, sondern man vertraut seiner professionellen Arbeit. Nicht immer war das von Er-folg gekrönt,
aber in diesem Fall klappt es. Gut, auch jetzt wurde einfach zur
Beruhigung meiner Nerven der Schrank mit den Speisungen geöffnet. So lange
dort keine rote Lampe leuchtet, ist die Welt in Ordnung und die Fahrt kann
beginnen. Bevor ich meine Fahrbereitschaft melde,
verlasse ich die
Lokomotive
wieder. Ich kontrollierte die
Beleuchtung,
denn eine defekte Glühbirne wird mir hier nicht angezeigt. Vorne leichten
drei weiss und hinten eine rot. Damit ist das Licht in Ordnung und der
Fahrt steht nichts mehr im Weg. Ich kann mich mit dem
Funk beim
zuständigen
Fahrdienstleiter
anmelden. Ein paar Minuten Zeit, bis zu Abfahrt bleiben jedoch noch. Pünktlich wechselt das Signal seine Farbe
und ich kann losfahren. Die
Gleisbremsen
vor meiner
Lokomotive
dürfen nur mit 15 km/h befahren werden. Wer gesehen hat, wie eine
Lokomotive die Bremsbacken verschiebt und neu ausrichtet, kann diese
Regelung verstehen. 19 Meter sind schnell durch und anschliessend kann ich
auf 40 km/h beschleunigen. Gerade in den
Rangierbahnhöfen
ist das durchaus eine übliche Geschwindigkeit für Züge.
Damit ist eine sehr gefährliche Situation
ent-standen. Gehe ich davon aus, dass es nun in
Ran-gierfahrt
weitergeht, kann ich beim Chef antraben und muss mich für einen Signalfall
rechtfertigen. Das sind die häufigsten Vorfälle mit roten Signalen. Es dauert wirklich sehr lange, bis auch das Signal auf Fahrt geht. Als Zug kann ich nun in Dietikon einfahren und so mein erstes Ziel erreichen. Die lange eingestellte Fahrstrasse kann zwei Gründe haben. Das
Gleis war
belegt und so konnte ich nicht ein-fahren ist sehr wahrscheinlich. Es kann
aber auch sein, dass der
Fahrdienstleiter
anfänglich meinte, dass ich in
Rangierfahrt
verkehre. Der Nummer ist dieser Umstand nicht anzusehen. Auf jeden Fall habe ich den Zielbahnhof
erreicht. Die
Fahrzeit
für diesen Zug betrug zwei Minuten. Davon stand ich noch eine vor dem
roten Signal. Schneller als 40 km/h verkehrte ich nicht und so ist es
eigentlich nicht verwunderlich, dass hier oft
Rangierfahrten
angeordnet werden. Nur hilfreich wäre eine klare Regel und nicht einmal so
und dann wieder so. Das kann täglich unterschiedlich sein. Doch nun muss
ich den
Führerstand
wechseln. Mit der
Lokomotive
fuhr ich schliesslich wieder fast zu meinem Ausgangspunkt zurück, denn das
Gleis
neben mir, gehört zum
Rangierbahnhof,
das mit dem Zug für mich, gehört jedoch zu Dietikon und der dort
vorhandenen Güteranlage. Diese wiederum ist unmittelbar neben dem
Rangierbahnhof. Hier eine Grenze zu ziehen ist schwer, daher auch die
Regel mit den
Rangierfahrten
zwischen den
Bahnhöfen.
Auf Seite Killwangen ist es ähnlich. Der Lokführer von Erstfeld musste bei der
periodischen Prüfung immer wieder erklären, dass eigentlich mit einem Zug
in
Rangierfahrt
von Dietikon nach Killwangen-Spreitenbach gefahren werden kann. Dabei darf
einfach nicht die Stammstrecke benutzt werden. Für den Lokführer vom RBL
sind solche
Manöver
schon fast alltäglich. Immer wieder enden Züge in Dietikon und dann geht
es als Rangierfahrt in den RBL. |
|||||
| Dietikon – Buchs |
|||||
|
Am Zug angekommen, wird meine
Lokomotive
angekuppelt. Anschliessend steht die
Bremsprobe
an. Es wird, nur eine Zusatzbremsprobe sein. Doch während ich die
Bremsen
fülle, erhalte ich die Schriften. Diese sind, weil es ein internationaler
Zug ist, natürlich vorhanden. Das wiederum war in Erstfeld eine tägliche
Routine, die hier selten ist. Auch der Zug des kombinierten Verkehres ist
eigentlich kein Problem, wenn es nicht nach Buchs ginge. Die heute befahrene Strecke ist nicht für
solche Züge ausgelegt worden. Das führt dazu, dass der Zug mit den
Tragwagen
und den darauf verladenen Aufliegern zu einer aussergewöhnlichen Sendung
wird. Das Lademass wird überschritten und in der Anordnung AS 2185-0940-17
ist genau geregelt, was wo gemacht werden darf. Daher wird diese Anordnung
separat und in Papierform abgegeben. Ich muss nun kontrollieren, ob es das
richtige Schriftstück ist. Der Titel «Nothegger Wels-Dt» stimmt und
auch meine
Zugnummer
ist aufgeführt. Es ist das richtige Stück Papier. Mittlerweile sind die
Bremsen
bereit und es kann die
Bremsprobe
durchgeführt werden. Viel Zeit steht hier nicht zur Verfügung. Daher muss
ich gleichzeitig die Einschränkungen suchen. Diese sind etwas komisch
aufgeführt, so dass die Problempunkte gesucht werden müssen und von diesen
gibt es viele. Gewisse
Geleise
sind verboten, andere dürfen nur langsam befahren werden. Das beginnt
bereits hier in Dietikon. Bei Fahrt über das Gleis 13 sind nur 20 km/h
zugelassen. Ein Signalkorb kommt sonst dem Zug gefährlich nahe. Nur, wo
ist dieses Gleis denn genau? Die Geleise, die ich nicht befahren darf,
kann ich von meinem Standort gar nicht erreichen. Einfach gesagt, ich
sollte hier die Perrondächer meiden. Ich kann nach dem erfolgreichen Abschluss der Zugvorbereitung zum Ausfahrsignal vorziehen. Von hier ist dieses schlicht nicht zu erkennen. Daher der Weg in das Gleis 2. Problem eins ist gelöst, denn hier gibt es kein Perrondach, das gefährlich werden könnte. Wobei die beiden benachbarten Geleise auch befahren werden dürften. Andere kann ich gar nicht erreichen. Jedoch kann von hier das besagte Gleis 13 erreicht werden. Im
Fahrplan
erkenne ich, dass ich unmittelbar vor der S12 losfahren sollte. Mit 20
km/h glaube ich nicht so richtig daran. So bin ich nicht überrascht, als
es nicht nach Fahrplan losgeht. Nun aber ist das Signal für die S12 aus
dem vierten
Gleis und
jenes für mich aus dem Gleis 2 auf Fahrt. Das kann eigentlich nur
bedeuten, dass es über das Gleis 13 gehen wird. Nur, wo dieses genau ist,
kann ich nicht in jedem
Bahnhof
genau kennen. Der
Fahrdienstleiter
meldet sich am
Funk. Er
informiert mich, dass ich über
Gleis 13
fahre und daher nur 20 km/h zugelassen sind. Anschliessend würde dann der
Weg ohne Einschränkungen bis in den
Vorbahnhof
erfolgen. Schön, dass ich informiert wurde, denn das ist auch nicht immer
der Fall und dann gilt die Sicherheit. Die S12 kann dann in vielen Fällen
nicht pünktlich fahren, daher werden wir sehr oft über den Fahrweg
informiert. Als ich Zürich
Vorbahnhof
erreiche, komme ich letztlich vor dem roten Signal zum Stehen. Ein paar
Minuten muss ich warten, bis es weitergeht. Die Haltebremsung war
erfolgreich und auch mit der ersten
Bremsstufe
verzögerte der 500 Meter lange Zug sehr gut. Ich löse die
Bremsen
in der
Fahrstellung.
Eigentlich dürfte ich einen Füllstoss geben, aber der alte Lokführer vom
Gotthard hat da so seine Macken, die er nicht so leicht loswird. Am Manometer vor mir stelle ich fest, dass
die
Hauptleitung
nicht mehr bis zum ursprünglichen Druck ansteigt. Auch der
Kompressor
schein häufiger als üblich zu laufen. Schnell stelle ich fest, dass auf
der Hauptleitung ein Luftverlust besteht. Dieser ist jedoch nicht so
stark, dass es eine
Zugstrennung
sein kann. In Dietikon stellte ich kein solches Verhalten fest. Daher
führe ich eine Bremsung aus und nun kommt der Füllstoss. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass
der Druck bei der Bremsung mit einem Auslass von lediglich 0.4
bar
dazu führte, dass ein
Ventil
im Zug verwirrt war. Es blieb daher in einer Zwischenstellung und führte
so zum Luftverlust. Da jetzt eine deutlich höhere Druckdifferenz besteht,
erfolgt die Umstellung wieder korrekt. In Zukunft muss die Bremsung mit
einem etwas grösseren Auslass ausgeführt werden, denn sonst erwartet mich
eine Bremsstörung.
Beschränkungen in Wiedikon und Enge,
zwingen den Zug zu einer Slalomfahrt. Daher durch den
Tunnel,
dann geht es mit 105 km/h recht flott über die Bühne und ich muss erst den
Bahnhof
Horgen beachten. Es ist so, es geht durch den Zimmerbergtunnel. Dieser ist leicht zu befahren und kurz vor Thalwil benutze ich die Abzweigung. Die geplante Verlängerung bis in den Raum Litti wurde noch nicht gebaut, so steht nur dieser Weg zur Verfügung. Die Steigung hilft mir, den Zug auf die
zugelassene Ge-schwindigkeit zu verzögern. Der Fahrt bis nach Horgen steht
nichts mehr im Weg, denn die Signale sind grün und so komme ich gut
vorwärts. In Horgen kommt es zum Halt vor dem
Einfahrsignal.
Durch den
Bahnhof
darf ich auf allen
Geleisen.
Nur nicht durch jenes, dass ich in der Regel benutzen würde. Daher erfolgt
eine Fahrt über das Gleis der Gegenrichtung und dort verkehren bekanntlich
auch Züge. Ich blicke zur Seite und frage mich, ob sich die Leute bewusst
sind, dass ich in ihr Wohnzimmer blicken kann? Im Fernsehen läuft gerade
eine Sendung über Tiere. Mit 60 rein und wieder raus, dann konnte
ich die Fahrt bis Wädenswil normal fortsetzen. Dort ist es eigentlich
klar, Es ist wie in Horgen, überall nur nicht dort, wo ich in der Regel
durchfahren würde. Die
Einfahrt
kündigt mir Fahrt mit 60 km/h an. Im Bereich der
Bahnsteige
muss ich zudem auf 40 km/h reduzieren. Da es nun jedoch über das
Gleis
geht, das kein
Perron
hat, muss ich nicht weiter verzögern und Wädenswil ist auch kein Problem. Nun kann ich die Fahrt geniessen, denn bis
kurz vor Walenstadt habe ich keine Beschränkungen zu beachten. Die Fahrt
führt zügig über Pfäffikon nach Ziegelbrücke. Nur ADL drosselt mich etwas,
denn ich soll es bis Mühlehorn gemütlich nehmen. Da es nun leicht regnet,
sind die
Geleise
wie Schmierseife, da kommt mir die Reduktion gelegen, denn bei einem roten
Signal muss ich nicht so stark bremsen, dass die
Räder
blockieren könnten. Nach Mühlehorn kommt der erste einspurige
Abschnitt der heutigen Fahrt. Dieser ist knapp einen Kilometer lang und
danach wird es für mich spannend, denn ich nähere mich langsam den
nächsten Bereichen mit den Einschränkungen. So darf ich nur auf dem 200er
Gleis
verkehren. Das ist das auf der anderen Seite und bei einem Streckentrenner
sind sogar nur 40 km/h zugelassen. Anhand der
Schutzstrecke
weiss ich wo das ungefähr ist und ich denke es geht dabei um die Signale
dazu. Bei der letzten Möglichkeit ging es auf das
rechte
Gleis und
bei der ersten in Walenstadt wieder zurück. Nun kann ich wieder
beschleunigen. Ab hier wären bis zu 115 km/h zugelassen. Wegen den
Stationsgeschwindigkeiten beschränke ich mich auf 110 km/h. Jedoch wird es
wegen der Steigung ein Kampf mit der
Adhäsion
werden, denn bei 2000
Ampère
spricht der
Schleuderschutz
bereits an. Das ist wirklich nicht sehr gut. Meine Vorstellung wird auch gleich
vernichtet, denn ADL meldet sich wieder, mit 70 km/h bis nach Sevelen.
Aktuell habe ich es gerade auf 65 km/h geschafft und der weitere Anstieg
mit Sand und Schleuderbremse kommt langsam. Die fast 1000 Tonnen am Haken
machen sich jetzt bemerkbar. Der feine Nieselregen hat sich hier
eingelassen und dieser macht aus der Eisenbahn eine Rutschbahn
sondergleichen. Mit Laub vermischt, wird es zur Rutschpartie. Bei der Durchfahrt durch den
Bahnhof
Flums erkenne ich auf der rechten Seite das Werk einer Firma, die den
nahezu gleichen Namen hat und die sich auf die Herstellung von Isolations-
und Dämmstoffen spezialisiert hat. Für mich ist das Werk heute nur eine
Ablenkung
am Fahrweg und langsam muss ich mich auf den Bahnhof Sargans vorbereiten.
Dieser kommt nach jenem von Mels und es gibt erneut Beschränkungen.
Ich erkenne erst, wo ich durchfahre, wenn
es zu spät ist. Auch wenn ich dank ADL langsam komme, bei diesem Wetter
ist es kaum möglich rechtzeitig anzuhalten. Es stimmte mit dem befahrenen Gleis und ich strebe mit dem Zug am Haken in Richtung Schleife aus dem Bahnhof. Sargans ist ein Keilbahnhof, wie es sie auch in Zug und Arth-Goldau gibt. Jedoch musste hier, um mit dem Zug nach
Buchs SG zu fahren, eine Schleife gebaut werden. Diese nutze ich nun und
so fahre ich entlang der Autobahn in Richtung Trübbach. ADL drosselte mich
noch mehr und so schleiche ich mit 40 km/h durch die Dunkelheit. Hier steht vermutlich eine Kreuzung an,
denn die Strecke bis nach meinem Ziel ist nur noch mit einem
Gleis
versehen. Der
Bahnhof
von Sevelen erlaubt Kreuzungen und so halte ich mich an ADL und bei der
Beschleunigung geht es auch mit Sand gemütlicher ans Werk. Ich kann nicht
mehr, bei etwa 2200
Ampère
rutschen die
Räder
aus. So muss in Sevelen der Gegenzug warten. Die Fahrt dauert nicht mehr
lange und ich bin fast am Ziel. Auf der rechten Seite erkenne ich die
Lichter am Hang. Diese befinden sich bereits im Ausland. Das ist so, auch
wenn das Fürstentum Lichtenstein zur Schweiz keine Grenze unterhält und
dort mit unserer Währung bezahlt wird. Es ist ein eigener Staat, der sich
immer noch einen Regenten in der Form eines Fürsten gönnt und daher keine
vollständig frei gewählte Regierung, wie sie die Schweiz besitzt. Jedoch
gelten auch dort demokratische Grundsätze. Kurz vor Buchs meldet sich der dortige
Fahrdienstleiter.
Er informiert mich, dass ich bei der
Einfahrt
langsam machen soll. Dort warte der
Rangierarbeiter
und nehme die Papiere in Empfang. Der Zug macht hier eine Spitzkehre und
so befinden sich die Papiere an der richtigen Stelle. Dank der kräftigen
Ledermappe, kann ich diesem Wunsch nachkommen. Aus Erfahrung weiss ich,
dass jeder Zug eine andere Bündelung kennt. Nachdem auch die letzten Meter noch
geschafft sind, ist das Ziel erreicht. Hier muss, wie in vielen
Rangierbahnhöfen,
die
Lokomotive
vom Lokführer abgehängt werden. Die dazu notwendigen Handlungen sind
längst zur Routine geworden. Doch diesmal ist es nicht so einfach, denn
der Zug verlässt den
Bahnhof
in die andere Richtung. Wie jedoch der Zugschluss bei einem
Güterzug
in Österreich auszusehen hat, weiss ich schlicht nicht. Auch die sonst übliche Meldung beim
Fahrdienstleiter
kann entfallen. Das Zwergsignal vor der
Lokomotive
zeigt bereits freie Fahrt. Damit habe ich die erforderliche Zustimmung und
ich kann mit der Maschine auf die andere Seite des
Bahnhofes
wechseln. Anhand der
Lokomotivdienste
weiss ich, dass ich mit der Lokomotive auch gleich meine Rückleistung
fahren werde. Aus Erfahrung weiss ich jedoch, dass es durchaus zu einer
Änderung gekommen sein könnte. Der
Fahrdienstleiter
meldet sich am
Funk. Jetzt
weiss ich es definitiv, denn ich habe die Information, dass die
Lokomotive
vor die Rückleistung gespannt wird. Der Zug sei in den nächsten Minuten
bereit. Das klingt schön, auch wenn ich noch eine Pause machen muss. Ob
diese nun einige Minuten später beginnt ist mir nicht so wichtig. Ich
nutze einfach die vorgesehene Zeit. Wer später in die Pause kommt, ist
später zurück. |
|||||
| Buchs SG |
|||||
|
Ich finde es eine gelungene Abwechslung, wenn neben
meiner
Lokomotive
eine Maschine der Österreichischen Bundesbahnen steht.
Die nennen eine
Doppeltraktion anders und das
Tandem besteht aus zwei
unterschiedlichen Lokomotiven. Am Zug steht eine moderne Maschine der
Baureihe Taurus und davor ist eine Lokomotive der Reihe 1144. Ob das mit
der Baureihe stimmt weiss ich nicht, denn noch habe ich mit den
Bezeichnungen der ÖBB nicht befasst.
Da die Leitung leer war, dauert das ein paar
Minuten. In der Zeit spreche ich mit dem Arbeiter im
Gleis. Er erkennt,
dass ich noch nicht so oft in diesem
Bahnhof
war und erkundigt sich, warum
dies denn so sei. Nach 25 Jahren am Gotthard und der Stationierung im Depot Erstfeld, wurde mit der NEAT mein Depot geschlossen. Ich muss-te mich neu orientieren und deshalb wählte ich den Wechsel in den Rangierbahnhof Limmattal. Seit einem Jahr fahre daher die neuen Strecken. Ein Wechsel,
der nicht leicht war, den ich jedoch bis zum heutigen Datum nicht bedaure.
Die Arbeit macht wieder Spass und dank den besser passenden Schichten geht
es mir besser. Das Gespräch überbrückte die Zeit. So konnten die Bremseinrichtungen gefüllt werden. Bei der Kontrolle der Dichtigkeit, stelle ich zudem keinen Luftverlust fest. Der Bremsung steht daher nichts mehr im Weg und ich informiere den Visiteur, dass ich diese eingeleitet habe. Damit ist das Gespräch beendet und er macht sich an seine Arbeit. Das wird dauern, weil am Zug eine Hauptbremsprobe durchgeführt werden muss. Bevor der
Visiteur losgeht, informiert er mich, dass
ich jetzt in die Pause gehen könne. Um den Zug zu lösen, habe er eine
Lösung, die mich nicht benötigt. Beim
Rangierpersonal gibt es einige
Leute, die durchaus das
Bremsventil bedienen dürfen. Scheinbar ist so eine
Person vorhanden. Ich muss nur noch die
Handbremse der
Lokomotive
anziehen. Zusammen mit der
Rangierbremse bewegt sich der Zug somit nicht
mehr ungewollt. Ich verlasse die
Lokomotive
und geht in die Pause.
Ein Kaffee muss reichen. Auch hier in Buchs steht zur Verpflegung des
Personals nur ein Automat zur Verfügung. Zudem sass ich einige Stunden auf
der Lokomotive. Jetzt geniesse ich es, dass ich ein paar Meter gehen kann.
Die Beine vertreten ist auch keine schlechte Idee. Die Pause muss so
eingerichtet werden, dass ich für die Heimfahrt fit bin. Jeder Lokführer
hat hier eine andere Lösung. Da der Regen aufgehört hat, kann ich einen kurzen
Spaziergang durch die an den
Bahnhof
angrenzenden Quartiere machen. Hier
kenne ich mich jedoch noch nicht aus, denn bei der
Streckenkunde standen
andere Bereiche im Vordergrund. Auch die Pausenlokale muss ich immer
wieder suchen. Ein Problem, das sich in den nächsten Jahren sicherlich
bessern wird. Zudem waren die Pausen hier bisher auch von anderen Punkten
beeinflusst. Ich habe in dieser Region Freunde, die ich schon vor
dem Wechsel des
Depots hatte. Oft traf ich diese am
Bahnhof
und dann
leiteten diese mich durch die Pause. Bei der Suche nach den Lokalen ist
das natürlich nicht hilfreich, aber deswegen lasse ich die Freunde nicht
stehen und ein gutes Gespräch ist auch eine Lösung um mich auf die Fahrt
nach Hause vorzubereiten. Diese könnte heute schwer werden, denn es gab
eine Änderung. In der Regel ist dieser Zug mit einer
Re 10 bespannt.
Die Re 620 kommt von dem von mir geführten Zug und die
Re 420 aus
Heerbrugg. Diese kam heute jedoch wegen Bauarbeiten gar nicht. So ist der
Zug nur mit einer
Lokomotive
bespannt. Ein Umstand, der durchaus für
Probleme sorgen kann, denn diese Züge zwischen den
Rangierbahnhöfen sind
oft sehr schwer. Hier fuhr ich schon mit über 2000 am Haken los.
Wegen der
Re 620 und der fehlenden zusätzlichen
Re 420 wurde das Gewicht auf 1620 Tonnen beschränkt. Das ist die
Normallast
und auf einigen kurzen Abschnitten kann es zu grösseren Problemen kommen.
Besonders kritisch ist die
Ausfahrt aus dem Zimmerbergtunnel, denn die ist
auf einem Abschnitt sehr steil. Wenn ich dort anhalten muss, kann ich
nicht mehr losfahren und es wird eine weitere
Lokomotive
benötigt. |
|||||
| Buchs – RBL |
|||||
|
Als ich von der Pause zurückkomme, stelle ich auf der
Lokomotive
fest, dass die
automatische Bremse gelöst worden war. Zudem ist
der
Visiteur gleich wieder bei der Maschine, so dass ich vermute, dass die
Bremsprobe abgeschlossen ist. So erfolgt auch gleich die Meldung über den
Abschluss der Zugvorbereitung. Diese muss seit einem Jahren auch gemeldet
werden. Oft muss jedoch noch nachgefragt werden, denn die neue Regel hat
sich noch nicht eingelebt.
Bei einem Gewicht von 804 Tonnen sind
nur knapp 300 Meter
Güterwagen angehängt worden. Der Hinweis, dass
Gefahrgut vorhanden ist, wurde gelb markiert, was ja bedeutet. Die Meldung an den Fahrdienstleiter übernehme ich selber. Da es noch gut 30 Minuten dauert, bis der Zug fahrplanmässig losfährt, erhoffe ich mir so zusätzliche Hinweise. Jedoch schwindet meine
Hoffnung, als ich am
Funk erfahre, dass noch keine Prognose erstellt
werden könne. Im schlimmsten Fall bedeutet das, dass ich 30 Minuten auf
ein rotes Licht starre und hoffe, dass sich die Farbe ändert. Es kann aber
auch länger dauern. Es waren letztlich nur 20 Minuten und immer auf das Signal gestarrt habe ich auch nicht. Scheinbar scheint es bei meinem Kontrollblick noch nicht lange auf Fahrt gestanden sein, denn vom Fahrdienstleiter kam keine Anfrage. Soll ich mal testen, wie lange er auf seinem Bildschirm auf eine Zugnummer starrt und hofft, dass sich diese bewegt? Auf die Frage, wann ich fahre, könnte ich ja auch mit «Ich habe noch keine Prognose» antworten. Natürlich mache ich das nicht, denn ich müsste wieder
bei meinem Chef antanzen und mich rechtfertigen. Daher beginne ich mit der
Beschleunigung des Zuges, der mit einem Gewicht von etwas mehr als 800
Tonnen für die Re 620 keine grosse Herausforderung darstellt. Vor Jahren
fuhren wir mit solchen Lasten den Gotthard hoch und machten uns keine
Sorgen, ob wir Göschenen erreichen, denn wir wussten, was zu tun ist. In Buchs fahren die
Güterzüge in der Richtung Sargans
mit Hilfe der Minisignale los. Diese sind in Güteranlagen zugelassen und
können nur Rot oder Orange zeigen. Das Signal mit der Geschwindigkeit,
also das
Ausfahrsignal kann damit immer noch rot sein. Es pressiert daher
mit der Beschleunigung nicht so sehr, denn ein anderer Zug verhindert die
Sicht auf das
Hauptsignal. Dieses ist auch nach dem letzten Wagen zwischen
den Masten kaum zu erkennen. Eine grüne Lampe mit der Ziffer vier, ist das Signal,
das für mich gelten muss. Daher kann ich nun auf die angezeigte
Geschwindigkeit beschleunigen. Dank den nun wieder trockenen
Schienen, ist
die
Adhäsion auch kein Problem mehr. Wegen der
Zugreihe D sind jedoch
maximal nur 80 km/h zugelassen. Jedoch muss ich noch warten, denn der Zug
hat die letzte ablenkende
Weiche noch nicht vollständig befahren. Als die Bedingungen erfüllt waren, konnte ich auf 80
km/h beschleunigen. Die
Bremsprobe auf Wirkung steht nun an und daher
bremse ich den Zug ohne die
Lokomotive
und erwarte eine bestimmte
Bremswirkung. Diese setzte ein und der Zug verzögert auf 60 km/h. Ich kann
wieder beschleunigen, der Fahrt mit diesem Zug steht somit von meiner
Seite nichts mehr im Weg. In der Ferne sehe ich zudem den
Bahnhof
Sevelen. Würde ich mich gerne Ärgern, dann müsste ich jetzt
die Wände hochgehen. Gerade in dem Moment, als ich die Geschwindigkeit
wieder auf 80 km/h erhöht hatte, kam die Meldung an
ADL. Dort stand dann,
mit 60 km/h bis nach Mühlehorn. Das wird wohl eine gemütliche Fahrt
werden, denn der
Bahnhof
ist noch sehr weit weg. Schliesslich passierte
ich soeben das
Einfahrsignal von Sevelen. Bis Mühlehorn dauert es noch gut
40 Minuten. Eigentlich ist es überraschend, dass der
Fahrdienstleiter
schon jetzt weiss, dass ich in Mühlehorn einem Zug
auflaufen werde, denn die Meldung ist Distanz. Zwar kenne ich den
Fahrplan
noch nicht, aber um Mitternacht ist nicht mehr so viel unterwegs und die
S-Bahn fuhr auch nicht unmittelbar vor mir. Egal ich halte mich an die
Vorgaben, auch wenn ich diese nicht immer verstehen kann. Ich hatte damit
auch schon meinen Spass. So bekam ich vor etwa einem Monat Langsamfahrt mit 40
km/h. Der Zielbahnhof war gut 45 Minuten entfernt. So fuhr ich mit der
Lokomotive
mit 40 km/h durch den einspurigen Abschnitt. Zu meiner Freude
schüttelte der Kollege vom
Intercity nur seinen Kopf, als ich in den
Bahnhof
schlich. Wenig später stand dann noch eine
S-Bahn und wartete auf
die gemütliche Lokomotive. Da hatte sich wohl jemand kräftig vertan. Bei der
Einfahrt über die Schlaufe von Sargans,
meldet sich die
Betriebsleitzentrale am
Funk. Von dort werden wir selten
Informiert und in den meisten Fällen auch nur, wenn es ernsthafte Probleme
gibt. Mal sehen, was ich verbrochen habe. Daher gebe ich Antwort. Was dann
jedoch kommt, ist überraschend. Ich werde am Funk darüber informiert, dass
ich um 00:05 in Mühlehorn sein müsse und frei fahren könne, die Meldung
von
ADL werde gelöscht. Durch die Beschleunigung erreichte ich im
Bahnhof
von
Mels eine Geschwindigkeit von 85 km/h. Danach schaltete ich die
Zugkraft
ab. Seither rollt der Zug allein durch die Schwerkraft dem Walensee
entgegen. Kurzzeitig erreichte ich so dank dem Gefälle vor Flums nahezu
100 km/h. Das war jedoch kein Problem, denn nun war dieser Wert für die
Zugreihe D zugelassen. Zur Sicherheit, bereitete ich mich auf eine
elektrische Bremsung vor. Walenstadt war auch kein Problem, denn der Zug
verzögerte wieder und so konnte ich schön gemütlich weiterfahren.
Zugkraft
benötigte ich bis jetzt nicht mehr und auch der Blick auf die Uhr liess
mich erkennen, dass ich den Zeitpunkt einhalten könnte. Das war bisher auf
jeden Fall eine wirtschaftliche Fahrt, die dank guten Informationen
ermöglicht wurde. Mit
ADL wäre das nicht möglich gewesen, da ich dort mit
Zugkraft versucht hätte, die Geschwindigkeit zu halten.
Es geht nicht immer gut, aber letztlich kam das Ein-fahrsignal von Mühlehorn und damit die geschlos-sene Ausfahrt. Das hatte ich erwartet, denn ich wurde am
Funk auch über die
anschliessende Baustelle informiert. Mühlehorn 00:05 Uhr Kreuzung mit dem
IR. Die pneumatischen Bremsen des Zuges benötigte ich effektiv nur um mit diesem anzuhalten. Ein Blick auf die Uhr der LEA lässt mich erkennen, dass mit 00:02 Uhr ganz genau meine Zeit erreicht hatte. Ausser einem bisschen
Zugkraft benötigte ich für die Fahrt von Mels
hierher kaum Energie. Einzige jene für die
Hilfsbetriebe konnte ich nicht
elimi-nieren. Doch auch dort war nur eine reduzierte
Leistung erforderlich. Die Prognose ging auf und nachdem der
Interregio nach
Chur vorbei war, konnte ich meine Fahrt wieder fortsetzen. Im langen
Einspurabschnitt beschleunigte ich den Zug wieder auf die maximal erlaubte
Geschwindigkeit. Diese musste ich in Weesen wieder reduzieren, da ich dort
den
Bahnhof
über die ablenkenden
Weichen befahren musste. Dank dem nicht
so schweren Zug und der frühzeitigen Bremsung, konnte ich mit der
elektrischen
Bremse arbeiten. Bei der Durchfahrt in Ziegelbrücke befand ich mich
knapp drei Minuten vor dem
Fahrplan. Auch jetzt war es eine einfache
Fahrt, die an den Lokführer und die
Lokomotive
keine grossen
Herausforderungen stellte. Das Wetter spielt auch wieder mit, denn es ist
trocken und in den Wolken können erste grössere Lücken erkannt werden.
Möglich war das, weil es in der Linthebene nicht viele Lichtquellen hatte
und so viel in der Dunkelheit erkannt werden konnte. Im
Bahnhof
von Lachen musste ich die Geschwindigkeit
wieder etwas reduzieren, aber auch das ging problemlos mit der
elektrischen
Bremse. Nun sollte ich eigentlich zufahren können, denn die
letzten
S-Bahnen verkehren um diese Zeit in der Gegenrichtung. Für die
anschliessend verkehrenden S-Bahnen in der Nacht, ist es noch etwas zu
früh. Daher erwarte ich eine flüssige Weiterfahrt in Richtung Thalwil und
Zürich.
Der Fahrplan lässt das zu, denn ich bin knapp fünf Minuten vor dem Plan. So richtig entspannt ist diese Fahrordnung nicht, denn ich muss doch zügig fahren und kann nicht trödeln. Aber wirklich immer ans Limit muss ich auch nicht, denn es gibt sicherlich
noch Probleme. In Horgen kann ich nun ungehindert durch den Bahnhof fahren. Die Fähren über den Zürichsee haben ihren Betrieb eingestellt und auch sonst ist auf der Strecke nicht sehr viel Verkehr. Einige Autofahrer
sind unterwegs und die bringen es immer wieder fertig, dass ich geblendet
wurde. Am Himmel war jetzt kaum mehr eine Veränderung zu erkennen. An den
Signalen änderte sich jedoch nichts und so folge ich den grünen Lichtern. Bei der Ausfahrt aus Thalwil führte mein Weg wieder in den Tunnel. Auf dem jetzt befahrenen Gleis, gilt es die Neigungen optimal auszunutzen. Zuerst fällt die Strecke ab, dann steigt sie kurz um
anschliessend mit 21‰ gegen das Niveau des Tunnels zu fallen. Diese
Führung war wegen der zukünftigen Röhre erforderlich. Ob ich deren Bau
noch als Lokführer erleben werde, ist mehr als fraglich, denn vor 2035
soll diese nicht fertig sein. Meine Taktik ging auf, denn die Röhre, wo es wieder
flacher wurde, erreiche ich mit der erlaubten Geschwindigkeit. Die Fahrt
ist jetzt einfach, denn der Zug drückt leicht, so dass etwas
elektrische
Bremse benötigt wurde. Ich kann mich so auf die
Ausfahrt aus dem
Tunnel
vorbereiten, denn diese ist etwas speziell und stellt für den Lokführer
auch eine Mutprobe dar. Wer die Neigung kennt, kann elegante Fahrten
hinlegen. Bei der
Einfahrt in den
Bahnhof
Kollerwiese ist es
noch flach, da verzögert der Zug nur wenig, eine Reduktion ist auch nicht
erforderlich. Die anschliessende Steigung hilft jedoch bei der Reduktion
der Geschwindigkeit. Diese wird letztlich bei 60 km/h liegen. Zumindest
dann, wenn die Signale mitspielen, denn aktuell zeigen sie nicht die
normalen Begriffe. Jedoch ist die signalisierte Geschwindigkeit immer noch
über dem bei meinem Zug erlaubten Limit. Bei der
Weiche weiss ich dann, warum es so war, denn
diese passierte ich auf der
Einfahrseite in
Ablenkung. Ich verlasse den
Tunnel auf dem rechten
Gleis. Scheinbar sind Bauarbeiten im Gang, es
könnte aber auch ein Zug stecken geblieben sein, denn hier wird es
wirklich sehr steil. Für mich jedoch kein Problem, denn ich kann zufahren
und so steil, wie am Gotthard ist es auch wieder nicht. Daher passte es
mit der Geschwindigkeit. Nach Kollerwiese zweigt mein Fahrweg nach links ab.
Die
Geleise geradeaus führen in Richtung
Hauptbahnhof. Diesen lasse ich
mit dem
Güterzug rechts liegen und strebe der
Verbindungslinie in den
Vorbahnhof zu, wo die Signale eine Reduktion auf 40 km/h ankündigen.
Scheinbar wechsele ich bei der langsamsten Stelle wieder auf den üblichen
Fahrweg. Da hier jedoch zeitliche Reserven vorhanden sind, wirkt sich das
nicht negativ auf den
Fahrplan aus. In Zürich Altstetten musste ich wegen der Kreuzung
einer
S-Bahn etwas verzögern, aber danach konnte ich die Fahrt ungehindert
fortsetzen. In Schlieren blicke ich daher auf die Uhr und erkenne, dass
ich knapp zehn Minuten vor dem
Fahrplan unterwegs bin. Auch wenn der
nächste
Bahnhof
Dietikon ist, der Weg bis zum Ziel ist noch lange, denn
ich muss auf die andere Seite des
Rangierbahnhofes denn dort befindet
sich die Einfahrgruppe. Da ich gerade nicht der vor mir verkehrenden
S-Bahn
auffuhr, muss ich den
Bahnhof
von Dietikon mit 40 km/h verlassen. Kein
grosser Verlust, auch wenn auf dem von mir benutzten
Gleis auch Fahrten
mit 60 km/h zugelassen wären. Das ist so, weil ich nun auf die Zufahrt zur
Einfahrgruppe einschwenken werde. Das ist so geplant und eigentlich
erwarte ich keine Abweichungen.
Reisezüge sind nun auch nicht mehr im Weg. Auch wenn die
Haltestellen «RBL Ost», «RBL West» und
«RBL Tivoli» noch an jene Tage erinnern, als hier die Personaltransporte
mit einem alten
Triebwagen erfolgten. Dieser Transport wurde vor Jahren
eingestellt und mittlerweile steht dafür ein Kleinbus zur Verfügung.
Dieser bringt das Personal von Dietikon zum
Rangierbahnhof und wieder
zurück. Das funktioniert auch, und ist immer noch besser, als ein langer
Fussweg. Bei der Vorbeifahrt in der ehemaligen
Haltestelle
«RBL Ost» meldet sich der
Fahrdienstleiter am
Funk. Es ist jener vom
westlichen
Stellwerk. Er informiert mich, dass ich nach etwa der halben
Gleislänge anhalten soll, der
Rangierarbeiter warte dort bereits auf mich.
Eine hier noch recht oft vorkommende Information, die den Betrieb
vereinfacht, denn kurze Züge müssen wirklich nicht bis zum Ende der
Gruppe
fahren. Die letzten Meter sind geschafft, ich habe mit dem
Zug mein Ziel erreicht und der
Rangierarbeiter macht sich daran die
Lokomotive
abzuhängen. Noch wird das hier vom Bodenpersonal gemacht, aber
immer mehr zeichnet sich ab, dass auch hier der Lokführer selber abhängen
muss. Das Problem stellen dabei nur die Wagen dar, die nicht über den
Ablaufberg verkehren können. Wenn dieses Problem jedoch gelöst wird,
streicht man diesen Rangierarbeiter. |
|||||
|
Lok wegstellen |
|||||
|
Als ich die Meldung habe, dass abgehängt wurde, kann
ich ein paar Meter vorziehen. Mehr ist ohne ausdrücklichen Befehl nicht
erlaubt. Diese Erlaubnis kann nur durch ein Rangiersignal erfolgen und
dieses ist sehr weit entfernt. So wie ich es erkennen kann, zeigt das
Signal freie Fahrt. Daher kann ich mit der leeren
Lokomotive
vorziehen.
Notfalls kann ich jedoch davor noch anhalten, denn wirklich sicher bin ich
mir nicht.
Ich stoppe jedoch zwischen dem
Einfahrsignal und dem Zwerg, der in der Gegenrichtung aufgestellt wurde.
Weiter in Richtung Westen wird es nicht mehr gehen, denn die
Lokomotive
muss schliesslich in den Osten. Hier ist es eigentlich nur mühsam, wenn mit zwei Lokomotiven ausgewechselt werden muss. Neben dem Gleis gibt es keine Gehwege, damit wird sowohl der Abstieg, als auch der Einstieg zu einer richtigen Kletterpartie. Es ist für mich schon mühsam, ich will nicht
wis-sen, was meine kleineren Kollegen machen. Eine Kletterpartie, die mit
ein bisschen gutem Willen ver-hindert werden könnte. Bei einer Maschine
gibt es zum Glück den
Maschinenraum. Es ist schon so, das Unternehmen versucht Verbes-serungen. So wurden sichere Gehwege definiert und beschildert. Bei
Umbauten nutzt diese der Bahndienst um
Schienen und Masten abzulegen.
Kommt ein Sparfuchs auf die Idee, dass Energie gespart werden muss,
stolpert der Lokführer in komplett dunkeln
Bahnhöfen über die Masten und
Schienen. Mit Glück schürft er das Schienbein etwas auf. Mit mehr Pech
bricht er sich das Bein und landet in der Baugrube. Die
Lokomotive ist bereit und die Zwergsignale geben
die Zustimmung. Ich kann daher die Fahrt beginnen. Es wird die südliche
Zirkulation genutzt. Damit passiere ich die
Haltestelle «RBL Tivoli» und
zweige danach nach recht ab. Das
Gleis senkt sich und führt letztlich in
eine
Unterführung, die sich unmittelbar unter dem
Ablaufberg befinden.
Eine gute Möglichkeit um die zirkulierenden Lokomotiven am Berg vorbei zu
lotsen. Ich folge nun der Strasse, die die Zufahrt zur
E-Gruppe von der Richtungsgruppe trennt. Eine gerade Strecke, die kaum
Verkehr hat. Wenn es keine Buckelpiste wäre, könnten die Machos mit ihren
geleasten Boliden noch auf dumme Ideen kommen. Als Strafe könnte man sie
schnappen und rekrutieren. Das Problem mit dem Personal würde sich so
jedoch nicht lösen, aber es wäre eine Strafe, die auf diese faulen
Menschen abschreckend wirken würde. Mit der rangierenden
Lokomotive befinde ich mich nun
in einer Situation, bei der ich theoretisch mit 40 km/h rangieren könnte.
Links und rechts sind die
Geleise frei und es gibt keine
Weichen. Nur aus
der Theorie wird oft nichts, weil die Zwergsignale zu langsam nachschalten
und ich vor dem
Gleis an einem schrägen Zwerg vorbeifahre. Diesmal hätten
sogar auch die gepasst. Scheinbar pressiert es mit meiner Maschine heute
extrem. Am Ende des
Geleises gibt es zwei Möglichkeiten. Die
Lokomotive wird dem
Depot zugeführt und dort abgestellt. Jedoch kann es
auch an diesem vor-beiführen. Dann kann vieles passieren. Die Maschine geht
an einen Zug in der
Ausfahrgruppe, wird in die Richtungsgruppe geleitet,
oder was ich auch schon erlebte, es wird kontrolliert, ob der Lokführer
wirklich weiss, dass er bis Dietikon rangieren darf. Heute scheint dieser
Fall jedoch nicht einzutreten. Vor dem geschlossenen Zwerg halte ich an und wechsle
den
Führerstand. Danach fuhr ich mit der
Lokomotive noch in die
Richtungsgruppe und konnte sie dort abstellen. Das Problem dabei war nur,
dass ich mich verschätzte und die hintere Türe genau dort zum Stehen kam,
wo der Ausstieg durch eine Kabine für das
Rangierpersonal behindert wird.
Eine Meisterleistung war das nicht und vom Kollegen, der die Lokomotive
nimmt, ist nicht viel Lob zu bekommen. Mit den abschliessenden Arbeiten an der
Lokomotive
komme ich langsam zum Ende meiner Arbeitsschicht. Ein Blick auf die Uhr
zeigt mir, dass dank der schnellen Arbeit viel Zeit gewonnen wurde. Pech
hatte eigentlich nur der Kollege, der kam und meine Lokomotive übernehmen
wollte. Das tat er genau in dem Moment, wo ich die Maschine fertig
abgerüstet hatte.
Das kann
passieren und die Übergabe ist am frühen Morgen etwas kürzer. Ich kann
Feierabend machen und danach den Weg nach
Hause nehmen. Da es die Nacht von Freitag nach Samstag ist, erwarte ich
auf der Autobahn Kontrollen. Gesucht werden dort in der Regel jene Fahrer,
die sich mit Drogen wachhalten wollten und jene, die den Abend getankt
haben. Eine Kontrolle, nur dass man einen Arbeiter auf dem Heimweg
kontrollieren kann, ist jetzt eher unwahrscheinlich. Jedoch muss ich
zuerst noch losfahren. Auch der Weg nach Hause ist geschafft, die Kontrolle
war da und kein Problem. Jetzt geht es ins Bett und das Wochenende steht
an. Es ist etwas länger, als üblich, denn mein Zeitabbau ist wie durch ein
Wunder bewilligt worden. Anschliessend sind noch zwei Wochen Urlaub. Drei
Wochen zur Entspannung von der Arbeit, die nicht mehr so belastend ist. Es
gibt hier viele Kollegen, denen ein Jahr Gotthard gut tun würde, denn dort
ist der Teufel los.
|
|||||
 |
Home | Touren Erstfeld | Touren Arth-Goldau | ||
| Lokomotivführer | SBB Signale | Lukmanierbahn | |||
| Die Gotthardbahn | Die Lötschbergbahn | Links | |||
| SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt | |||
| Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten | |||||
 Der
Weg zur Arbeit ist bereits zur Routine gewor-den, die Strassen in meiner
Wohnregion sind noch trocken und der Verkehr rollt auf gewohnte Weise.
Der
Weg zur Arbeit ist bereits zur Routine gewor-den, die Strassen in meiner
Wohnregion sind noch trocken und der Verkehr rollt auf gewohnte Weise. Lokführer
sind normale Men-schen und die merken sich Punkte und wenden diese aus
Erfahrung an.
Lokführer
sind normale Men-schen und die merken sich Punkte und wenden diese aus
Erfahrung an. Weit
geht es nicht und das nächste Signal zeigt bereits wieder rot. Mit der
Weit
geht es nicht und das nächste Signal zeigt bereits wieder rot. Mit der
 Bevor
die Fahrt weitergeht, konsultiere ich die Anord-nung. Der
Bevor
die Fahrt weitergeht, konsultiere ich die Anord-nung. Der  In
Sargans sind einige
In
Sargans sind einige
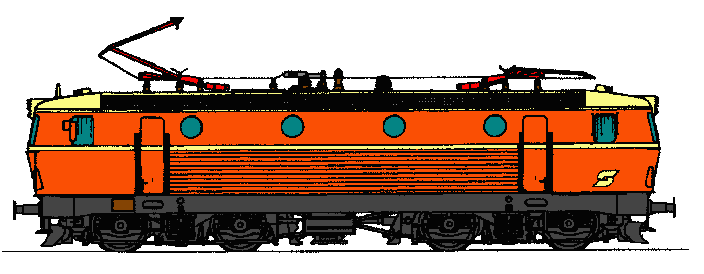 Bei meinem zugeteilten Zug empfängt mich der
Bei meinem zugeteilten Zug empfängt mich der
 Ich muss noch meine
Ich muss noch meine  Die
Die
 Bevor es jedoch soweit ist, muss ich den
Bevor es jedoch soweit ist, muss ich den
 Zum Glück behindert in dieser Nacht nicht noch Nebel
die Sicht. Auf jeden Fall jetzt stimmte meine Vermutung und ich kann
anhand der Signale in jenes
Zum Glück behindert in dieser Nacht nicht noch Nebel
die Sicht. Auf jeden Fall jetzt stimmte meine Vermutung und ich kann
anhand der Signale in jenes