|
Bedienung des Triebwagens |
|||
| Navigation durch das Thema | |||
|
Um das Fahrzeug bedienen zu können, musste man zuerst
hineingelangen. Dazu benutzte man eine der Türen. Sofern der
Triebwagen
nicht aufgerüstet war, konnten die Türen einfach mit Betätigung der
Türfalle geöffnet werden. Besondere Tricks gab es daher nicht. Aus diesem
Grund gelangte der Lokführer auf dem genau gleichen Weg in den Triebwagen,
wie jeder Reisegast. Selbst der Wechsel des Personals erfolgte über den
normalen Zugang.
Im Fahrzeug aus dem
Stilllager mussten zuerst die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
geöffnet werden. Dadurch gelangte
Druckluft
ins System. Mit Einschalten der Steuerung wurde letztlich auch diese in
Betrieb genommen. Bis jetzt war auf dem
Triebwagen
weder Licht noch sonst eine Funktion vorhanden. Einzig die in den
Schränken eingebauten Lampen erleuchteten, wenn die Türe geöffnet wurde.
Dazu war ein Kontakt an der Türe vorhanden.
Anschliessend wechselte das
Lokomotivpersonal
in den
Führerstand.
Welcher das letztlich war, war nicht so wichtig. Daher wurde in den
meisten Fällen die spätere Fahrrichtung gewählt. Wegen der Länge des
Triebwagens
war es so oder so nicht möglich, mit dem Triebwagen ohne Begleitperson
rückwärts zu fahren. Da uns diese Person jedoch fehlt, besetzen wir den
Führerstand an der Spitze des Zuges auch dort gab es noch kein Licht.
Im Gegensatz zu den älteren
Triebwagen
der Baureihe ABDe 4/8, war hier der Zugang zum
Führerstand
nicht so einfach. Eine Türe verhinderte den Weg zu den Bedienelementen.
Einerseits konnte das bedeuten, dass der ganze
Führerraum
nicht zugänglich war, oder die
Führerkabine.
Auf jeden Fall musste der Lokführer, wollte er zu seinem Arbeitsplatz
kommen um die Türe gehen, denn irgendwie stand sie immer im Weg.
Betrachten wir den Arbeitsplatz des Lokführers genauer.
Die
Führerkabine
war verhältnismässig eng gebaut worden und wurde auf der rechten Seite des
Fahrzeuges angeordnet. Neben den Bedienelementen, die auf einem
Führerpult
angeordneten wurden, gab es einen einfachen Stuhl. Damit konnte der
Lokführer seine Arbeit sitzend verrichten. Der lose dastehende Stuhl
konnte zwar verschoben, nicht aber in der Sitzposition verändert werden.
Zudem konnten diese Schalter nun auch an schmalen Stellen montiert
werden. Selbst die Position quer oder längs der Fahr-richtung war eine
Möglichkeit. Gerade bei engen Kabinen kam oft die seitliche Anordnung beim
Durchgang zur Anwendung. Die Steuerschalter dienten der Inbetriebnahme des Triebwagens. Dazu gehörten in erster Linie, die Inbetriebnahme der Steuerung. Genau genommen wurde jetzt der Führerstand aktiviert.
Damit das nur einmal möglich war, wurde der Schlüssel zum
Verriegelungskasten nur einmal auf dem Fahrzeug aufgelegt. Mit der
eingerichteten
Vielfachsteuerung
konnten jedoch Schaltungen eingestellt werden, die nicht logisch waren.
Nach Aktivierung des
Führerstandes
und der Steuerung konnte der
Stromabnehmer
gehoben werden. Die Zeit, die dieser benötigte, bis er den
Fahrdraht
berührte, musste natürlich abgewartet werden. Meistens bereitete man den
Kompressor
vor. Mit Betätigung des
Steuerschalters
zum
Hauptschalter
wurde der
Triebwagen
eingeschaltet und die
Inbetriebsetzung
abgeschlossen. Nur konnte die Fahrt nicht begonnen werden. Mit dem nun vorhandenen hauptsächlichen Stromsystem des Triebwagens standen die Hilfsbetriebe bereit. Dadurch begann der Kompressor mit Hilfe des Druckschwankungsschalters den Vorrat bei der Druckluft zu ergänzen. Gleichzeitig wurde die Spannung der Fahrleitung angezeigt und die Batterien mit dem Ladegerät wieder geladen.
Wie Sie feststellen konnten, wurden in diesem Verriegelungskasten
alle für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges notwendigen
Steuerschalter
zusammengefasst. Als nächstes mussten deshalb die
Bremsen
geprüft werden. Das war ein wichtiger Punkt, denn im Notfall war es so
möglich mit dem Fahrzeug anzuhalten. Wenn nicht losgefahren werden konnte,
war das kein so grosses Problem, denn es passierte nichts Weiteres.
Dazu musste der Hahn zu den
Bremsventilen
geöffnet werden. Zusätzlich wurde das
Führerbremsventil
in die Stellung «Fahren» verbracht. Damit konnte nun die
Druckluft
von der
Apparateleitung
zu den
Ventilen
strömen. Da die automatische Bremse einige Zeit benötigte bis sie betriebsbereit war, beginnen wir die Prüfungen mit der Rangierbremse. Das Rangierbremsventil wurde dazu zuerst angezogen.
Am entsprechenden Manometer musste der Druck im
Bremszylinder
ansteigen. Konnte dies erkannt werden, wurde die
Rangierbremse
wieder gelöst. Diese
Bremsprobe
war erfolgreich, wenn der Zeiger das Manometer wieder auf null stand. Nachdem mit dem Führerbremsventil der Bauart Oerlikon FV 5 die Hauptleitung auf fünf bar gefüllt wurde, konnte auch diese Prüfung vorgenommen werden.
Bei diesem
Bremsventil
handelte es sich um ein
Ventil,
das speziell für die BLS entwickelt wurde und auf den Erfahrungen mit dem
FV4a
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB aufbaute. Dieses Ventil verfügte über
eine Nachspeisefunktion und über eine automatische Druckregelung beim
Füllstoss. Jedoch war der Hochdruckfüllstoss des Modells FV4a nicht vorhanden. Selbst bei der Bedienung gab es Unterschiede. So wurde der Druck in der Hauptleitung durch verbringen des Hebels in die Stellung «Bremsen» abgesenkt.
Das erfolgte so lange, bis der Griff in die Stellung «Abschluss»
verschoben wurde. Nun musste am Manometer ein Druck im
Bremszylinder
festgestellt werden. War das nicht der Fall, waren die
Bremsen
noch nicht bereit.
Mit verbringen des Hebels in die Stellung «Fahren» wurde die
Hauptleitung
wieder auf den normalen Druck gefüllt. Der Druck am Manometer musste nun
vollständig aus dem
Bremszylinder
entweichen. Dabei zeigte das Manometer nur den Bremszylinder
der vordersten
Achsen
an. Für die Fahrt mit dem
Triebwagen
reichte das in der Regel aus, bei zusätzlichen Wagen mussten deren
Bremsen
auch geprüft werden. Damit war diese nur mit den Manometern durchgeführte
Bremsprobe
abgeschlossen.
Da dies in der Regel beim besetzten Führerstand der Fall war, war bei der Bremsprobe keine Rückmeldung über die Bremssohlen vorhanden.
Es wurde lediglich der Druck im
Bremszylinder
betrachtet. Die
Brems-klötze
blieben wegen der
Handbremse
und jetzt wegen der
Rangierbremse
immer angelegt. Damit waren die Bedingungen für eine korrekte Fahrt erfüllt und der Lok-führer konnte, sofern er dazu die Erlaubnis erhalten hatte, den Trieb-wagen in Bewegung setzen.
Dazu musste zuerst die Fahrrichtung eingestellt werden. Danach
konnte die
Rangierbremse
gelöst und am
Steuer-kontroller
gleichzeitig eine
Fahrstufe
eingestellt werden. Dazu musste der Steuerkontroller aus der Mitte im
Uhrzeigersinn verdreht werden.
So wurde die Steuerung angewiesen, die erste
Fahrstufe
einzustellen. Im ebenen
Gleisfeld
sollte der
Triebwagen
damit losrollen. Je weiter der Lokführer den
Steuerkontroller
im Uhrzeigersinn bewegte, desto höher war die gewählte Fahrstufe und somit
der
Strom
an den
Fahrmotoren
und die
Zugkraft.
Wegen der verwendeten
Hüpfersteuerung,
konnte man nicht von zuschalten sprechen, da der Befehl des Lokführers von
der Steuerung unverzüglich umgesetzt wurde.
Verbrachte man den
Steuerkontroller
von der Mitte in die Position der Stufe drei, war diese daher sofort
zugeschaltet. Dadurch stiegen aber auch die
Ströme
an den
Fahrmotoren
entsprechend an. Wer unbedacht zuschalten wollte, riskierte, dass der
zulässige
Fahrmotorstrom
überschritten wurde. Die
Relais
zu den Fahrmotoren sorgten dafür, dass der
Hauptschalter
ausgeschaltet wurde. Man durfte danach wieder von vorne beginnen.
Drehte man den
Steuerkontroller
in die entgegengesetzte Richtung, wurde die
Zugkraft
reduziert und beim Erreichen der mittleren Stellung ausgeschaltet. Die
Hüpfer
reagierten daher unverzüglich, so dass man keine
Trennhüpfer
benötigte um die
Zugkraft
schlagartig abzuschalten. Die normalen Hüpfer der
Hüpfersteuerung
übernahmen diese Aufgabe. So war eine schnelle und zuverlässig
funktionierende Steuerung vorhanden, die den aktuellen Vorgaben entsprach.
Gehen wir davon aus, dass die erste Fahrt vom
Depot
an den
Bahnsteig
führt, dann können wir davon ausgehen, dass mit dem Zug mit Hilfe der
pneumatischen
Bremse
angehalten wurde. Der alleine verkehrende
Triebwagen
nutzte dazu durchaus die
Rangierbremse.
Bei einem Zug wurde wegen den Wagen die
automatische Bremse
dazu benutzt. Egal wie, nach dem Halt wurde der Zug mit der Rangierbremse
gesichert. Letztlich bestand die Wahl eigentlich nur bei Rangierfahrten und es hing von der Instruktion ab, welches Bremssystem vom Lokführer genutzt wurde. Die Wirkung der Bremsventile war unterschiedlich, da die automatische Bremse träger arbeitete, als das bei der direkten Bremse der Fall war.
Damit die Leute einsteigen konnten, musste der Lokführer im
Führerstand
die Freigabe betätigen.
Die
Einstiegstüren
öffneten sich anschliessend manuell durch die Reisenden. Während dieser
Zeit war die pneumatische Regelung drucklos und die Türe konnte leicht
aufgestossen werden. Eine geöffnete Türe blieb dabei offen. Sie konnte
jedoch, indem man sie zuzog oder zustiess, manuell geschlossen werden. Ein
leichter Vorgang, der nie genutzt wurde.
Da dies jedoch niemand machte, konnte der Lokführer die Türen von
Führerstand
aus schliessen. Dazu wurde ein elektrisches Signal zur Türe gesandt und
die pneumatische Regelung dazu bewegt, den Schliesszylinder mit
Druckluft
zu versorgen. Die Türen wurden nun geschlossen und konnten nur gegen die
Kraft der Druckluft geöffnet werden. Eine Überwachung in Form eines
Einklemmschutzes
gab es jedoch nicht.
Während der Fahrt waren die Türen daher durch die Steuerung
blockiert. Damit war gesichert, dass die Türe nicht ungewollt geöffnet
werden konnte. Die Freigabe erfolgte erst kurz vor dem Stillstand durch
den Lokführer. Anschliessend konnten die Türen leicht geöffnet werden.
Damit entsprach diese Handhabung in allen Punkten den
Einheitswagen.
Ein Punkt, der auch hier umgesetzt wurde und so mit diesen Wagen
einheitliche Züge ergab.
Dazu wurde der Steuerkontroller einfach aus der Mittelposition gegen den Uhrzeigersinn verdreht. Der Hilfsumformer für die elektrische Bremse wurde zugeschaltet. Die
Wendeschalter gruppierten die
Fahrmotoren
so um, dass der elektrische Bremsbetrieb möglich wurde. Da diese Schaltung
etwas dauert, musste man etwas warten. Die Regelung der elektrischen Bremse erfolgte auf die gleiche Weise, wie die Regelung der Zugkraft. Das heisst, der Lokführer konnte mit dem Steuerkontroller die Bremskraft erhöhen oder redu-zieren.
Wobei jetzt die
Bremskraft gegen den Uhrzeigersinn zunahm und in
der Gegenrichtung reduziert wurde. Damit kann zusammenfassend gesagt
werden, dass es im Uhrzeigersinn schneller wurde und gegen den Uhrzeiger
langsamer. Bei einem Triebwagen gab es jedoch nicht nur der Lokführer, der mit dem Fahrzeug arbeitete. Daher müssen wir uns die Bedienung auf für den mit-reisenden Zugführer ansehen.
Hier galt es natürlich auch die
Beleuchtung
und die
Heizung
der Abteile entsprechend einzustellen. Die
Beleuchtung
wurde jedoch durch den Lokführer grundsätzlich ein- und ausgeschaltet.
Dabei ver-kehrte man anfänglich am Tag und ohne
Tunnel
ohne Licht.
Speziell war die
Lautsprecheranlage.
Diese war auf dem
Triebwagen
eingebaut worden und wurde über die
Vielfachsteuerung
auf Wagen übertragen. Jedoch gab es dort keine Sprechstellen. So konnte
man nur von Triebwagen aus den Zug beschallen. Zwar waren diese Anlagen
damals eher für den Ausflugsverkehr gedacht, trotzdem war es dem
Zugführer
damit möglich auch andere Durchsagen, wie die Ankündigung eines Haltes
anzusagen.
Wirklich neu war jedoch der Druckknopf an der Seite des Zuges.
Damit konnte der
Zugführer
dem Lokführer ein Signal übermitteln. Dieses Signal war die Zustimmung zur
Abfahrt und galt daher als Abfahrerlaubnis.
Der Lokführer konnte so den Zug in Bewegung setzen, ohne dass er optisch
den Zugführer suchen musste. Diese Lösung erleichterte den Vorgang bei der
Abfahrt eines Zuges in engen
Kurven
und wurde vom Personal häufig genutzt.
Damit haben wir die wenigen Funktionen für das
Zugpersonal
kennen gelernt. Damit bleibt eigentlich nur noch das Verladepersonal im
Gepäckabteil.
Das Tor konnte einfach entriegelt und so in zwei Stufen geöffnet werden.
Auch im geöffneten Zustand war eine Verriegelung vorhanden. So konnte das
Tor je nach Bedarf geöffnet werden. Jedoch war es dem Lokführer mit der
Türschliessung nicht möglich das Tor zu schliessen.
Da gerade im Sommer oft mit offenem Tor gefahren wurde, war eine
Vorlegestange vorhanden. Diese war in Führungen gehalten und konnte damit
mittig quer zum Tor platziert werden. Diese primitive Absturzsicherung
erfüllte ihren Zweck jedoch nur bedingt. Einen richtigen Schutz bot diese
Stange nicht. Daher wurde das Personal angewiesen die Tore zu schliessen.
Jedoch im Sommer bei heissen Tagen überlass man solche Anweisungen.
Zum Schluss soll noch erwähnt werden, was nach der Fahrt
passierte. Jetzt waren die Handlungen in umgekehrter Reihenfolge
vorzunehmen. Dabei wurde natürlich keine
Bremsprobe
mehr gemacht, sondern der
Triebwagen
mit dem
Führerbremsventil
und der
Handbremse
gesichert. Ganz zum Schluss wurden die Hähne zu den
Hauptluftbehältern
geschlossen und das Fahrzeug über eine Türe verlassen. Das Personal
schloss ganz zum Schluss noch die Türe manuell. Für Bildung eines Pendelzuges mit passenden Reisezugwagen und Steuerwagen, musste der Triebwagen nur ausgeschaltet werden. Danach konnte das Vst-Kabel, die Leitungen und der Personenübergang verbunden werden. Zum Schluss mussten noch die Verschlüsse der Übergangstüre gelöst werden. Im Betrieb gab es jedoch keine Beschränkungen im Bezug auf die Leistung und die Höchstgeschwindigkeit.
|
|||
| Letzte |
Navigation durch das Thema |
Nächste | |
| Home | SBB - Lokomotiven | BLS - Lokomotiven | Kontakt |
|
Copyright 2018 by Bruno Lämmli Lupfig: Alle Rechte vorbehalten |
|||
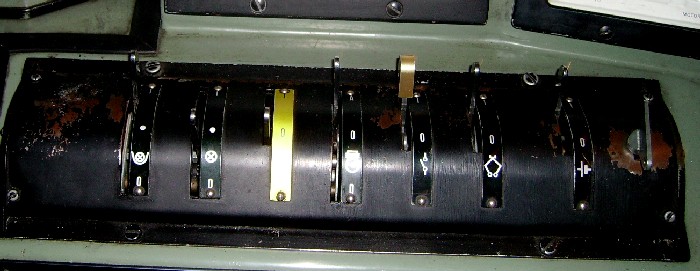 Dank
dem Verriegelungskasten, der vor wenigen Jahren in der Schweiz eingeführt
wurde, waren zumindest die
Dank
dem Verriegelungskasten, der vor wenigen Jahren in der Schweiz eingeführt
wurde, waren zumindest die  So
musste sich der Lokführer den
So
musste sich der Lokführer den
 Der
Der
 Die
gefahrene Geschwindigkeit las der Lokführer am
Die
gefahrene Geschwindigkeit las der Lokführer am
 Auf
der Fahrt mit einem Zug wurde zur Verzö-gerung natürlich in erster Linie
die
Auf
der Fahrt mit einem Zug wurde zur Verzö-gerung natürlich in erster Linie
die